Krieg im Gazastreifen: Die unerträgliche Bequemlichkeit der einseitigen Solidarität
Der Protest gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen wird in Deutschland immer lauter. Gleichzeitig nehmen antisemitische Übergriffe massiv zu.

A m 27. September, knapp zwei Jahre nach dem Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober 2023, demonstrierten in Berlin Zehntausende gegen das Sterben in Gaza. Es war eine laute, sichtbare, wütende Demonstration. Und eine nachvollziehbare: Seit zwei Jahren sterben palästinensische Kinder, Frauen, Männer – durch Bomben, Hunger, Krankheit. Die Demonstrierenden forderten zu Recht Empathie für dieses Leid ein.
Was fehlte, war die Empathie für die Opfer des Terrorüberfalls. Am Morgen des 7. Oktober 2023 drangen islamistische Terroristen in gut 20 Orte im Süden Israels ein, darunter die Kibbuzim Be’eri und Kfar Aza. Innerhalb weniger Stunden wurden mehr als 1.200 Menschen getötet. Männer, Frauen, Kinder, ganze Familien. Rund 250 Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt, viele von ihnen sind bis heute nicht zurückgekehrt. Es war der größte Massenmord an Juden und Jüdinnen seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
In Deutschland, wo der größte antisemitische Massenmord der Geschichte stattfand, gab es daraufhin keine mit den Opfern und Geiseln solidarische Massendemonstration in vergleichbarem Umfang. Schon ab dem 8. Oktober begannen die Erklärungen, Kontextualisierungen und Relativierungen. Die Demonstration vom 27. September zeigte nur Solidarität mit den Menschen in Gaza (alle Flaggen außer der palästinensischen waren verboten). Sie machte eine Asymmetrie deutlich, die inzwischen den Alltag prägt.
Auf vielen Straßen flattern Palästinensertücher, das Modeaccessoire dieses Sommers, während Juden berichten, dass sie nicht mehr ihre Kippa in der Öffentlichkeit tragen. In Deutschland stieg die Zahl antisemitischer Vorfälle um 77 Prozent – durchschnittlich 24 pro Tag. Antisemitismus lässt sich längst nicht mehr einer Gruppe zuordnen – er ist wieder deutsche Tradition geworden. Man trifft auf ihn auf Demos, wo Parolen gerufen werden, die nach Auslöschung klingen und die natürlich auch andernorts zu hören sind.
Der Israel-Palästina-Konflikt wird vor allem in linken Kreisen kontrovers diskutiert. Auch in der taz existieren dazu teils grundverschiedene Positionen. In diesem Schwerpunkt finden Sie alle Kommentare und Debattenbeiträge zum Thema „Nahost“.
Wo das hinführen kann, zeigt nicht zuletzt der Anschlag in Manchester mit zwei Todesopfern. Die Soziologin Eva Illouz hat diesem Mechanismus einen Namen gegeben: „selektive Empathie“. Die entscheidet, wessen Leid betrauert wird und wessen nicht. Am Tag nach dem 7. Oktober zeigte sich, dass für viele das jüdische Leid nicht als menschliches, sondern nur als politisches Leid zählt – erklärbar, verrechenbar, sekundär. Illouz nennt das „virtuosen Antisemitismus“: die Überzeugung, moralisch zu handeln, während man in Wahrheit Juden entrechtet.
Zweifel an Fakten
Israel ist der einzige Schutzraum des jüdischen Volks. In den vergangenen Jahren wurde das Land zu einer Projektionsfläche gemacht, die alles Negative verkörpert: Kolonialismus, Kapitalismus, Rassismus. Und in dieser Projektion kann kein Jude einfach nur Opfer sein. Das erklärt vielleicht auch, warum nach dem 7. Oktober selbst über Fakten gestritten wurde, etwa über die Zahl der Opfer oder über die bloße Existenz der Geiseln. Es war, als würde man nicht mehr dieselbe Realität teilen.
Wer die Kategorien der Dekolonialismusdebatte so verinnerlicht hat, passt die Fakten an seine Narrative an. Plötzlich zählt nicht mehr, was passiert ist, sondern, was in ein Schema passt. Natürlich kann man es niemandem verübeln, zerrissen zu sein beim Blick auf Israel und Gaza. Der Krieg des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und seiner rechtsradikalen Regierung ist brutal, Geiseln werden in Tunneln gefangen gehalten, palästinensische Kinder sterben, das Ziel der Hamas ist die Vernichtung Israels.
Diese Gleichzeitigkeit auszuhalten und anzuerkennen, wäre die eigentliche Aufgabe. Doch genau hier versagt gerade die Debatte. Sie flieht in die Bequemlichkeit der Eindeutigkeit. Und die macht blind für die Gleichzeitigkeit zweier Leiden. Empathie, so scheint es, duldet kein Nebeneinander. Deutschland ist im Gedenken stark, aber in der Empathie schwach. Erinnerung funktioniert, solange sie ritualisiert ist. Wenn sie lebendig wird, wenn sie das Leid der Juden heute ernst nehmen müsste, bricht sie zusammen.
Die Lehre des 7. Oktober lautet: Erinnerungskultur verliert ihre moralische Autorität, wenn sie sich nicht auf die Gegenwart einlässt. Humanismus verliert seine Substanz, wenn er selektiv wird. Universalismus verliert seine Glaubwürdigkeit, wenn er aufhört, universell zu sein. „Nie wieder“ ist wertlos, wenn es nur für die Vergangenheit gilt. Es muss auch für die Gegenwart gelten; für Auschwitz und Kfar Aza, für Rafah und Sderot, für jüdische Kinder im Kibbuz wie für palästinensische Kinder unter Trümmern. Wer das nicht aushält, verrät die Idee des Universalismus selbst – und damit die Grundlage jeder Moral.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
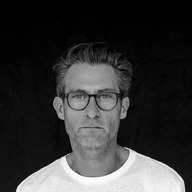


















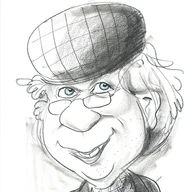

meistkommentiert