Soziologin über soziale Ungerechtigkeit: „Die untere Hälfte besitzt nichts“
In den letzten Jahrzehnten gab es eine Umverteilung von unten nach oben, sagt die Soziologin Silke van Dyk. Auch die Lebenserwartung hänge mit Klasse zusammen.

Die einen haben nichts, die anderen vererben ihr Geld Foto: LeFranc/Figaro/laif
taz: Frau van Dyk, auf einer Skala von null bis zehn: Wie sozial gerecht geht es in Deutschland zu, wenn zehn extrem ungerecht ist?
Silke van Dyk: Sagen wir mal acht. Es geht definitiv ungerecht zu in unserer Gesellschaft. Es gibt natürlich Gesellschaften, die noch ungleicher sind, die gar keine Grundsicherung haben, kein institutionalisiertes Rentensystem, noch weniger Geld ins Gesundheitssystem stecken. Aber im europäischen Vergleich hat Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren und ein extremes Ausmaß an Vermögensungleichheit.
Privatversicherte leben länger als Kassenpatienten, Beamte länger als Arbeiter. Hat die Lebenserwartung etwas mit dem sozialen Standort zu tun?
Wir haben eine hochgradig klassenspezifische Lebenserwartung. Bei den Männern ist der Unterschied besonders ausgeprägt. Wenn man die nimmt, die weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verdienen, und mit denen vergleicht, die mehr als 150 Prozent dessen haben, liegt der Unterschied bei fast 11 Jahren. Das ist die existenziellste Form der Ungleichheit, die wir uns denken können. Auch die Coronapandemie hat gezeigt, dass das Risiko, schwer zu erkranken und zu sterben, hochgradig mit Einkommen und Klassenlage zusammenhängt.
Silke van Dyk

Foto: Photostudio Klam
Jahrgang 1972, ist Professorin für Politische Soziologie an der Universität Jena. Sie forscht zu sozialer Ungleichheit.
Welche gesellschaftlichen Folgen hat Armut?
Neben einem von Unsicherheit geprägten Alltag und einer kürzeren Lebenserwartung, übersetzt sich Armut in schlechtere Bildungschancen und weniger politische Beteiligung. Wir haben ein System, das zwar formal politische Gleichheit garantiert, das aber in höchstem Maße mit einem System der sozialen Ungleichheit verwoben ist. Dieses Spannungsverhältnis von politischer Gleichheit und sozialer Ungleichheit ist ein Grundproblem kapitalistischer Gesellschaften, das bei stark ausgeprägter Ungleichheit besonders demokratiegefährdend ist. Keine Gruppe ist im Deutschen Bundestag zum Beispiel so unterrepräsentiert wie diejenigen, die einen Hauptschulabschluss haben. Auch die Wahlbeteiligung von Menschen, die über weniger ökonomische oder Bildungsressourcen verfügen, ist deutlich niedriger, was zusätzlich verstärkt, dass ihre Anliegen weniger Gehör finden.
Vererbt sich sozialer Status?
Absolut. Was das ökonomische Kapital angeht, leben wir in einer Erbengesellschaft, in der große Vermögen auf die nächste Generation übertragen werden. Das führt zu einer erheblichen Vermögenskonzentration: Das reichste eine Prozent besitzt zirka ein Drittel des Vermögens, und bei den wohlhabendsten zehn Prozent sind fast zwei Drittel versammelt. Aber auch der Rest verteilt sich nicht gleichmäßig, denn die untere Hälfte der Bevölkerung besitzt praktisch nichts.
Das sind Dimensionen, die vielen Leuten nicht bewusst sind, weil im Alltag und in den Medien stärker die Einkommensfrage angesprochen wird. Und das, obwohl Erbschaften im Vergleich zu Einkommen kaum besteuert werden, im Durchschnitt sind sie wegen der hohen Freibeträge mit gerade mal zwei Prozent belastet. Eigentlich leben wir in einer Gesellschaft, die gern als Leistungsgesellschaft beschrieben wird. Wenn man das ernst nimmt – obwohl bereits daran viel zu kritisieren wäre –, muss man fragen: Was ist das für ein System, das ererbte Vermögen so schont?
Sie forschen zum Strukturwandel des Eigentums. Hat diese Schieflage zugenommen?
Was wir in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben, könnte man als Klassenkampf von oben bezeichnen: eine systematische Umverteilung von Ressourcen von unten nach oben, und zwar nicht nur als Ergebnis von Marktprozessen, sondern dezidiert politisch forciert. Wir haben die Senkung von Spitzensteuersätzen gehabt, eine Entlastung bei der Besteuerung von Kapitalerträgen, eine Senkung der Unternehmenssteuern, die Abschaffung der Vermögenssteuer. Wir sehen so etwas wie eine Radikalisierung und Konzentration von Privateigentum, denn die Pflichten und die Abgaben für diejenigen, die etwas besitzen, werden immer kommoder. Und während das Privatvermögen in Deutschland stetig wächst, produzieren die steuerlichen Entlastungen öffentliche Armut, kaputtgesparte Kommunen, Lücken in der Infrastruktur.
Sie sagen, dass die aktuellen Eigentumsverhältnisse immer mehr in Bewegung geraten. Wo sieht man das?
Politisch haben wir im Nachgang der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 neue Protestbewegungen erlebt, die soziale Schieflagen anprangern, etwa die Occupy-Bewegung in den USA oder die Indignados in Spanien oder Syriza in Griechenland. Auch wenn die wieder abgeebbt sind, kann man doch sagen, dass die soziale Frage zumindest diskursiv wieder eine größere Rolle in Politik und Gesellschaft spielt.
In Deutschland ist die populäre Kampagne „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ derzeit ein gutes Beispiel: Hier wird skandalisiert, dass Wohnraum in der Hand von Immobilienkonzernen zur Profitquelle und zum Spekulationsobjekt wird. Interessant ist auch, dass inzwischen selbst Institutionen, die neoliberale Vorreiter waren, wie die Weltbank oder der IWF, Analysen zu sozialer Ungleichheit vorgelegt haben.
Nicht weil sie plötzlich eine gerechtere Gesellschaft wollen, sondern weil sie zu dem Schluss kommen, dass die soziale Ungleichheit ein solches Ausmaß angenommen hat, dass sie systemdestabilisierend wird. Außerdem stellen sich mit der Digitalisierung natürlich ganz neue Fragen des geistigen Eigentums, während die Pandemie den Blick auf die Patentierung von Impfstoffen und die Privatisierungen im Gesundheitswesen lenkt.
Mit Blick auf die Bundestagswahlen: Gibt es die Hoffnung, dass sich etwas an der sozialen Ungleichheit ändert?
Wir haben einen kaum diskutierten Lagerwahlkampf. CDU und FDP privilegieren mit ihren Steuerentlastungen die hohen und sehr hohen Einkommen, auch soll die Unternehmenssteuer weiter gesenkt werden. In sehr unterschiedlichem Ausmaß wollen SPD, Grüne und Linke die niedrigeren und mittleren Einkommen entlasten und Spitzenverdiener sowie hohe Vermögen belasten. Interessant ist, dass sich das weder politisch noch medial in entsprechende Koalitionsspiele übersetzt. Rot-Rot-Grün ist definitiv keine der breit diskutierten möglichen Optionen, die Linken werden auch medial gerne als nicht koalitionsfähig abgehakt.
Würde es bei Rot-Rot-Grün den großen Vermögen an den Kragen gehen?
Eindeutig: nein. Der heute radikalste Vorschlag, wenn es um die Besteuerung von Vermögen geht, das Wort radikal mag ich da eigentlich gar nicht verwenden, ist der von der Linken mit einem Freibetrag von einer Million Euro und einem dann beginnenden Steuersatz von einem Prozent. Das betrifft gerade mal ein Prozent der Haushalte, während die reichsten zehn Prozent zwei Drittel des Vermögens halten. Die Grünen wollen bei zwei Millionen anfangen, die SPD legt sich nicht fest. Alle zielen mit ihren Maßnahmen auf das obere Prozent oder noch weniger, eine ganz kleine Gruppe, an die Erbschaftssteuer wagt sich außer der Linken – und da bleibt es vage – niemand richtig ran. Eine gerechte Gesellschaft baut man aber nicht, indem man ein paar Superreiche etwas stärker besteuert.
Der Klassenkampf von oben wird also weitergehen?
Das hängt nicht nur von der zukünftigen Koalition, sondern immer auch davon ab, ob sich starke Gegenbewegungen formieren. Grüne und Linke wollen immerhin die Privilegierung von Einkommen aus Kapital gegenüber Lohneinkommen abbauen. Was ich trotzdem nicht sehe, sind Ansätze, die an den gegebenen Eigentumsverhältnissen wirklich substantiell etwas ändern würden. Ich finde spannend, was der französische Ökonom Thomas Piketty vorgeschlagen hat, um einen konkreten Vorschlag zu nennen: Zum 18. Geburtstag wird jedem Menschen die Hälfte des Durchschnittsvermögens ausbezahlt, finanziert durch eine Eigentumssteuer. Das wäre quasi eine Sozialisierung von Erbschaften, ohne sie komplett abzuschaffen. Und zuletzt ein Bogen zum Anfang zurück: Dass die klassenspezifische Lebenserwartung in einem so wohlhabenden Land im Wahlkampf nach der Coronapandemie ein Tabu bleibt, das ist für mich das größte Versagen der linken Parteien.
Das Interview ist ein Auszug aus dem taz Talk „Klassenkampf von oben – Arm bleibt arm, Reich wird reicher“.



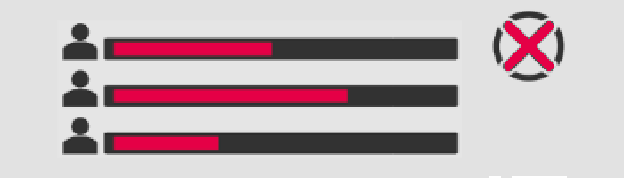




Leser*innenkommentare
RED
Hier ist klar Wirtschafts-Aktivismus gefragt. Vorzugsweise bei den demokratisch organisierten Genossenschaften Produkte und Dienstleistungen erwerben etc.
97287 (Profil gelöscht)
Gast
Da ist der allerärmste Mann dem Andern viel zu reich, das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alles gleich.
Frederik Nyborg
@97287 (Profil gelöscht) »Reicher Mann und armer Mann standen da und sah'n sich an. Und der Arme sagte bleich: Wär' ich nicht arm, wärst Du nicht reich.« Bertolt Brecht.
Alexander Dill
Reich ist, wer kein Einkommen braucht.
h3h3y0
Wie soll die untere Hälfte was besitzten, wenn alles dank bestimmter Politik teurer wird und diese untere Hälfte sich dann kaum was leisten kann.
Ricky-13
„Die untere Hälfte besitzt nichts“
Kann sie ja auch nicht, denn die Reichen besitzen ja schon alles.
Die zehn ersten Plätze in der Rangliste der reichsten Deutschen (Manager Magazin 2020): 1. Familie Reimann (Kaffee, etc.) - 32 Milliarden Euro. 2. Dieter Schwarz (Lidl) - 30 Milliarden Euro. 3. Susanne Klatten und Stefan Quandt (BMW) - 25 Milliarden Euro. 4. Albrecht und Heister (Aldi-Süd) - 23 Milliarden Euro. 5. Merck (Pharmaindustrie) - 21,5 Milliarden Euro. 6. Henkel (Waschmittel, etc.) - 18 Milliarden Euro. 7. Theo Albrecht junior und Babette Albrecht (ALDI) - 17,4 Milliarden Euro. 8. Heinz Hermann Thiele (Bremssysteme u.a.) - 17 Milliarden Euro. 9. Brenninkmeijer (Textilhändler C&A) - 14 Milliarden Euro. 10. Porsche (Porsche) - 13,5 Milliarden Euro. … und so weiter, und so fort.
There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning." („Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen“). [Quelle: Warren Buffett, 2006 in der New York Times]
97760 (Profil gelöscht)
Gast
@Ricky-13 Es ist natürlich die Spitze eines verschwörungstheoretischen Ansatzes, daß die Geldmenge ungleich verteilt sei zum Nachteil Dritter. Konsequent wäre es, bei der EZB zu fragen, wieviele Euros habt ihr online gemacht, plus Bargeld, und wo ist das hingekommen. Mit Sicherheit haben 500Mrd. Euro in Privatbesitz von einigen Wenigen, keinen einschränkenden Einfluss auf die Vermögensbildungsoptionen nachgelagerter Einkommenklassen.
Münchner
Es wird ständig von Gerechtigkeit gesprochen, aber Gleichheit gemeint.
Wenn jemand Jahre in seine Ausbildung investiert, warum sollte er dann das Gleiche verdienen, wie jemand, der sich den Stress nicht auftut. Ein Ingenieur kann ohne weiteres als Paketfahrer arbeiten. umgekehrt wirds schwierig.
MEYER_Kurt
@Münchner So ist es! Dank Schüler-Bafög und Bafög ist es heute kein Problem mehr, eine gute Ausbildung (sei es Studium oder Handwerk) zu absolvieren. Allerdings fehlt es vielen der "jungen Generation" in meinen Augen an Durchhaltevermögen- hauptsache das neue IPhone, NetflixAbo und fette Flachbildglotze.
Nafets Rehcsif
@Münchner „ Ein Ingenieur kann ohne weiteres als Paketfahrer arbeiten. umgekehrt wirds schwierig.“
Ja genau, wenn die ganzen Assis nur studiert hätten, dann wären wir heute das reichste Völklein der Welt und niemand bräuchte mehr Pakete ausfahren1!11
MEYER_Kurt
@Nafets Rehcsif es muss nicht jeder studieren! Aber wenn man sich anschaut wieviele die Schule ohne Abschluss verlassen und wieviele keine Ausbildung abschließen (sei es Studium oder Lehre), und das trotz freier Studien- und Lehrstellen, dann kann man schon die berechtigte Frage stellen, ob es nicht an Haltung fehlt...
Max Weber
@Münchner Als erstes gehe ich mal davon aus, Nomen est omen, und als gestandener Bayer stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie zu den Profiteuren des Systems gehören. Dabei verlieren sie aus den Augen, dass in keinem Land innerhalb Europas die Schulbildung derart vom sozioökonomischen Status abhängt wie in Deutschland. Damit weird es für den nicht mit dem goldenen Löffel gefütterten schon mal bedeutend schwieriger eine Akademikerkarriere zu starten. Soviel zur sozialen Selektion. Zweitens geht es hier nicht voorangig nicht um Einkommen, sondern um Vermögen. Die Vermögensungleichheit ist doch mttlerweile in Deutschland derart, dass wie im Artikel beschrieben, 10% die Hälfte des Gesamtvermögens auf sich vermeinen, während sagenhafte 50% Deutschlands gar nichts besitzen. Und systemimmanent werden sie auch nie etwas besitzen, es sei denn, es ändert sich grundlegend etwas an der Verteilung, denn mit dem derzeitgen System verschärft sich die Ungleichheit zunehmend, bsi sie irgendwann explodiert. Denn mittlerweile ist es so weit, dass wahre Leistung sich in den seltensten Fällen noch lohnt. Von wenigen Glücksausnahmefällen abgesehen, wird man in Deutschland durch angestellte Arbeit kein Vermögen mehr aufbauen. Denn die Kapitaleigner schöpfen derzeit durch Mieten, Unternehmensgewinne und andere Kapitalgewinne die freien Einkommen der einzig noch wirklich arbeitenden nahezu vollständig ab, so dass ein Vermögensaufbau nahezu unmöglich wird. Und dies wird demnächst auch in Bayern ankommen, auch dort wird man bald nichts mehr von Tarifverträgen mit 5k-Lohn, 14 Monatsgehältern und pipapo hören. Wie im Rest der Republik. Die einzige Lösung vor einem mittelfristigen Zusammenbruch in Form von sozialen Unruhen kann nur eine Vergesellschaftung in Form von Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und steuerlicher Schlechterstellung im Vergleich exorbitant hoher Einkommen bieten. Und das muss weltweit sein, sonst ist es eh in 50 Jahren egal, denn da wird dann der alte grüne Sinnspruch aktuell.
Normalo
@Max Weber "...Und das muss weltweit sein,..."
Na, denn is ja jut, und wir haben die Lösung. Ich sehe in dem Satz leider einen Grammtikfehler: Nirgendwo wäre die Verwendung des Konjunktiv II/Irrealis so angebracht wie hier...
Davon abgesehen hapert es Ihrem Lösungsvorschalg auch an einer anderen Stelle, die von Linken fast durchweg übersehen wird "Vergesellschaften" und "Verstaalichen" wären nur in einer idealen Welt (in der der Sozialismus auch problemlos funktionieren würde, weil alle lieb und altruistisch fürs Allgemeinwohl schaffen) synonym. Sie wollen Vermögen verSTAATlichen, und in der realen Welt ist das leider überhaupt nicht dasselbe wie "umverteilen". Die Staatsgewalt hat - teils im Großen, teils im Kleinen - regelmäßig andere Prioritäten als das, wofür der "kleine Mann" gerne mehr Geld übrig hätte - soweit sie von etwaigen Mehreinnahmen überhaupt etwas für ihn übrig lässt.
SUSANNE FRIEDLICH
@Münchner Es geht nicht um die 1000 Euro die ein Ingeneur mehr verdient. Mahr machen die meisten nicht aus ihrem Studium. Sondern um die 100000 im Monat die ein Erbe "bekommt" weil er Anteile von Porsche hat. Die 10 Millionen weil einer Kicken kann oder einfach mal geerbt hat.
Und um Milliarden von Vermögen das einfach in Unternehmen kreist. Unversteuert und unkontrolliert.
Dein "Mehraufwand" lässt sich doch leicht rechnen. 6 Jahresgehälter Verlust auf 30 Jahre. Also steht dir ein Aufschlag von 1/5 eines Paketfahrerlohns zu + weil die studieren so schwer viel + 1/5 Bonus. Mehr nicht.
Lothar Schwarz
@Münchner Was für eine Antwort. Was für ein Egoismus, welch eine Arroganz. In der Zeit dieser "Ausbildung" arbeiten Andere zu einem Hungerlohn, damit der nun Ausgebildete z.B. auch einen Arbeitsplatz findet. Was Sie proklamieren ist das neoliberale, egoistische Denken, das auch dafür gesorgt hat, dass weltweit die Umwelt kaputt geht. Was gebraucht wird ist ein vollkommen neues Denken. Das Alte hat die Menschheit vor eine Katastrophe geführt !
warum_denkt_keiner_nach?
@Münchner "Ein Ingenieur kann ohne weiteres als Paketfahrer arbeiten."
Nicht unbedingt. Einige Exemplare würden nur stundenlang darüber reden, dass sie Pakete austragen wollen, ohne es zu tun.
Im Übrigen fordert niemand Einheitslöhne. Und es geht auch nicht wirklich um Ingenieure. Es geht um die richtig Reichen. Also bitte keinen Unfug erzählen.
Jurek K
Warum aber von den Kleinsteverdiener also der hälfte der Nichtshabenden werden immer noch steuer eingezogen?
97760 (Profil gelöscht)
Gast
@Jurek K Die Lohnsteuer, die die Kleinen "bezahlen" hat doch der Arbeitgeber ihnen gegeben. Wäre die Lohnsteuer Null, wäre das Einkommen nicht höher. Der Arbeitgeber würde dann weniger bezahlen.
38805 (Profil gelöscht)
Gast
@97760 (Profil gelöscht) Das stimmt gar nicht. Die Lohnsteuer ist die Einkommensteuer des abhängig Beschäftigten. Weil der Staat diesem nicht traut, hat er den Arbeitgeber dazu verdonnert, die Einkommensteuer als Lohnsteuer einzubehalten und für den Arbeitnehmer an das Finanzamt abzuführen.
Es gibt außerdem noch zahlreiche andere Steuern, die selbst Leute bezahlen, die sowenig verdienen, dass bei Ihnen gar keine Einkommensteuer anfällt. Umsatzsteuer, Energiesteuer, Kaffeesteuer, Biersteuer, Stromsteuer, Tabaksteuer, ...
97760 (Profil gelöscht)
Gast
@38805 (Profil gelöscht) Danke für ihren ironischen Hinweis der " Vertrauensfrage".
Elvenpath
Auch, wenn ich für diese Meinung immer heftig angegriffen werde: Man sollte das Erben großer Vermögen unmöglich machen.
Kinder reicher Eltern profitieren schon mehr als genug: Sorgenfreie Kindheit, beste Ausbildung. Dann noch einen Haufen Geld in den Allerwertesten geschoben zu bekommen, ist einfach zu ungerecht.
Ich gönne jedem seinen Reichtum. Wenn er selber erarbeitet ist.
97760 (Profil gelöscht)
Gast
@Elvenpath " wenn er erarbeitet ist"....immer dieses Mantra vom " Arbeiten". Was hat es mit diesem "Arbeiten" immer nur auf sich? Auch wird es immer wieder Menschen als Nonplusultra in angedetschtem Zustand als Allerheilmittel angedient. "Arbeiten" scheint auch das einzige Mittel der Wahl zu sein, um " Struktur" in den Tag von Leuten zu bringen. Wie stellen Sie sich den Tag von Superreichen eigentlich vor. Entweder die Milliarden werden von einem 500,- Bürostuhl verwaltet oder man liegt im Bett, schläft und lässt sich paar Sandwiches und 0,25 Rotweinfläschchen vom Lieferdienst kommen oder schaut, ob man noch ein Paar saubere Socken irgendwo hat.
Nafets Rehcsif
@97760 (Profil gelöscht) „"Arbeiten" scheint auch das einzige Mittel der Wahl zu sein, um " Struktur" in den Tag von Leuten zu bringen.“
Das stimmt leider, viele schaffen es ohne die Struktur die ihnen eine geregelte Arbeit gibt nicht und stützen voll ab. Habe ich zigmal gesehen, traurig aber wahr…
Rolf Turboheizer
Das Leben beginnt mit Bildung. Und da sorgen CDU/CSU und SPD mit Effiziens dafür das dort die Zweiklassen-Gesellschaft beginnt.Die Reichen haben alle Möglichkeiten die mit Geld zu kaufen ist. Der Untere Stand, der auf das Entgegenkommen der Politik in der Bildung angewiesen ist, wird ohne jede jede Scheu mit den allerbilligsten, was zu erhalten ist, abgespeist. Diese Politganoven wissen ganz genau das eine Jugend mit entsprechender Bildung sie umgehend von Ihren Posten jagen würde.Und wir müssen dafür sorgen das die Politiker maximal 2 Wahlperioden wählbar sind. Ansonsten geht es immer weiter mit der politischen Mafia die vom Volksbetrug lebt.
Claudia Bastian
@Rolf Turboheizer Ich glaube, dass Bildung nicht ausreicht, um der sozialen Ungerechtigkeit wirksam zu begegnen. Mehr Bildungsangebote ist ja auch für Laschet die Lösung aller Probleme, wenn er nach Reform von Hartz 4 gefragt wird. Es lassen sich nun mal viele untere Einkommensschichten nicht weiterbilden, zweitens sind die Bildungsangebote nicht ausreichend und bei denen, die sich bilden lassen würden, ist der psychische Druck aufgrund von Existenzängsten oft so gross, dass sie es auch nicht hinbekommen. Ich will ja nicht immer das Beispiel einer Lebenssituation von alleinerziehender Mutter mit 2 Kindern bringen und sicher gibt es da welche, die es schaffen, auch noch nebenher zu studieren, aber das ist schier unmöglich für die Mehrheit.
CR43
@Rolf Turboheizer Dann kriegen die also die allerbilligsten Lehrer.
MMMhhh. Ich dachte immer, dass gerade die verbeamteten deutschen Lehrer mit am besten international verdienen.
Vgl. div. Studien wie diese www.news4teachers....nen-mit-am-besten/
warum_denkt_keiner_nach?
@CR43 "Ich dachte immer, dass gerade die verbeamteten deutschen Lehrer mit am besten international verdienen."
Der neue deutsche Standardlehrer ist aber nicht mehr verbeamtet. Er hat noch nicht mal einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
Rudolf Fissner
@Rolf Turboheizer "Das Leben beginnt mit Bildung. Und da sorgen CDU/CSU und SPD mit Effiziens dafür das dort die Zweiklassen-Gesellschaft beginnt.Die Reichen haben alle Möglichkeiten die mit Geld zu kaufen ist."
Bildung von Kindern ist vor allem abhängig vom Bildungsstand der Eltern. Wie kann man bspw. den Vorsprung bem Wortschatz schon zur Zeit der Einschulung mit Geld erkaufen?
Vorlesen, Sprechen mit den Kindern, solche Soft-Skills lassen sich nicht einfach herbei zaubern.
Schnetzelschwester
"Klassenspezifische Lebenserwartung" hat auch etwas mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Menschen mit körperlicher Arbeit (Erntehelfer, Putzpersonal, Fleischzerteiler, Bauarbeiter, Fließbandarbeiter usw.) verdienen pro Stunde weniger als Akademiker mit Bürojobs. Es ist eher nicht das geringere Entgelt, das hauptursächlich für die geringere Lebenserwartung ist - dann müssten alle Teilzeitkräfte reihenweise versterben -, sondern die verschleißenden Arbeitsbedingungen der "einfachen" Tätigkeiten.
Schichtarbeit tötet. Das ist schon lange Stand der Wissenschaft und ist auch den zuständigen Bundesministerien bekannt. Schichtarbeiter bekommen überdurchschnitlich Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen, Verdauungsstörungen.
Quelle: Z.B. www.quarks.de/gesu...-dich-krank-macht/, hier auch noch weiterführende Quellenverweise.
Aber die "Wirtschaft" will es so, und die Leute wollen das Geld. Unsere Gewerkschaft wollte mal aushandeln, dass Schichtzuschläge in Freizeit gegeben bzw. die Wochenarbeitszeit entsprechend verkürzt wird. Sowohl Arbeitgeber ("Dann müssen wir ja mehr Leute einstellen!") als auch Arbeitnehmer ("Ich will lieber Geld als Urlaub.") waren dagegen.
Hinzu kommt oft Arbeit auf Abruf, Arbeit mit/in Gefahr-/Schadstoffen, höheres Unfallrisiko, reihenweise befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit, vielleicht ein Zweit- oder Drittjob, um die Miete zahlen zu können, Einarbeitung "Just in Time", Zeitdruck, Schikanen bei Krankheit (Dann geht man halt krank arbeiten und chronifiziert das Ganze.)
Und mit einem Burnout kann man länger überleben als mit Krebs. Fragt sich, ob die Restlebensqualität dann auch immer super ist.
Die Sesselfurzer (Kreißsaal-Hörsaal-Plenarsaal) in der Politik wissen doch gar nicht, wie sich Arbeit als abhängig beschäftigter Wegwerfarbeiter anfühlt. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, jedes Jahrzehnt. Und wenn du ausgelutscht bist, wirst du "sozialverträglich" entsorgt.
Rudolf Fissner
@Schnetzelschwester "Schichtarbeit tötet"
Erstens schreibt das ihre angegebene Quelle nicht. Die sagt, dass langjährige Schichtarbeit krank macht. Zweitens sind die von ihnen genannten Jobs keine Schichtarbeiter-Jobs.
Und das der Populismus nun auch gegen Entbindungskliniken ("Kreißsaal") wettert ist bezeichnend.
Seitenwechsel
"Arsch ist König" ist leider die Devise in Materialistisch geprägten Gesellschaften wie der unseren... der ständige Schwanzvergleich erzeugt irrationale Luxusbedürfnisse, unter anderem durch Social Media verbreitet sich dann der Neid, das Angebertum und die Gier, welche die Unsozialen antreibt die Finanzschwachen weiter auszubeuten um im Schwanzvergleich mit den anderen Arschlöchern besser da zu stehen. Leider werden Worte wie Sozialer Aufstieg verwendet für Menschen die nun im Wettbewerb der Asozialen zu den Gewinnern gehören. Und es gibt einen riesigen Bürokratischen Wassserkopf, welcher eine Revolution von unten unterbindet. Wer nters Rad gerät gilt dann als Psychisch krank, wer in die Fänge der modernen Wucherer gerät wird mit hilfe von Stadtverwaltungen und Gerichten gepfändet und anstatt dem Mietwahnsinn einen Riegel vorzuschieben (Wohnen ist ein Grundbedürfnis) unterstützen Staatliche Stellen die Konzerne noch durch Zwangsräumungen und Gerichtsvollzug. Selbst die Gebühreneinzugszentrale des ÖRR und die Krankenversicherungen kennen keine Gnade....Wenns ums Geld geht, dann fehlt hier jede Mitmenschlichkeit dann gewinnen die unsozialen immer gegen die Armen...Und die Lobbyisten sorgen schön dafür, dass die Regierung das Parasitentum auch weiterhin unterstützt.... Ich habe keine Hoffnung auf einen Wandel durch die Politik, es braucht eine neue Antimaterialistische Aufklärungsera inklusive einer sozial gerechteren Sprache... Wenn eine Gesellschaft z.B. einen Neureichen Benzfahrer, welcher durch Ellenbogenmentalität Reich wurde als Sozialen Aufsteiger bezeichnet, dann liegt schon in der Sprache eine Ursache für dieses Denkschema. Sozial stark sind Pflegekräfte und Sozialarbeiter, Freiwillige Helfer und Leute die viel Spenden, Aktivisten die sich für die Gute Sache einsetzen statt reich zu werden. Sozial schwach sind Wucherer, Geldeintreiber und jede Form von Korintenkacker, die die Wucherer und Geldeintreiber in ihrer Gier noch unterstützen.
Stefan L.
@Seitenwechsel „…einen Neureichen Benzfahrer, welcher durch Ellenbogenmentalität Reich wurde…“
Oh je, hier werden ja mal wieder Riesenschubladen aufgezogen und wieder zugeknallt. Wer sagt denn, dass jeder „Benzfahrer“ ausschliesslich über Ellenbogenmentalität zu seinem Wohlstand gekommen ist? Es gibt jede Menge Unternehmer oder Selbständige, die es mit guten Geschäftsideen, Intelligenz und Verantwortungsbewusstsein, wohlhabend geworden sind, ohne ihre Mitarbeiter oder Angestellten auszuquetschen oder die Natur zu zerstören. In Ihrer Scheuklappendenke sind nur arme Menschen gute Menschen und Reiche (wie immer die man bezeichnen möchte) schlechte Menschen. Das ist so intelligent wie z.B. die Aussage von rechten Idioten, Flüchtlinge sind nur Vergewaltiger und Sozialschmarotzer.
Seitenwechsel
@Stefan L. Irrationale Luxusbedürfnisse werden halt durch den Benz sehr gut dargestellt! Er wird viel zum angeben benutzt und Klimagerecht ist er sowieso nicht... Menschen glauben angesagte Markenklamotten besitzen zu müssen oder teure Autos um sich dadurch von anderen abgrenzen zu können. Das sehe ich auch in dem sozialen Brennpunkt in dem Ich wohne bei armen Menschen, welche alles geben für ihren AMG, weil Sie glauben es dann geschafft zu haben und viele andere glauben es auch.. genauso wie der korupte Finanzhai... für mich können arme Menschen genauso verblendet sein wie Reiche.
Dan Wyck
@Seitenwechsel Schön und gut – aber sagen Sie mal, Seitenwechsel: warum beuten denn die Unsozialen ausgerechnet die, ich zitiere, "Finanzschwachen" aus? Und nicht z.B. die "neureichen Benzfahrer"? Da gäbe es doch auch viel mehr zu holen! Kein Wunder, dass der Kapitalismus ständig in der Krise ist...
Onkel Heinz
@Dan Wyck Ganz einfach:
Finanzschwachen fehlt das Geld für den
Anwalt.
Es geht nicht um Geld, sondern um Macht.
Die Einteilung in Superreich, Reiche, ….. ist willkürlich. Wir leben in einem System, in dem allein Wettbewerb zum Glück führt. Wer sich anstrengt, darf die Ernte einfahren. Und wer dabei bescheißt, dem muss das erst einmal nachgewiesen werden.
Das ist eine Kaskade und hält sich nicht an Kategorien.
Wenn Reiche ihren Kindern etwas vererben, dann vor allem einen „gesunden Egoismus“.
Früher nannte sich das mal Geiz.
Nicht, dass gegen Geiz generell was einzuwenden wäre. (ich will ja schließlich auch in Zukunft das Kilo Schweinefilet so billig wie möglich kaufen)
Geiz aber zum Primat des Handelns unter dem Label „Wettbewerb“ aufzuwerten, kann auf Dauer nur Gesellschaft zersetzend wirken.
Der Markt wird es nicht richten. Der Markt wird es zu Grunde richten.
Die Realität zeigt es.
Das WWF hat nun anscheinend erkannt, dass es ein Problem gibt. Leider wird die Erkenntnis nichts ändern, denn wer anfängt vom eigenen Reichtum abzugeben, ist der Dumme, weil mit dem Reichtum Macht verloren geht.
Reiche vergleichen sich mit Reichen.
Rudolf Fissner
@Seitenwechsel "Arsch ist König" ist leider die Devise in Materialistisch geprägten Gesellschaften wie der unseren... der ständige Schwanzvergleich erzeugt irrationale Luxusbedürfnisse ...."
Ist das nicht der Vulgärmaterialsmus?
75787 (Profil gelöscht)
Gast
@Seitenwechsel In diesem Sinne morgen Aktionstag!
"Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten":
werhatdergibt.org/
Tom Farmer
Das individuelle (wirtschaftliche) Glück dieser Welt macht sich fast immer an genau zwei Dingen fest:
1.) In welchem Land werde ich geboren (Grundsatzumfeld)
2.) In welche Familie werde ich hineingeboren (Bildung/Kontakte).
Umverteilungen zu beiden Punkten betrachte ich als schwierig. Größere Ebschaften (und ich habe übrigens nix geerbt) sind für mich eine reine Neidebatte, deshalb, da die Leute die aus derlei Gründen sehr reich sind meist auch ohne diese Erbschaft wirtschaftlich erfolgreich wären: Gute Bildung, gute Kontakte, wobei wir wieder beim Thema "in welche Familie man reingeboren wurde" sind.
Im Kleinen also veränderbar: Bildung und Zugang zu Bildung durch Geld. Geld kommt per Steuer, die Vorschläge sind bekannt. Übrigens, was hier auch viele geschrieben haben: Finanzbildung auch für Erwachsene, interessant, das in Kommentaren bei der TAZ zu lesen.
Max Weber
@Tom Farmer Diese Antwort ist allerdings auch nicth viel besser.
1. Aber es gibt Staaten, da läuft es besser. Und der Reichtum Deutschlands ruht zu einem großen Teil auf der Ausbeutung des weniger Reichen Südens der Welt. Zudem ist ihr Argument, das nur weil in einer beinahe autokratischen Diktatur, die sich mit dem Label Sozialismus getarnt hat, die Umverteilung nicht von wirtschaftlichem Erfolg gekrönt war, nur insofern richtig, dass es so war. Sie lässt jedoch völlig außer acht, dass dies ist, wie sich darüber zu wundern, dass ein 10 km-Läufer gewinnt, wenn man ihm gegenüber seinem Kontrahenten 9k Vorsprung lässt. Denn auf der einen Seite wurden der Wirtschaft mithilfe des Marshall-Planes Milliarden in den A. geblasen, während auf der anderen Seite zum Ausgleich der Politik der verbrannten Erde ganze Industrien abgebaut und als Reparationen verschifft wurde. Daher vergleichen sie unabhängig von den ersten Sätzen hier Äpfel mit Flugzeugträger .
zum 2. Die wenigsten Unternehmen würden geschlossen werden, denn nicht die Unternehmen werden besteuert, sondern deren Besitzer. Und diese können ja gern Anteile im Umfang der Erbschaftssteuer an ihre Belegschaft oder interessierte Investoren verkaufen oder einen entsprechenden Kredit aufnehmen. Das hat also mit dem Unternehmen gar nichts zu tun.
zu 3. der Anteil betrieblicher Altersversorgung in Deutschland ist verschwindend gering, auch soch vor der SPD.
zu 4. Genau darum geht es doch aber, da der Median zeigt, dass es in Deutschland also bedeutend ungleicher zugeht. Und der MEdian an sich sagt noch nichts über die Höhe der tatsächlichen Vermögen aus, daher kann daraus auch keine Aussage zu etwaiger Solidaität abgeleitet werden.
zu4. die zweite...Genau, nicht jeder will Chef sein und Verantwortung tragen. Das ist ja auch okay, und rechtfertigt auch höheres Einkommen. Allerdings in Maßen. Bei den Einkommen der Vorstände in D. müssten diese 60h am Tag arbeiten, 9 Universitätsabschlüsse haben und 8 Hände haben, um diese zu "verdienen".
Normalo
@Max Weber Zu 1. Und wo kam das Geld für den Marschallplan her? Etwa aus der Sozialistischen Volksrepublik Nordamerika? Wieviel hat er wirklich gekostet, und was ist im Vergleich daraus aufgebaut worden?
Davon abgesehen ist es bloße Legendenbildung, der Sozialismus hätte funktioniert, wenn "man" ihn richtig umgesetzt hätte. "Man" hätte die ganze Volksgemeinschaft sein müssen, und die bestand eben naturgemäß nie aus einem kollektiven Geist sondern aus Millionen, von denen - ebenfalls naturgemäß - ein erheblicher Teil erstmal fragt "Und was kommt für MICH dabei raus?", bevor er sich für die gemeinsame Sache ins Zeug legt. DAS war das Problem, und dafür gibt es - außer dem Austausch des Volkes durch eine entsprechende Menge hochintelligenter Ameisen - keine adäquate Lösung.
Zu 2. Und was glauben Sie, was die Unternehmensanteile noch wert sind, wenn sie in so großen Mengen auf den Markt geworfen werden? Und was alles an diesen Unternehmenswerten hängt?
zu 3. Die müsste auch irgendwie bezahlt werden - im Zweifel aus einem anderen Pott im Bereich "Personalkosten". Der Pott "Unternehmergewinn" ist nämlich selbst bei den profitablesten Unternehmen zu klein und volatil für für wirklich große Änderungen.
zu 4. Es kommt darauf an, welchen Mehrwert jemand bietet, und da ist der Hebel halt bei Entscheidern größer als die blanke Arbeitskraft hergibt: Wenn jemand in der Lage ist, Entscheidungen so zu treffen, dass im Vergleich zu anderer Leute Entscheidungen am Ende x Millionen mehr in die Kasse kommen, dann ist der auch einen erheblichen Teil dieser x Millionen mehr wert. Gibt man ihm die nicht, findet sich jemand anderes, der auch gerne Millionen mehr einnehmen will und es daher tut.
Ein so stark gefragter Entscheider zu sein, ist eine Einzelleistung vergleichbar z. B.der, zu den besten rechten Außenverteidigern im Fußball zu gehören. Die treffen auch nicht jeden Ball, aber mehr als (fast) alle Anderen, und das macht sie zu begehrten und entsprechend hoch entlohnten Arbeitnehmern.
Elvenpath
@Tom Farmer Nein, genau darum geht es doch hier in dem Artikel. Es geht darum, dass das Vererben von großen Vermögen schädlich für die Gesellschaft ist.
Obscuritas
@Tom Farmer " da die Leute die aus derlei Gründen sehr reich sind meist auch ohne diese Erbschaft wirtschaftlich erfolgreich wären"
Das ist doch das beste Argument für eine ordentliche Erbschaftssteuer.
Natürlich wären die Sprösslinge aus gutem Hause immer noch % gesehen im späteren Leben oft erfolgreicher. Aber eben nur gut situiert oder reich aber nicht unermesslich reich, wie jetzt. Und wenn doch dann eben aus eigener Kraft.
Nehmen Sie Mal Donald Trump als gutes Beispiel. Hätte sein Vater, ihm nicht den Arsch voll Kohle geblasen und immer wieder, xmillionen gegeben, wäre er niemals erfolgreich geworden. Er hat so viel Geld bekommen, dass es auf der Börse angelegt mehr Gewinn gemacht hätte, als er letztlich daraus gemacht hat.
Eliteuniversität hin oder her.
nanymouso
@Tom Farmer Erbschaften wurden ja aber auch mal von jemandem erworben. Jedes wesentliche Besitztum kam irgendwann einmal durch Mord oder Raub zustande. Darauf aufbauend wurde Besitztum nachträglich verschenkt oder vererbt. Das hier nur mal als historischen Kontext. Jetzt kann man behaupten, dass das in jüngerer Geschichte nicht stimmt und die Neureichen ihren Besitz ja ganz legal erworben haben. Nur wurde diese Form des kapitalistischen Besitzerwerbs ja auch durch die gleichen Nutznießer erst in Gesetzesform gegossen.
Die Frage, die sich für heute stellt, ist: In was für einer Welt wollen wir leben? Warum will ich in einer Welt leben, in der Menschen um ihr (soziales) Überleben fürchten und kämpfen müssen, wenn mir alle Statistiken und Zahlen zeigen, dass das unnötig ist. Und wenn es nicht notwendig ist, warum dann nicht die Gesetze ändern und den Reichtum umverteilen?
Wenn jetzt Neidgefühle auf die Reichen ins Spiel kommen, kommen gleichzeitig auch Geizgefühle der Reichen ins Spiel, die aus einem völlig beliebigen Grund annehmen, dass sie ein Anrecht auf ihren Reichtum und ihr Erbe haben.
Tom Farmer
@nanymouso Ich weiß was Sie meinen, ich würde so aber keinesfalls argumentieren, da das global gesehen komplett nach hinten losgeht. Jeder in diesem Land gehört ganz automatisch zu den Privilegierten weltweit. Also sind wir in Ihrem Sinne alle Verbrecher, die auf Kosten der Armen der Welt leben. Wenn Sie das also ernst meinen, ist Umverteilung eben auch bei den "deutschen" Armen angesagt, da auch die mesit besser leben als die unteren 50% dieser Welt. Andererseits haben Sie komplett recht! Wenn ich so argumentiere (im Bekanntenkreis) kommt das von Ihnen benannte Geizgefühl der "Pseudo-Reichen"... abgeben, Geld(?), nach Sudan (usw.) "ich kann doch nicht alle retten". Selbst EU-weit oft nicht solidarisch möglich (Stichwort "Griechenrettung") Ist auf dieser EU- oder einer nationalen Ebene also kein bisschen anders... außer dass Sie der Meinung sind, dass das hier national angebracht wäre. Warum eigentlich genau hier zu diesem Thema in DE?
Jäger Meister
@Tom Farmer Der Beitrag ist hinten und vorne nicht durchdacht:
1. Es gibt kaum einen Staat, in dem es den Menschen im Durchschnitt besser geht als DE. Die sozialistischen Staaten haben diesen Wohlstand jedenfalls nicht schaffen können. Die von der Autorin geforderte Umverteilung führt also nicht zum gewünschten Ergebnis, da sie dazu führt, dass es sehr schnell nichts mehr umzuverteilen gibt.
2. Das eine Prozent der Superreichen sind in der Regel Unternehmer. Im Erbenfall will keiner, dass das Unternehmen geschlossen werden muß, um Erbschaftssteuern zu zahlen. Der Versuch der Schröder-Regierung (Steuererlass bei Arbeitsplatzerhaltung) ist ja in der Pandemie gnadenlos baden gegangen und treibt manche Unternehmen in die Insolvenz.
3. Den privaten Vermögensaufbau durch betriebliche Altersversorung hat die SPD schon direkt abgestraft, da auf Betriebsrenten volle (also ca. 14%) GKV Beiträge zu entrichten sind. Gerade das wäre aber eine für Kleinverdiener einfache Möglichkeit des Vermögensaufbaus!
4. In Griechenland ist das Medianvermögen (also 50% der Bevölkerung haben mehr) doppelt so hoch wie in DE. In Italien auch deutlich höher! Da hält sich meine Solidarität in Grenzen. Die zeigen es nur nicht so, wie der Schwanzvergleich-Deutsche.
4. Viele in DE - ich sehe das in meinem Umfeld - wollen nur das Leben geniessen. Sie wollen sich keine Gedanken um Vermögensaufbau machen, kaufen sich lieber einen 3er und wollen ausschließlich machen, was der Chef sagt. Chef-sein, Verantwortung übernehmen und Eigeninitiative zeigen, auch mal in Vorleistung gehen, Fehlanzeige!
Diejenigen die das tun, das sind dann plötzlich die bösen Bonzen...
Max Weber
@Jäger Meister Diese Antwort ist allerdings auch nicth viel besser.
1. Aber es gibt Staaten, da läuft es besser. Und der Reichtum Deutschlands ruht zu einem großen Teil auf der Ausbeutung des weniger Reichen Südens der Welt. Zudem ist ihr Argument, das nur weil in einer beinahe autokratischen Diktatur, die sich mit dem Label Sozialismus getarnt hat, die Umverteilung nicht von wirtschaftlichem Erfolg gekrönt war, nur insofern richtig, dass es so war. Sie lässt jedoch völlig außer acht, dass dies ist, wie sich darüber zu wundern, dass ein 10 km-Läufer gewinnt, wenn man ihm gegenüber seinem Kontrahenten 9k Vorsprung lässt. Denn auf der einen Seite wurden der Wirtschaft mithilfe des Marshall-Planes Milliarden in den A. geblasen, während auf der anderen Seite zum Ausgleich der Politik der verbrannten Erde ganze Industrien abgebaut und als Reparationen verschifft wurde. Daher vergleichen sie unabhängig von den ersten Sätzen hier Äpfel mit Flugzeugträger .
zum 2. Die wenigsten Unternehmen würden geschlossen werden, denn nicht die Unternehmen werden besteuert, sondern deren Besitzer. Und diese können ja gern Anteile im Umfang der Erbschaftssteuer an ihre Belegschaft oder interessierte Investoren verkaufen oder einen entsprechenden Kredit aufnehmen. Das hat also mit dem Unternehmen gar nichts zu tun.
zu 3. der Anteil betrieblicher Altersversorgung in Deutschland ist verschwindend gering, auch soch vor der SPD.
zu 4. Genau darum geht es doch aber, da der Median zeigt, dass es in Deutschland also bedeutend ungleicher zugeht. Und der MEdian an sich sagt noch nichts über die Höhe der tatsächlichen Vermögen aus, daher kann daraus auch keine Aussage zu etwaiger Solidaität abgeleitet werden.
zu4. die zweite...Genau, nicht jeder will Chef sein und Verantwortung tragen. Das ist ja auch okay, und rechtfertigt auch höheres Einkommen. Allerdings in Maßen. Bei den Einkommen der Vorstände in D. müssten diese 60h am Tag arbeiten, 9 Universitätsabschlüsse haben und 8 Hände haben, um diese zu "verdienen".
Max Weber
@Jäger Meister Diese Antwort ist allerdings auch nicth viel besser.
1. Aber es gibt Staaten, da läuft es besser. Und der Reichtum Deutschlands ruht zu einem großen Teil auf der Ausbeutung des weniger Reichen Südens der Welt. Zudem ist ihr Argument, das nur weil in einer beinahe autokratischen Diktatur, die sich mit dem Label Sozialismus getarnt hat, die Umverteilung nicht von wirtschaftlichem Erfolg gekrönt war, nur insofern richtig, dass es so war. Sie lässt jedoch völlig außer acht, dass dies ist, wie sich darüber zu wundern, dass ein 10 km-Läufer gewinnt, wenn man ihm gegenüber seinem Kontrahenten 9k Vorsprung lässt. Denn auf der einen Seite wurden der Wirtschaft mithilfe des Marshall-Planes Milliarden in den A. geblasen, während auf der anderen Seite zum Ausgleich der Politik der verbrannten Erde ganze Industrien abgebaut und als Reparationen verschifft wurde. Daher vergleichen sie unabhängig von den ersten Sätzen hier Äpfel mit Flugzeugträger .
zum 2. Die wenigsten Unternehmen würden geschlossen werden, denn nicht die Unternehmen werden besteuert, sondern deren Besitzer. Und diese können ja gern Anteile im Umfang der Erbschaftssteuer an ihre Belegschaft oder interessierte Investoren verkaufen oder einen entsprechenden Kredit aufnehmen. Das hat also mit dem Unternehmen gar nichts zu tun.
zu 3. der Anteil betrieblicher Altersversorgung in Deutschland ist verschwindend gering, auch soch vor der SPD.
zu 4. Genau darum geht es doch aber, da der Median zeigt, dass es in Deutschland also bedeutend ungleicher zugeht. Und der MEdian an sich sagt noch nichts über die Höhe der tatsächlichen Vermögen aus, daher kann daraus auch keine Aussage zu etwaiger Solidaität abgeleitet werden.
zu4. die zweite...Genau, nicht jeder will Chef sein und Verantwortung tragen. Das ist ja auch okay, und rechtfertigt auch höheres Einkommen. Allerdings in Maßen. Bei den Einkommen der Vorstände in D. müssten diese 60h am Tag arbeiten, 9 Universitätsabschlüsse haben und 8 Hände haben, um diese zu "verdienen".
Max Weber
@Jäger Meister Diese Antwort ist allerdings auch nicth viel besser.
1. Aber es gibt Staaten, da läuft es besser. Und der Reichtum Deutschlands ruht zu einem großen Teil auf der Ausbeutung des weniger Reichen Südens der Welt. Zudem ist ihr Argument, das nur weil in einer beinahe autokratischen Diktatur, die sich mit dem Label Sozialismus getarnt hat, die Umverteilung nicht von wirtschaftlichem Erfolg gekrönt war, nur insofern richtig, dass es so war. Sie lässt jedoch völlig außer acht, dass dies ist, wie sich darüber zu wundern, dass ein 10 km-Läufer gewinnt, wenn man ihm gegenüber seinem Kontrahenten 9k Vorsprung lässt. Denn auf der einen Seite wurden der Wirtschaft mithilfe des Marshall-Planes Milliarden in den A. geblasen, während auf der anderen Seite zum Ausgleich der Politik der verbrannten Erde ganze Industrien abgebaut und als Reparationen verschifft wurde. Daher vergleichen sie unabhängig von den ersten Sätzen hier Äpfel mit Flugzeugträger .
zum 2. Die wenigsten Unternehmen würden geschlossen werden, denn nicht die Unternehmen werden besteuert, sondern deren Besitzer. Und diese können ja gern Anteile im Umfang der Erbschaftssteuer an ihre Belegschaft oder interessierte Investoren verkaufen oder einen entsprechenden Kredit aufnehmen. Das hat also mit dem Unternehmen gar nichts zu tun.
zu 3. der Anteil betrieblicher Altersversorgung in Deutschland ist verschwindend gering, auch soch vor der SPD.
zu 4. Genau darum geht es doch aber, da der Median zeigt, dass es in Deutschland also bedeutend ungleicher zugeht. Und der MEdian an sich sagt noch nichts über die Höhe der tatsächlichen Vermögen aus, daher kann daraus auch keine Aussage zu etwaiger Solidaität abgeleitet werden.
zu4. die zweite...Genau, nicht jeder will Chef sein und Verantwortung tragen. Das ist ja auch okay, und rechtfertigt auch höheres Einkommen. Allerdings in Maßen. Bei den Einkommen der Vorstände in D. müssten diese 60h am Tag arbeiten, 9 Universitätsabschlüsse haben und 8 Hände haben, um diese zu "verdienen".
Elvenpath
@Jäger Meister 1. Der Durchschnitt sagt gar nichts aus. Es geht hier doch genau um die Verteilung des Vermögens. Und die ist nicht gut.
2. Die meisten Superreichen haben ihr Vermögen nicht selbst geschaffen.
Wenn es um Unternehmen geht, gibt es auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Umwandlung in eine Genossenschaft.
3. Auch da haben Sie etwas nicht verstanden. Es gibt sehr viele Menschen, die kein Geld für einen Vermögensaufbau haben.
4. Vielleicht sollten Sie sich auch mal andere Umfelder ansehen. Geringverdiener zum Beispiel. Die froh sein können, sich einen gebrauchten Kleinwagen leisten zu können.
Ich denke, Sie sind ziemlich abgehoben.
Kaboom
@Tom Farmer Reiche, die wegen ihrer Erbschaft reich sind, wären also ohne die Erbschaft auch reich. Ich versuch mal, ihr Alter zu raten, ja? Unter 12 oder über 80?
warum_denkt_keiner_nach?
@Tom Farmer "...Bildung und Zugang zu Bildung durch Geld. Geld kommt per Steuer..."
Z.B. durch Erbschaftssteuer :-)
Man muss das Geld dort nehmen, wo es ist.
Gerhard Krause
@warum_denkt_keiner_nach? Richtig. Das ist auch keine Neiddebatte, sondern der quasi ständige "Geldumlauf" (das Gegenbild ist: ein Förderband schaufelt die ganze existierende "Knete" beständig nur auf des Nachbarn Haufen, bis alles auf diesem Haufen angekommen ist) in unserem Wirtschafts- und (darauf basierenden) Gesellschaftssystem ist zwingend erforderlich. Ansonsten ginge nur eines: steter Input (Verschuldung=Geld=Verschuldung). Und damit wäre dann auch schon das dumme Gefasel von sowas wie der FDP oder Aldi-Bereichsleiter entlarvt.
97760 (Profil gelöscht)
Gast
Die " klassenspezifische Lebenserwartung" könnte zunächst mal optimiert werden, indem der Werbung für Konsumentenkredite immer ein Popupfenster mitgeliefert wird, wo etwa kommuniziert wird, "Konsumentenkredite machen Dich fertig" oder "Konsumentenkredite verkürzen Deinen Lebensabend". Allerdings hindert diese Aufklärung nicht, daß auch der ein oder andere Milliardär die Abkürzung nimmt.
Pfennig
Einige Aspekte:
1. Dtld. ist ein Hochsteuerland, hohe Steuern und Abgaben behindern Vermögensbildung. Die Medianvermögen in "ärmeren" Ländern, z.B. Griechenland, Spanien, Italien sind höher als in Dtld.
2. Sparen und Vermögen bilden ist eine individuelle Entscheidung. Viele geben ihr Geld lieber für die vielfältigen Konsummöglichkeiten aus.
3. Ein kleines Vermögen aufzubauen lohnt sich für viele nicht. Man setzt auf die staatliche Rundumversorgung. Und wenn man mal in eine Notlage gerät und auf staatl. Hilfe angewiesen ist, muß erstmal das eigene Vermögen aufgebraucht werden.
4. Oft wird falsch gespart, so gelingt kein Vermögensaufbau. Geldguthaben wird durch Inflation schleichend entwertet und man bekommt keine Zinsen mehr. Dafür ist die Politik mitverantwortlich, wie sollen die Staaten sich sonst auch so hoch verschulden können, wie sollen sonst die ganzen innereuropäischen Hilfsmaßnahmen und Umverteilungen finanziert werden.
5. Vermögensbildung in Sachwerten, wie Aktien (= Unternehmensbeteiligungen) werden staatlicherseits eher behindert und steuerlich benachteiligt. Früher gab es das Halbeinkünfteverfahren für Dividenden (da Gewinne auch schon auf Firmenebene versteuert werden) und Steuerfreiheit auf Wertsteigerung bei langfristiger Haltedauer der Aktie. Heute unterliegen Gewinne aus spekulativen Finanzprodukten, Aktiengewinne, Dividenden, Zinseinkünfte (die es kaum mehr gibt) alle dem gleichen Steuersatz.
6. Offensichtlich wollen viele Politiker den Normalbürger vom Aktiensparen (und damit einer aussichtsreichen Vermögensbildung) fernhalten, weil dann der Gegensatz Arbeitnehmer - Kapitalist zu verschwinden droht, den viele Parteien und die Gewerkschaften brauchen um Stimmen und Mitglieder zu gewinnen. Wer an Wertsteigerung und Ausschüttungen von Unternehmen partizipiert, könnte ja Verständnis für die Unternehmerseite entwickeln und einen ganz anderen Blick auf Wirtschaft bekommen. Wer Vermögen hat, ist nicht mehr von jeder staatl. Wohltat abhängig.
Elvenpath
@Pfennig 1. Es gibt sehr viele Menschen, die gerade genug Geld haben, um über die Runden zu kommen. Geld für Vermögensaufbau ist nicht vorhanden.
2. Es gibt sehr viele Menschen, die gerade genug Geld haben, um über die Runden zu kommen. Geld für Vermögensaufbau ist nicht vorhanden.
3. Es gibt sehr viele Menschen, die gerade genug Geld haben, um über die Runden zu kommen. Geld für Vermögensaufbau ist nicht vorhanden.
4. Es gibt sehr viele Menschen, die gerade genug Geld haben, um über die Runden zu kommen. Geld für Vermögensaufbau ist nicht vorhanden.
5. Es gibt sehr viele Menschen, die gerade genug Geld haben, um über die Runden zu kommen. Geld für Vermögensaufbau ist nicht vorhanden.
6. Es gibt sehr viele Menschen, die gerade genug Geld haben, um über die Runden zu kommen. Geld für Vermögensaufbau ist nicht vorhanden.
Gerhard Krause
@Pfennig Selten so gelacht. Das muss ich als Ökonom nicht einmal Punkt für Punkt gegenbeweisen, wenn ich Ihre Gliederung zugrunde lege. Es reicht bereits ein Beitrag der geschätzten Ulrike Herrmann, taz, oder Koll. Bontrup aus.
warum_denkt_keiner_nach?
@Pfennig "Sparen und Vermögen bilden ist eine individuelle Entscheidung. Viele geben ihr Geld lieber für die vielfältigen Konsummöglichkeiten aus."
Eben nicht nur. Man muss auch genug verdienen, um am Ende des Monats etwas zum Sparen übrig zu haben.
Der Rest? Alte FDP Thesen fern der Realität eines großen Teils der Bevölkerung.
Kaboom
@Pfennig Und jetzt mal zurück in die reale Welt:
1 Das monetär untere Drittel zahlt keine oder so gut wie keine Steuern.
2 Sparen hängt nicht an der "individuellen Entscheidung", sondern am Delta zwischen Einnahmen und Ausgaben.
3 Es gibt keine "staatliche Rundumversorgung"
4, 5 und 6 sind angesichts 2 gegenstandslos.
Pfennig
@Kaboom Im Artikel oben geht es um die Hälfte der Bevölkerung. Auch in dieser Hälfte werden gerne größere Autos gefahren, als es der reine Zweck erfordert, es werden Urlaubsreisen unternommen und nicht nur einmal im Jahr in die nähere Umgebung, etc. Auch da gönnt man sich etwas. Das ist nicht verwerflich, aber es ist die freie Entscheidung, auf Vermögensbildung zugunsten von Konsum zu verzichten.
Grundlegende Risiken sind staatlich abgesichert (wenn auch nicht großzügig, komfortabel), dafür ist kein Vermögen erforderlich.
Ich behaupte nicht, daß jeder Vermögen bilden kann, sondern daß es viele Gründe gibt für Leute, die dazu in der Lage wären, aber es trotzdem nicht tun. Man kann die Leute nicht zwingen, jeder entscheidet nach seinen Präferenzen.
Normalo
@Kaboom 1. Dass das untere Drittel kein Vermögen hat, ist - brutal gesagt - nicht der besondere deutsche Missstand, den Frau van Dyk moniert. Das ist anderswo auch nicht viel anders. Es geht um die zwei Dekaden darüber, denen es "eigentlich" vermögensmäßig besser gehen müsste. Und die zahlen sehr wohl Steuern, gehören sogar teilweise schon zum "Mittelstandsbauch".
2. Das Delta zwischen Einnahmen und Ausgaben hängt massiv davon ab, welche Ausgaben getätigt werden. Und die sind für die allermeisten Menschen nicht alternativlos.
3. Verglichen mit den meisten anderen Ländern ist unser soziales Netz ziemlich eng und teuer. Ob seine Leistungen auch billiger darzustellen wären bleibt das sahnige Geheimnis der staatlichen Monopolisten, die es kontrollieren, aber es kommt genug bei den Leistungsempfängern an, dass niemand den "totalen" Absturz befürchten muss.
Gerhard Krause
@Normalo Angesichts dessen, dass in den einschlägigen dt. Statistiken Billionen von Euro von Vermögenden fehlen, kann man getrost jeden Satz einer gegen die Ausführungen des vorliegenden Artikels gerichteten Rede in die Tonne drücken. Herzliche Grüße
Normalo
@Gerhard Krause Kann man genauso gut umgekehrt formulieren: Wer meint er hätte das Recht, Anderen in ihre Rechte einzugreifen und an ihr Vermögen zu langen, sollte erstmal wissen, von was für einem Vermögen er redet. In unserem Land ist nicht der in der Erklärungsschuld, der etwas hat, sondern der, der es ihm wegnehmen will.
Gerhard Krause
@Normalo Sie sind ja nicht einmal juristisch vollständig richtig. Es wird u.a. vernachlässigt, wie das Vermögen zustande gekommen ist. Da bin nicht "ich" in der Erklärungspflicht.
Normalo
@Gerhard Krause "Es wird u.a. vernachlässigt, wie das Vermögen zustande gekommen ist."
In der Regel über eienn Austausch von Leistungen. Wo ist da das Problem?
In der Erklärungspfilcht ist - wie ich schon geschrieben habe - wer auch immer bestrbt ist, ein von der Verfassung geschütztes Recht einzuschränken. "Gleiche Teilhabe am Volksvermögen" ist NICHT von der Verfassung geschützt, falls das Ihre Stoßrichtung sein sollte, und auch die Sozialbindung des Eigentums hat klar definierte Grenzen.
Kaboom
@Normalo Frau van Dyk spricht über die "untere Hälfte", und nicht über "zwei Dekaden drüber". Mittelstand wiederum ist der Teil der Unternehmer, der Unternehmen zwischen 5 und 500 MA führt, und
adagiobarber
ich sag' nur ...
bildung ist chance und schlüssel.
zu beginn haben alle das gleiche lesebuch und lernen das einmaleins.
Elvenpath
@adagiobarber Aber das ändert sich nach 4 Jahren.
Ein viel größerer Anteil an Schülern, mit Eltern aus der mittleren und insbesondere der gehobenen Schicht kommt ins Gymnasium, als bei den Kinder von Eltern aus unteren Schichten.
Die Kinder von Eltern mit viel Geld sind also schon massiv im Vorteil. Und dann erben sie irgendwann auch noch ein Vermögen. Ungerechter geht es nicht.
Schnetzelschwester
@adagiobarber Schon mal was vom akademischen Proletariat gehört? Vom Physiker als Taxifahrer?
Wenn alle Abitur machen und studieren, fallen die gut bezahlten Akademikerjobs auch nicht massenhaft vom Himmel. Und wenn es viele arbeitslose Akademiker gibt, sinken auch dort die Gehälter.
Da kannste jetzt schon erst mal 10 Jahre unbezahlte (oder unterhalb vom Mindestlohn bezahlte) Praktika machen, die nächsten 10 Jahre von einem Halbjahresvertrag zum nächsten hangeln, und dann 10 Jahre als Leihsklave zum halben Gehalt wie die Stammbelegschaft schaffen. Kurz vor der Rente wirste dann aussortiert und darfst nach einem Jahr Hartz4 beantragen. Dafür wird dein GESAMTES Vermögen angerechnet, bis auf ein paar lausige Kröten.
Ich bin selber Akademikerin. Das Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist sch***. Mit einer Berufsausbildung wäre ich besser gefahren.
nanymouso
@adagiobarber Niemand auf dieser Welt hat jemals etwas allein gelernt. Alle Menschen hatten Lehrer und Förderer.
Ihr Kommentar ist zynisch (wenn vllt. auch nicht so beabsichtigt), denn er unterschlägt, dass nicht das Buch den Unterschied im Bildungserfolg ausmacht, sondern die Lehrer, Förder und die Lernumgebung.
Schüler von heute sind darauf angewiesen, dass die Eltern sie fördern und dass zu Hause eine Umgebung herrscht, die Lernen gutheißt und den (zeitlichen) Raum dafür schafft.
Hier fehlt es Armen messbar an allen diesen Dingen. Skandinavien macht uns seit Jahrzehnten vor, wie Bildungschancen vom Elternhaus entkoppelt werden können, allein, wir ignorieren das hier.
Rudolf Fissner
"Ich finde spannend, was der französische Ökonom Thomas Piketty vorgeschlagen hat, um einen konkreten Vorschlag zu nennen: Zum 18. Geburtstag wird jedem Menschen die Hälfte des Durchschnittsvermögens ausbezahlt, finanziert durch eine Eigentumssteuer."
Das Durchschnittliche Vermögen pro Kopf/Welt liegt im Median bei 7.500 $. Ich finde das eine tolle Idee. Für die westlich verwöhnten snd die 7.500 $ nicht der riesige Bringer. Für die armen Länder der Welt wäre es aber ein riesiger Geldtransfer in der Summe.
Frederik Nyborg
@Rudolf Fissner Super, endlich können Sie sich für Umverteilung begeistern! Ich hoffe, Sie lassen Ihren Worten und Ihrer Begeisterung über diese tolle Idee auch endlich mal Taten folgen!!!
Rudolf Fissner
@Frederik Nyborg Super endlich haben Sie erkannt, wohin umverteilt werden muss. Nur verstehe ich ihre Aggressivität dabei nicht. Ich halte die deutsche Linke schlicht nur für national beschränkt in dem Sinne das der größte Teil der Menschheit bei solchen Vorschlägen i.d.R. leer ausgeht.
Rudolf Fissner
@Rudolf Fissner Noch spannender würden die Geldtransfers ausschauen, wenn man nicht den Median sondern den Durchschnittswert des Vermögens nimmt, wo die großen Vermögen verstärkt einfließen. Da liegt der Transfer pro Person in die ärmeren Länder bei fast 80.000 $
Ich vermute aber, dass die Menschen auf dem Oberdeck "Deutschland" den Abfluss immenser Beträge never wollen.
Er wird nicht einmal von janz linken Parteien gefordert.
Es ging schon immer nur darum den Braten hier unter sich zu zerlegen.
Frederik Nyborg
@Rudolf Fissner Sie scheinen das nicht zu wollen, da Sie keine Partei wählen, die dies will. Denn die CDU und Grünen wollen das ganz bestimmt nicht. Die CDU will den Braten bei den Reichen belassen und die Grünen im Endeffekt dann in der Koalition mit der CDU ebenso!
Sie nutzen das Argument doch auch nur um die Reichen zu schützen, damit die nichts abgeben müssen. Schade, konstruktiv ist das nicht.
Rudolf Fissner
"Auch die Coronapandemie hat gezeigt, dass das Risiko, schwer zu erkranken und zu sterben, hochgradig mit Einkommen und Klassenlage zusammenhängt."
Dummrs Zeug.
Die Wahrscheinlichkeit an Corona zu sterben oder schwer zu erkranken korreliert stark mit dem Alter, vorhandenen Krankheiten und dem vorhandenen Gesundheitssystem (DE ziemlich gut)
Wer sich mit Corona ansteckt ist auch bekannt. Menschen mit vielen Außenkontakten, sei es aufgrund des Berufs (Busfahrer), Ausbildung (Schüler), Familienstatus (Singles weniger). Freizeitverhaltens und natürlich der eigenen Blödheit (Coronaleugner).
Die "Klassenlage" ist wie der Storch sicher kein Grund, weshalb und wie stark man sich an Corona ansteckt, nicht behandelt wird oder stirbt.
Kaboom
@Rudolf Fissner Sagen Sie: Muss neuerdings der Besitzer eines Eigenheims auch einen Fahrstuhl nehmen, den hunderte andere auch benutzen, um in seine Wohnung zu gelangen (ein Beispiel unter hunderten)? Oder zeugt Ihr Beitrag einfach davon, dass Sie in einem Wolkenkukucksheim leben?
Rudolf Fissner
@Kaboom Geben Sie doch bitte die Quelle an, die aufzeigt, dass die Verbreitung, Erkrankung und das Sterben an Corona "hochgradig" mit der Verbreitung von Fahrstühlen zusammenhängt. 🤔...🤣
Frederik Nyborg
@Rudolf Fissner Kein dummes Zeug, bitte weniger Ignoranz und endlich mal zur Kenntnis nehmen:
www.deutschlandfun...:article_id=496556
Rudolf Fissner
@Frederik Nyborg Sie unterstellen Ulrich Schneider gerade das er sich gerade mit seinen Ansichten vor den vielen Menschen, den vielen alten Menschen, die in den Risikogruppen gestorben sind, vorbei mogelt um "hochgradig" (lesen Sie den Artikel) auf Platz 1. der Betroffenheitsliste zu landen. Das ist eine Frechheit Herr Schneider gegenüber.
Normalo
Wenn Frau van Dyk Deutschland eine 8/10 in Sachen sozialer Ungerechtigkeit gibt, dann wüsste ich schon gerne mal, wo sie den Rest der Welt einordnet (oder die Welt insgesamt, in der unser Land bis zum letzten Hartzer noch zu den immer reicher werdenden "Reichen" gehört)...
Davon abgesehen ist die alte Leier von der Vermögensschere viel zu grobschnittig. Ob jemand Vermögen hat oder nicht, hängt massiv damit zusammen, was er mit seinem Einkommen anstellt. Wer fleißig konsumiert (Kinder großzieht, partout da mietet, wo es schick und angesagt ist, gut und teuer einkauft, schön Urlaub macht, lieber in Unterhaltungselektronik statt in Aktien investiert etc.), kann einkommensmäßig zu den "Reichen" gehören, vermögensmäßig aber die Gruppe der armen unterdrückten Habenichtse aufblähen (u. a. weil die millionenschweren Versorgungsanwartschaften nicht zum "Vermögen" zählen) - und dabei natürlich ganz schön fröhlich leben. Anderswo kauft man eben erstmal ein Haus, bevor man über den zweiten oder dritten Fernurlaub pro Jahr nachdenkt oder sich schon wieder ein neues xy-Phone leistet...
Kaboom
@Normalo Solche Beiträge, die jegliche wissenschaftliche Erkenntnis der letzten 50 Jahre bezüglich sozialer Durchlässigkeit, Reallohn-Entwicklung, Entwicklung der Mietpreise, und diversen dutzend anderen Forschungsdisziplinen durch Spiessbürgerlogik ersetzen, sind immer wieder der Höhepunkt eines Tages.
Normalo
@Kaboom Danke für die Blumen.
Normalo
@Kaboom Ich empfinde Beiträge, die zwar haushohe argumentatorische Überlegenheit behaupten, sie aber inhaltlich nicht liefern, dagegen eher als Zeitverschwendung.
warum_denkt_keiner_nach?
@Normalo "...wo sie den Rest der Welt einordnet..."
Das ist völlig Wurst. Wir leben hier. Und wir wählen demnächst. Auch hier.
Normalo
@warum_denkt_keiner_nach? Es ging mir um die Einordnung der harten Bewertung Deutschalnds auf der "politischen Motiviertheitsskala" - und den kleinen Seitenhieb an unsere heimischen Umverteiler, dass ihr Ruf nach Solidarität tatsächlich diesen stark domestischen Fokus, hat, den auch Ihre Antwort sanft durchscheinen lässt.
Warum sollte ein Reicher irgendwas von seinem Vermögen an Leute abgeben wollen, die sich gegenüber dem Rest der Welt kein Stück besser verhalten, als man es ihm vorwirft - und daraus auch noch eine Anspruchshaltung drechseln?
warum_denkt_keiner_nach?
@Normalo Egal wie man das weltweit einordnet. Es bleibt dabei, dass es in D sehr ungleich zugeht. Wenn das anderswo auch so ist, müssen das die Menschen dort, gern mit unserer Hilfe, ändern. Wir sind in erster Linie für unsere Ungleichheit zuständig.
Normalo
@warum_denkt_keiner_nach? "Egal wie man das weltweit einordnet."
Wer Ungleichheits-Punkte für sein Land verteilt, aber die Skala so wählt, dass die Vergleichbarkeit mit anderen Ländern zur Farce wird, kann sich die Punkte auch sparen. Die sind dann rein willkürlich.
"Es bleibt dabei, dass es in D sehr ungleich zugeht."
Ich dachte, es ging um Gerechtigkeit!? Ist es "gerecht", einen deutschen Pass als eine Art moralischen Anteilsschein am Vermögen reicher Deutscher zu betrachten?? Das wäre doch genauso ein entitlement, wie es den Erben immer vorgeworfen wird.
warum_denkt_keiner_nach?
@Normalo "Ist es "gerecht", einen deutschen Pass als eine Art moralischen Anteilsschein am Vermögen reicher Deutscher zu betrachten?"
Immer einen Schritt nach dem Anderen. Kümmern wir uns um Gerechtigkeit hier, können wir dann versuchen, sie auszuweiten. Sonst wird es unglaubwürdig.
Natürlich soll uns das nicht davon abhalten, schon jetzt die Ausbeutung anderer Regionen der Welt einzustellen. Aber der ständige Hinweis darauf, dass es wo anders ja viel schlimmer ist, klingt zu sehr nach Ablenkung.
Normalo
@warum_denkt_keiner_nach? Mir geht es darum, die Aufmerksamkeit auf den moralischen Unterbau dieser Forderung nach (kunstvoll abgegrenzter) Gleichheit zu lenken. Wenn das für Sie "Ablenkung" ist, kann ich dieses Kompliment gerade zurückgeben: Wer sagt "Gleichheit (also, ähh natürlich nur für Deutsche unter Deutschen)!!" will davon ablenken, dass er außer dem "Auch haben wollen"-Impetus seiner Klientel keine moralische Grundlage HAT.
warum_denkt_keiner_nach?
@Normalo Es ist einfach, etwas aktuell kaum Umsetzbares (Gerechtigkeit für die ganze Welt) zu fordern. So kann man Moral heucheln und zu Hause (geht ja eigentlich) die Hände in den Schoß legen.
Ich kehre lieber erst mal vor der eigenen Tür.
PS: "...natürlich nur für Deutsche unter Deutschen..."
Nein. Solchen AfD Quatsch mag ich nicht.
Normalo
@warum_denkt_keiner_nach? "Nein. Solchen AfD Quatsch mag ich nicht."
Hab's natürlich provokant formuliert, aber was die AfD fordert, ist nicht nur deshalb falsch, weil sie es aus der falschen Ideologie heraus fordert. Die national beschränkte Brille hat schlicht ausgedient. Sie ist weder in ökonomischer noch in sozialer oder ökologischer Hinsicht in der Lage, mit der Welt von heute fertig zu werden. Für linke Möchtegern-Reformer ist sie nur deshalb weiter das Maß aller Dinge, weil sie ihnen die Illusion der Beherrschbarkeit verschafft. Aber die bleibt eben Illusion. Deshalb liegt auch Sarah Wagenknecht schief, auch wenn sie sicher keine Rechte ist.
Ich versuche auch nicht, den status quo durch überhohe Ansprüche zu zementieren, sondern den Fokus zu verändern. Wer auch immer etwas ändern will auf der Welt, tut besser daran, seine Ansprüche an die Radikalität der Veränderung herunterzuschrauben und stattdessen in die globale Breite zu denken. Zum Einen geht es unseren heimischen Mitbürgern im Großen und Ganzen eh zu gut, um den ganz großen Schritt zu wagen, zum Anderen würde uns der nur hinter noch höhere Mauern sperren, die wir um unsere Insel der Glückseligen ziehen müssten - was schon deshalb blöd ist, weil unsere Glückseligkeit auf dem Abbau dieser Mauern beruht. Und die Atmosphäre lässt sich ohnehin nicht aussperren.
Überlegen Sie einfach, wieviel mehr absolute Veränderung ein Umverteilungs- oder auch Klimaschutz-Euro im globalen Süden kaufen kann als bei uns, und Sie sehen vielleicht, wo ich hinwill.
warum_denkt_keiner_nach?
@Normalo "Wer auch immer etwas ändern will auf der Welt, tut besser daran, seine Ansprüche an die Radikalität der Veränderung herunterzuschrauben und stattdessen in die globale Breite zu denken."
Natürlich muss man nicht nur an zu Hause denken, sondern auch global. Allerdings gibt es dabei einen großen Haken. Globale Veränderungen bedürfen globaler Absprachen. Wir können sie nicht einfach in Europa beschließen. Der größte Teil der Welt gehört uns nämlich nicht mehr. Das wird gern vergessen.
Deshalb ist es wichtig, dort etwas zu tun, wo es auch ohne große Probleme möglich ist. Hat nichts mit Nationalismus zu tun, sondern mit praktischen Möglichkeiten.
"Zum Einen geht es unseren heimischen Mitbürgern im Großen und Ganzen eh zu gut..."
Bequeme und falsche Sicht. Bequem, weil es den Wohlhabenden ermöglicht, sich weiter die Taschen vollzuschaufeln und falsch, weil es ziemlich vielen Menschen in D eben nicht "zu gut" geht.
Es gibt also auch hier viel zu tun. Wenn wir damit angefangen haben, können wir zu anderen Staaten gehen und auf unsere Erfahrungen verweisen. Zu Hause Däumchen zu drehen und auf den Rest der Welt zu zeigen, ist unglaubwürdig.
Normalo
@warum_denkt_keiner_nach? Ad 1: Die national beschränkten Ansätze mögen leichter umsetzbar erscheinen (das meinte ich mit der Illusion der Beherrtschbarkeit), aber sie sind es eben aus den genannten Gründen nicht, UND sie bringen letzlich auch nicht das gewünschte Ergebnis - weil der Rest der Welt, den man eben nicht einfach außen vorlassen kann, es kaputtmacht.
Ad 2: Natürlich ist es für MICH bequem, am status quo nichts großartig zu ändern - mir geht's trotz Vermögenslosigkeit dank meines deutlich überdurchschnitttlichen Einkommens ganz prima. Der Punkt ist, dass das bei der satten Mehrheit unserer Landsleute nicht viel anders aussieht. Und wir haben Alle noch in den Knochen, wie anders sich die Lebensverhältnisse entwickeln KÖNNEN, wenn das marktwirtschaftlich erworbene Privatteigentum zur vollständigen Disposition einer idealisierten, staatsgläubigen Gemeinwohl-Theorie gestellt wird. Das wollen nicht nur unsere "Reichen" nicht riskieren, dazu geht es auch den Nicht-Reichen zu gut. Was meinen Sie, warum die Linkspartei nicht mal ansatzweise das ganze Wählerspektrum für ihre Vorstellungen begeistern kann, dessen Interessen sie glaubt zu vertreten?
warum_denkt_keiner_nach?
@Normalo Ad 1: Wir reden hier von Dingen, die man IM Land umsetzen kann. Z.B. ein Steuersystem, dass Reiche nicht bevorzugt. Es ist eine billige Ausrede, auf den Rest der Welt zu warten. Nur wer zu Hause anfängt, kann erwarten, dass andere mitmachen.
Ad 2: Kurz zusammengefasst. Ein Spitzensteuersatz wie unter Adenauer führt direkt zum Kommunismus und zum Ruin.
Ja. So kann man seinen Geldbeutel auch verteidigen. Mit Unfug und Unterstellungen.
Normalo
@warum_denkt_keiner_nach? Ad 1: Die Frage ist doch, womit erreicht man was. Bei Vermögenssteuern wäre ich ja dabei, aber die Erlöse dürften nicht hierzulande ausgegeben werden sondern z. B. in Gegenden, wo die Leute WIRKLICH arm sind und man sie mit einer vergleichsweise günstigen Verbesserung ihrer Lage vielleicht sogar dazu bringen könnte, ein paar millionen Hektar Regenwald wieder aufzuforsten. Damit wäre sowohl sozial alsauch ökologisch dreimal mehr getan, als das Geld hierzulande in weiteren, aus asiatischen Sweatshops und afrikanischen oder südamerikanischen Minen und Plantagen stammenenden Konsum unserer ach so unterprivilegierten Mitbürger zu pumpen (Sie glauben hoffentlich nicht im Ernst, dass ein Mehr an Steuereerhebung von "Reichen" tatsächlich zu Vermögensaufbau weiter unten führt, oder?). Das könnten wir als Nation ganz locker einfach machen - ohne globalen Konsens oder sonstige Alibi-Superhürden. Aber so einen Akt des Klientelverrats bringen natürlich unsere Linken nicht übers tapfere Klassenkämpferherz...
Ad 2: Grundsätzlich birgt die Denke, dass es ein "Volksvermögen" gibt, an dem alle Büger einen Teilhaberecht haben, als Rechtfertigung für Vermögenssteuern schon gewisse komunistische Elemente. Aber das mit dem "Es geht uns zu gut." war auf den großen, systemischen Schritt bezogen. Die Globalisierung ist seit Adenauer ein Stück weiter, und mit ihr auch der Wettbewerb der Nationen um die besten Steuerzahler. Insoweit würde es wahrscheinlich nicht reichen, die Steuern auf Adenauer-Niveau zurückzubringen. Die würden nur sehr wenige auch tatsächlich zahlen, und die Superreichen schonmal gar nicht. Dafür müsseten schon härtere Maßnahmen her, wie z. B. Wagenknecht sie sich vorstellt, und für DIE geht es den meisten Menschen zu gut.
Eine Erwiderung auf die Frage nach dem mysteriös schlechten Abschneiden der Linkspartei bei der eigenen Klientel erwarte ich dann mal nicht... ;-)
Rudolf Fissner
@warum_denkt_keiner_nach? "Wir reden hier ...".
Wer ist dieses "Wir", das die Debatte um die Vereilung von Reichtum so gerne national betrachtet wissen will?
Und die Debatte mit dem "Rest der Welt" geht nicht um das Warten auf selbige sondern sie nicht weiter warten lassen (auf die Euronen, die man in DE so gerne auf dem Oberdeck behalten möchte)
Yossarian
@Normalo Nein. 4/5 des Vermögens der Oberschicht stammen laut Schätzung aus Erbschaften. Schätzung deshalb, weil wegen fehlender Erbschafts- und Vermögenssteuer seit Jahrzehnten keine Daten aus dieser Schicht mehr erfasst werden.
Wiki: Misst man nach Gini, liegt die BRD auf dem 110. Platz, zusammen mit Saudi-Arabien und Haiti. Zieht man das Verhältnis von Durchschnitts- zu mittlerem Pro-Kopfvermögen als Maß für die Ungleichverteilung heran, ergibt sich, dass Deutschland unter weltweit 171 erfassten Ländern den 164ten Platz belegt.
Normalo
@Yossarian "4/5 des Vermögens der Oberschicht stammen laut Schätzung aus Erbschaften."
Und die Erbmassen sind vorher vom Himmel gefallen, oder was? Nein, die sind die Summe dessen, was die Vorgenerationen erwirtschaftet und auf die hohe Kante gelegt/ dauerinvestiert haben. Erben bedeutet nichts anderes, als dass ein oder mehrere Erblasser durch eigene Zurückhaltung im Konsum dafür gesorgt haben, dass am Ende ihres Lebens noch etwas vom eingenommenen Geld übrig ist. Es ist dasselbe in Langfristig.
Davon abgesehen würde mich interessieren, wo aus Ihrer Sicht "Oberschicht" anfängt, und wieviel von dem Vermögen der oberen 50% Sie dort verorten. Ich befürchte nämlich dass diese Pfünde im Vergleich zum übrigen "Volksvermögen" deutlich kleiner sind, als Sie denken.
Elvenpath
@Normalo Für die Erben sind sie sehr wohl vom Himmel gefallen. Sie mussten nichts dafür tun.
Sie hatten lediglich das Glück, an der richtigen Stelle geboren worden zu sein.
Normalo
@Elvenpath Nur auf die glücklichen Erben zu schauen, ist zu eng. Bei der Frage wie Vermögen entsteht und/oder erhalten wird, geht es weniger um deren Perspektive als um die der Erblasser. Die können nämlich vor ihrem Ableben frei entscheiden, ob sie ihre potenziell vermögendsbildenden Einkünfte für die folgende Generation wahren oder ob sie schauen, dass sie zu Lebzeiten höchstselbst den maximalen Genuss daraus ziehen - also Alles wegkonsumieren. Entscheiden sie sich für den Konsum, gibt's auch nichts zu erben.
Yossarian
@Normalo Mir völlig egal, wer da was woher bekommen hat. Und mich interessiert auch nicht, wer wie viel hat und deshalb irgendwohin definiert werden kann. Das Thema hier ist Vermögensverteilung, und zwar wie verteilt ist und wird, und da liegt offenbar einiges im Argen. Dank fehlender Erbschafts- und Vermögenssteuer weiss kein Schwein, wie viel und was wo versteckt ist. Und ich wette mit Ihnen, es ist deutlich mehr, als Sie denken.
@Fissner: Gilt auch für Ihre mal wieder ablenkende Antwort. Wir reden nicht darüber, was verteilt werden kann, sondern wie es verteilt ist. Bei den Saudis schöpfen die bin Salmans den Rahm ab, in Haiti warens lange Jahre die Duvaliers. Und in der BRD?
Rudolf Fissner
@Yossarian Sie haben nicht verstanden, was der GIni-Koeffizient aussagt. Er ist optimal verteilt, wenn alle Einkommen bei 100000 Euro am Tag liegen und genauso optimal verteilt, wenn alle Einkommen bei 1. Euro am Tag liegen.
Schauen Sie sich ruhig mal Statistiken dazu an, die auch das Pro-Kopf-Vermögen mit abbilden: de.wikipedia.org/w...er_nach_Gini-Index Sie schlackern mit den Ohren, wie gewaltig das Pro Kopf Einkommen da differiert.
Und bitte "Wir reden nicht ...". Was soll diese alberne Haltung Argumenten gegenüber?
Yossarian
@Rudolf Fissner Ich habe durchaus verstanden, was der Gini-Koeffizient bezüglich der Vermögensverteilung IN DER BRD aussagt. Nämlich eine ziemlich ungleiche. Und ICH rede davon, WIE das Vermögen IN DER BRD verteilt ist. Und wer hier den Rahm abgeschöpft hat und abschöpft. Nämlich die berühmten oberen ein Prozent. In der BRD weiss man ja noch nicht einmal, wieviel da oben tatsächlich hängengeblieben ist. Und bei Ihnen sehe ich keine Argumente, sondern -wie üblich- alberne fissnersche Nebelkerzen.
Normalo
@Yossarian Hier in der taz habe ich vor Jaheren mal eine Zahl gelesen: Vier! Billionen! Euro! sollen die reichsten 10% des Landes besitzen. Klingt das einigermaßen realistisch?
Hat halt den Schönheitsfehler, dass die reichsten 10% immer noch 8 Mio. Menschen sind und deren Durschnittsvermögen daher bei 500.000 liegen dürfte. Die Mehrzahl von diesen 10% hätte demnach einen Vermögensstock im Bereich eines mehr oder minder gut gelegenen Reihenhauses. Das Volumen aller Vermögen über 500k Euro wäre 2 Billionen, auf die Gesamtbervölkerung verteilt 25k € pro Nase, also wenig mehr als ein halbes Jahresdurschnittseinkommen - wenn man Alles auf einmal einkassieren würde, bis in den Bereich kleinerer Handwerksbetriebe oder etwas besser glegener Wohnungen und kleiner Einfamilienhäuser. SO schnell würden wir das Geld der "Reichen" durchbringen.
Davon ab: Wenn Sie nicht wissen, wieviel "die Reichen" tatsächlich horten, wie wollen Sie dann rechtfertigen, es ihnen weguzmnehmen?
Yossarian
@Normalo Wer hat denn gesagt, dass ich das Vermögen auf Leute verteilen will? Allmählich nimmt Ihre Besitzstandswahrung-Verteidigung etwas abstruse Züge an. Genau wie das Argument, wenn ich nicht weiss, wie viel einer hat, darf ich ihm auch nix wegnehmen. Sie sind doch nicht auf den Kopf gefallen, glaub ich. Das ist nicht Ihr Niveau.
Normalo
@Yossarian Der Punkt war, dass selbst wenn man die Umverteilung ad extenso betriebe, auf die Breite betrachtet so viel Geld gar nicht herumkäme - es sei denn, man ginge wirklich an ALLE Vermögen ran, auch die eher bescheidenen - was in der Tat keiner will.
Und die moralische Argumentation meine ich schon Ernst: Sie befürworten, das Grundrecht auf Eigentum substanziell einzuschränken - dafür brauchen Sie hieb- und stichfeste Argumente. Vage Behauptungen wie "Die Reichen haben einfach zuviel, und die Armen haben einfach zu wenig" sind nicht substantiiert genug. Wer GENAU sind "die Reichen" und wieviel ist "zuviel"? Und wer von denen hat wirklich dieses "zuviel" an Reichtum? Die Maßnahmen, die Sie befürworten haben sehr konkrete Auswirkungen auf sehr konkrete Menschen. Solange Sie nicht jedem Einzelnen von denen darstellen können, warum er jetzt einen Teil seines Vermögens hergeben muss und sein Nachbar möglicherweise nicht, haben sie ein Rechtfertigungsproblem.
Yossarian
@Normalo Nee, an kleine Vermögen will keiner, aber an grosse. Die Grenzen soll die Politik ziehen, dafür ist sie da. Schliesslich gab's ja mal eine Vermögenssteuer und auch eine ernstzunehmende Erbschaftssteuer.
Und zu Ihrer anderen Argumentation: Da setze ich doch einfach mal ein "Starke Schultern müssen mehr tragen als schwache Schultern" dagegen.
Normalo
@Yossarian "Nee, an kleine Vermögen will keiner, aber an grosse."
Aber WOZU?
Ich habe Ihnen säuberlich vorgerechnet, welch lächerlichen sozialen Effekt das hätte - selbst wenn man diese Vermögen vollständig einzöge. Eine (vernüftigere) anteilige Vermögenssteuer wäre entsprechend NOCH weniger effektiv. Geht es Ihnen wirklich nur darum, "die Reichen" irgendwie mehr zu schröpfen als bisher - egal, wozu es gut wäre?
Das wird wohl als verfassungsrechtlich nicht weit fliegen...
Yossarian
@Normalo Das ist wenigstens mal ne ordentliche Diskussion, und kein Räucherkurs wie da oben. Musste jetzt sein.
Man muss doch gar nicht an einzelne verteilen. Erbschafts- und Vermögenssteuer zB in Bildung zu stecken, evtl. Schülern/Studenten aus nicht so solventen Schichten eine Ausbildung zu ermöglichen, ohne an eine Rückzahlung denken zu müssen, wie es eine Zeitlang mal unter Willy möglich war. Ich bin halt grundsätzlich der Meinung, dass die oberen 10% (um einfach mal bei dieser plakativen Definition zu bleiben) einfach unverhältnismässig viel einheimsen. Und sie von diesem Land, seinen Voraussetzungen und seinen Menschen profitieren. Und deshalb verdammt noch mal dem Gemeinwohl (Ihr Begriff aus dem U. Herrmann-Artikel) etwas mehr zurückzugeben haben als bisher.
Aber das ist schon der zweite Schritt. Erst müsste ja die politische Bereitschaft bestehen, in irgendeiner Art die bisherige Vermögensverteilung etwas ausgeglichener zu gestalten. Seh ich nicht. Nicht mal bei den Linken.
Normalo
@Yossarian Mein erstes Problem mit diesem Anliegen ist, dass die Vermögensungleichheit als Maßstab die Unterschiede im Lebensstandard überhöht und im Zweifel durch Maßnahmen, wie Sie sie vorschlagen (die ich im Übrigen AN SICH unterstützen würde), nicht erheblich zu beseitigen ist. Denn Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit führen nicht automatisch zu Vermögensbildung. Dafür braucht es auch den Willen des Einzelnen, in Vermögen und nicht in Konsum zu investieren. Ich kann selbst ein Lied davon singen, dass es auch ohne übertriebene Luxussucht sehr verlockend ist, ein wirklich gutes Einkommen vollständig für nicht "vermögenswerte" Lebensqualität auf den Kopf zu hauen. Von daher bin ich bei der von Ihnen als Vorbedingung formulierten politischen Handlungsdirektive, auf Teufel komm raus die Vermögensverteilung obrigkeitlich zu verändern, ganz klar raus.
Und nochmal: Die top 10% sind nur zu einem sehr überschaubaren Teil
dicke Fische. Die Mehrzahl hat - wenn man der oben genannten Zahl glauben kann, ein Vermögen von unter einer halben Million. Eigentlich reden wir wahrscheinlich nur von den top 2% oder so, wenn es um die wirklich großen Vermögen geht - je nachdem, wo man da die Linie zieht. Das ist vielleicht ein Topf, der angebohrt werden könnte, aber wir sollten uns auch klar sein, dass die Effekte sich in erstaunlich engen Grenzen halten dürften, wenn man das tut. Und ganz ehrlich, von Wegnehmen um des Wegenehmns willen halte ich nichts. Ich will schon vorher wissen, dass das auch was nutzt.
Noch zur Zahlenbasis: Wenn Sie meinen, dass die Vermögen der Reichen nicht wirklich erfasst sind, woher nehmen Sie dann die Gewissheit, dass die unfaire 0 beim großen Rest so stimmt, wie sie immer kolportiert wird?
Rudolf Fissner
@Yossarian "Misst man nach Gini"
Was messen Sie nach Gini?
Gesundheitsversorgung, Sozialquote?, Einkommen? Lebenserwartung?
Ihr "Reichtum" besteht darin, dass Sie Beispiele zeigen, die nichts zu verteilen haben ausser "nichts" oder Öl. Letzteres, das Venezuela, bekomnen selbst Sozialisten des 20. Jhd. nicht gebacken zu verteilen.
nzuli sana
Nichts Neues was Frau van Dyk erläutert.
Es fehlt die Motivation in der Bevölkerungsmehrheit das zu ändern.
Sinulog
Wenn statistisch immer bloss der Durchschnitt betrachtet wird ist die ganze Sache sinnlos.
Es müste geforscht werden wie sich das einzelne Individuum entwickelt.
Wenn innerhalb von 10 Jahren 2 Millionen von der Armut in die Mittelschicht aufsteigen und dafür 3 Millionen Arme einwandern steigt die Zahl der Armen irgentwie logisch….
Und das muss selbst der paritätische zugeben das ohne Zuwanderung die Ungleichheit abnehmen würde…..
2. Punkt der Median liegt bei 50% die Wohneigentumsquote liegt bei ci 45%
ab diesen Punkt also etwas über den Median sind die Menschen auf einmal viel vermögender…
Welche Parteien haben etwas gegen Wohneigentum? Die die immer über Armut jammern…..
05989 (Profil gelöscht)
Gast
Im Prinzip hat Frau van Dyk nichts gesagt, was nicht auch schon Volker Pispers vor 20 Jahren gesagt hat. Ich bin mir sicher, dass Frau van Dyk ihre Aussagen besser begründen kann - aber der Redakteur muss das auch erfragen/zulassen/redigieren. Insofern leider ein schlechtes Interview.
Das Interview darf gerne drei mal so lange sein, die Interviewten müssen auch argumentieren können - sonst kommen da nur Kommentare in Duett-Form heraus.
Es entsteht da nämlich auch das - letztendlich journalistische - Problem, dass die Dampfplauderer mancher Politiker quasi unterschiedslos neben einem Interview mit jemanden steht, der sich sein Leben lang intensiv mit dem Thema auseinandersetzt.
Das Internet hat keine Seitengrenze! Es ist Platz genug, um den Unterschied zwischen neoliberalen Kasperlköpfen und ernsthaften Soziologen und Wirtschaftswissenschaftlern (Hihi - ein Pleonasmus...) sichtbar zu machen.
Und am Willen sollte es der taz nicht fehlen...
Elli Pirelli
@05989 (Profil gelöscht) Für lange und detailtiefe Interviews ist Tilo Jung eine gute Quelle. Ich werde Silke van Dyk mal als Wunschkandidatin vorschlagen.
Rasmuss
Ich sehe an dieser lebhaften, regen Diskussion, WIE gespalten unsere Gesellschaft ist. Selbst auf den Seiten der TAZ macht sich bemerkbar..
Rudolf Fissner
@Rasmuss Wo sehe; Sie eine gespaltene Gesellschaft? Ich sehe nur das Oberdeck, das sich zumindest dahingehend einig ist, dass der Braten oben verteilt wird. Also Business as usual.
Ruediger
@Rasmuss Ich würde das eher als ein Zeichen eines funktionierenden Pluralismus und einer vielfältigen, diversen Gesellschaft sehen, denn als Zeichen einer gespaltenen Gesellschaft.
Andreas J
@Ruediger Plualismus geht von einer politischen Debatte auf Augenhöhe aus. Bei dem Thema wohl kaum der Fall. Politisch und Wirtschaftlich werden Interessender vermögenden um ein vielfaches stärker vertreten. Es besteht ein Machtgefälle. Daher hier ein völlig unangebrachter Begriff.
Paul Rabe
@Rasmuss Richtig, aber ist diese "Spaltung" nicht normal ?
Ich meine jetzt nicht die Diskussion darüber ob es eine Spaltung geben soll, sondern die Spaltung in "Reiche und Arme".
"Normal" in dem Sinne, daß es diesen gespaltenen Zustand wohl schon immer in menschlichen Hochkulturen gab ?
Selbst dort wo man es, angeblich, überwinden wollte (auch in Kuba, China oder der DDR gab es "paläste")
05989 (Profil gelöscht)
Gast
@Rasmuss Da habe ich neulich auch schon gestaunt, als es um Klassismus im Bildungssystem ging...
alexis44
Schuld sind auch die hohen Abgaben, die Verbraucher mit zahlen (Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer usw).
Dan Wyck
Frau van Dyck erwähnt sehr richtig, welche Gruppe im Bundestag unterrepräsentiert, nicht aber welche Gruppe deutlich überrepräsentiert ist: nämlich diejenige, zu der sie selbst gehört, Beamte und Angehörige des Öffentlichen Dienstes. Ich will ihre Arbeit überhaupt nicht in Abrede stellen, im Gegenteil: aber angesichts ihres makrosoziologischen Ansatzes wäre etwas mehr Selbstreflexion wünschenswert. So richtig und wichtig es ist, große Vermögen durch angemessene Besteuerung an gesellschaftlichen Kosten zu beteiligen, so unehrlich finde ich die alleinige Fokussierung auf die sehr kleine Gruppe der wirklich Wohlhabenden, wenn es um soziale Ungleichheit geht. Die Privilegien, die Beamte und Angehörige des Öffentlichen Dienstes im Hinblick auf die Alters- und Gesundheitsvorsorge genießen (oder auch im Hinblick auf die Möglichkeiten zur politischen Partizipation, z.B. durch Freistellung und entsprechende Arbeitsplatzgarantien), konstituieren gerade durch die Größe dieser Gruppe soziale Ungleichheit per se. Und ja: es gibt natürlich viele Geringverdiener im Öffentlichen Dienst. Aber eben bei weitem nicht nur. Und muss jemand, der z.B. in der Personalabteilung einer Behörde arbeitet, auf Lebenszeit verbeamtet sein? Was hinzu kommt: die hohe Steuer- und Abgabenlast in Deutschland trägt (natürlich neben anderen Faktoren) mit dazu bei, dass selbst Gutverdiener kaum aus eigener Kraft Vermögen aufbauen können. Wäre das nicht eine schöne Vorstellung: durch eine Kombination aus der Besteuerung von Vermögen und reduzierte Ausgaben, die durch eine radikale Reform des Öffentlichen Dienstes möglich würden, die Abgabenlast so weit zu senken, dass selbst Menschen aus sozial benachteiligten Schichten aus eigener Kraft zu Wohlstand kommen könnten? Ich will hier keine „amerikanischen“ Verhältnisse – aber blind für das eigene Milieu zu sein, weil es vielleicht unbequem werden könnte, bringt die Debatte auf Dauer nicht weiter.
resto
@Dan Wyck So gesehen, gibt es eine riesige Spaltung zwischen verbeamteten und anderen AN. Eine nähere Analyse über die Auswirkungen würde mich interessieren. Ein Aspekt ist z.B., dass von erster "Gruppe" häufiger Grün gewählt wird, als von letzter. Die Gründe sehe ich darin, dass diese Menschen finanziell/beruflich eben abgesichert.
Wurstprofessor
@Dan Wyck Extra-Witz: die Professorin mag nicht von "radikal" sprechen, wenn Die Linke ein Schonvermögen von 1 Mio. € vorschlägt, sitzt aber selbst auf einem Versorgungsanspruch, der diesen Wert bei weitem übersteigt, aber in ihrer persönlichen Vermögensbildung, da nicht kapitalisiert, mit einer Null dasteht. Man würde ja gerne lachen, eigentlich.
Paul Rabe
Es ist natürlich richtig, daß die Vermögensverteilung sehr ungleich ist und sie auf Grund des ZinsesZins Effektes in Zukunft auch noch mit wachsender Geschwindigkeit ungleicher werden wird.
Aber das ist nicht sozialschädlich, sondern im Gegenteil !!
Dazu sollte man sich klar machen, daß "Reiche" pro Person gar nicht so viel mehr Ressourcen konsumieren als Arme, auch wenn das Vermögen z.B. das hundert oder 100fache des Durchschnitts beträgt, so ist der Faktor beim Mehrkonsum bzgl. Ressourcen vermutlich nur einstellig.
(Auch ein Reicher isst nicht mehr, hat keine 10 Mobiltelefone, geht nicht öfters zum Frisör etc. und hat eben nur begrenzte Zeit für Konsum)
Das Vermögen der oben 5% der Gesellschaft wird nicht konsumiert sondern vor allem investiert.
Die Vergangenheit hat gezeigt, und das gilt weltweit, daß Privatleute wesentlich sorgsamer und besser investieren als Staaten, wo Investitionen eben oft der individuellen, kurzfristigen, Agenda von grade herrschenden Politikern folgen.
Jemand der z.B. einer Familie Dynasty angehört, der hat nicht nur die Kurzfrist - Legislatur Perioden Perspektive eines demokratischen Partei Politikers sondern der denkt in Generationen.
Dessen Investments sind wohl nachhaltiger. Von den so geschaffenen Arbeitsplätzen profitieren dann langfristig alle, denn sie erhöhen am Ende auch die Konsummöglichkeiten jender, die zwar kein Vermögen haben, aber deren Einkommen heute, im kapitalistischen Westen, zu viel größerem Konsum befähigt als es z.B. jemals in sozialistischen Ländern möglich war.
Das mag undemokratisch klingen, ist es auch, aber am Ende dürfte der dadurch insgesamt viel solidere Kapitalstock der Gesellschaft dies mehr als ausgleichen.
Auch wenn dieser Kapitalstock, aus guten Gründen, undemokratisch aber dafür effizienter verwaltet wird.
nanymouso
@Paul Rabe Das ist natürlich glatter Unsinn und sogar die einfachsten und unschärfsten Erhebungen (z.B. des statistischen Bundesamtes) belegen das Gegenteil.
Superreiche entziehen vorallem dem Markt ihr Kapital und haben eine 30-40%-Punkte geringere Ausgabenquote als Normalverdiener (die ca. 98% wieder auf den Markt bringen). Das "Investment", dass Sie hier versuchen herbeizuschreiben, ist vorallem in Aktien und in Immobilien.
Preise zu treiben indem man Aktien handelt, schafft genau 0 Arbeitsplätze, auch wenn die CEOs dieser Welt gerne das Gegenteil behaupten. Steigende Aktienwerte bedeuten nämlich erstmal ein schönes Quartalsergebnis, welches sich der CEO Ihrer Wahl bestimmt nicht durch Investitionen wieder kaputtmachen wird.
Schlimmer ist es nur noch beim Immobilienhandel, dortige Preissteigerungen sind für die Gesellschaft zu 100% von Nachteil. Es gibt genau keinen Grund, warum eine Gesellschaft teuren Boden haben will. Es gibt auch keinen Mechanismus der Immobilienhandel mit allgemeiner Wohlstandsmehrung verbindet (sei es durch geschaffene Arbeitsplätze oder so).
Superreiche sind schlicht und einfach Sozialschmarotzer, weil sie das Geld, dass andere für sie erwirtschaftet haben, der Gesellschaft vorenthalten und damit die Kaufkraft der anderen schmälern.
Dazu muss man aber glauben, dass ein Mensch nicht Millionen aus "eigener Kraft" erwirtschaften kann. Dazu scheinen weder Sie noch die Masse der Menschen bereit zu sein.
97760 (Profil gelöscht)
Gast
@nanymouso Das ist wirklich was ganz neues, daß " Reiche dem Markt Kapital entziehen". Erinnert an den Witz, daß die Phönizier das Geld erfunden haben, aber leider zu wenig davon.
Paul Rabe
@nanymouso „Das "Investment", dass Sie hier versuchen herbeizuschreiben, ist vorallem in Aktien und in Immobilien“
Aber das sind doch Investments die sich am Ende zum Beispiel in Wohnungen die man zusätzlich bewohnen kann oder in Arbeitsplätze niederschlagen.
Natürlich gibt es Fluktuationen auf Den Finanzmärkten da gewinnen und verlieren manche, es ist eine Art Null-Summen-Spiel innerhalb der Kaste der „Reichen“
Das kann man aber für die Betrachtung des Problems ausklammern, am Ende kann man sehen dass der größte Teil des Reichtums investiert und nicht konsumiert wird.
Er wird schlicht einfach deswegen nicht konsumiert weil ein Mensch physikalisch gar nicht in der Lage ist, innerhalb seiner Lebenszeit so viel zu konsumieren.
Insbesondere nicht in der Moderne, in früheren Zeiten haben sehr Reiche sich Schlösser oder Pyramiden gebaut, aber das sehen wir heute eigentlich nicht mehr.
Der Konsum Anteil eines Bill Gates ist zum Beispiel extrem gering im Vergleich zu seinem Vermögen dass er entweder spendet oder eben investiert
nanymouso
@Paul Rabe Na da schreiben Sie es ja selbst. Nur glauben wollen Sie es immer noch nicht.
Reiche konsumieren nicht, häufen aber viel mehr Konsummittel bei sich an, nämlich Geld, welches den ärmeren zum Konsumieren fehlt.
Sie haben genau das Problem beschrieben, nur um dann zu behaupten, dass es das Problem nicht gibt.
Keine Pyramiden und Schlösser, ja? Investments in neuen Wohnraum, he? In meiner Stadt, wie in vielen anderen Städten, werden natürlich neue schicke Wohnungen in Bestlage gebaut. Nur wohnen kann darin kein normaler Mensch, weil die Preise durch das "Investment", welches angeblich ein "Null-Summen-Spiel" ergibt, dermaßen versaut sind. Die Armen, die, die mieten müssen, die finanzieren Ihr "Null-Summen-Spiel". Zu behaupten, es bliebe innerhalb der "Kaste der ,Reichen'", ist hohl und offensichtlich falsch.
curiouscat
@nanymouso Danke für Ihren Beitrag. Ich hätte es selbst nicht besser formulieren können!
Ruediger
Zu dem"Nichts", dass die untere Hälfte besitzt, gehören Autos, Computer, Handys, Wohnungen etc., viel mehr, als die Menschen in den meisten Ländern haben oder auch hier vor ein oder zwei Generationen hatten. Dazu kommt noch ein ziemlich gutes Gesundheits- und Bildungssystem.
Natürlich müssen wir die Bildungschancen verbessern und die Löhne im unteren Sektor müssen steigen. Aber dieses "Nichts" in der Überschrift finde ich sehr reißerisch, in einem Land, in dem wir alle, auch die relativ Armen, viel zu viel besitzen - und zwar auf Kosten der global wirklich Armen und der Zukunft unseres Planeten.
Andreas J
@Ruediger Der unteren Hälfte werden wohl kaum Wohnungen gehören und darauf verweisen das es anderen auf der Welt noch schlechter geht, um bestehende ungerechte Verhältnisse zu legitimieren, ist schäbig.
nanymouso
@Ruediger Die Existenzängste, die diese "wohlhabenden" Nichts-Besitzer haben; die Angst vor nicht enden wollender Erniedrigung beim Hartz-IV Bezug; die beinahe Unmöglichkeit aus einer Harz-IV Lage wieder ein normales Arbeitsleben aufbauen zu können (von Vermögensaufbau ganz zu schweigen); diese Sachen sind gleichzeitig aber real.
Es ist nunmal psychologisch etwas anderes der "Einzige" ohne Job in einer Gesellschaft der Arbeitenden zu sein oder ein Mensch ohne Krankenversorgung in einer Gesellschaft ohne Zugang zu Krankenversorgung.
An dem Titel ist nichts reißerisch, denn er behauptet mit seinem "Nichts" nicht, dass das genauso wenig sei wie das Nichts der global Armen. Es bedeutet lediglich "Nichts" im Kontext der deutschen Gesellschaft. Er bedeutet wörtlich: "Menschen ohne Vermögen, die augenblicklich zahlungsunfähig werden, wenn die monatliche Einkommensquelle versiegt".
Von einem Text zu verlangen, dass er Ihr eigenes, beliebig herbeizitiertes Szenario abdecken muss, und zu klagen, dass er es dann nicht tut, nennt man "Whataboutism".
97287 (Profil gelöscht)
Gast
@nanymouso Was ist an Hartz IV erniedrigend? Sie haben Anspruch darauf, sogar ein Student nach dem Abschluss oder ein Abiturient, der sich noch in der Orientierungsphase befindet, wenn man es richtig anstellt.
Ruediger
@nanymouso Und wie soll denn die Hälfte der Bevölkerung, das Gefühl haben, der Einzige zu sein, der Nichts hat. Das ist schon mathematisch Unfug bei 83 Millionen. Und niemand in Deutschland muss ohne Krankenversicherung auskommen, Mieter sind so gut geschützt, dass sie in den seltensten Fällen Angst haben müssen, ihre Wohnung zu verlieren
Winnetaz
@Ruediger Nichts bedeutet null Vermögen. Das ist bei der unteren Hälfte tatsächlich der Fall. Autos, Computer, Handys: meist mit Schulden finanziert. Sie gehören also der Bank. Wohnungen hat die untere Hälfte überhaupt nicht in Deutschland.
"Die untere Hälfte besitzt nichts." Das ist insofern sogar noch untertrieben angesichts einer dramatischen Zahl von überschuldeten Privathaushalten. Die haben weniger als nichts und auf Jahre hinaus keine Chance auch nur einen Euro positives Vermögen zu erlangen.
Ruediger
@Winnetaz Auch wer eine Wohnung mietet, besitzt diese. Ob man nun Kredite oder Vermögen hat, hat eigentlich keinen Einfluss auf die Lebensqualität, die aus den Dingen entsteht, die man besitzt.
Obscuritas
@Ruediger Wer eine Wohnung mietet besitzt diese? Ich profitiere also als Mieter auch von der Knappheit an Wohnraum in der Stadt und habe auch was von der Erhöhung der Miete, oder wie?
Eine Eigentumswohnung oder Haus ist eine Investition, potentielle Einkommensquelle, Altersabsicherung.
Es geht um die Fixkosten. Miete der Wohnung, Ratenzahlung vom Handy, Ratenzahlung auf Haushaltsgeräte, Ratenzahlung auf das Auto. Ärmere Haushalte haben so hohe Fixkosten, dass auch an täglichen Ausgaben, wie für Essen gespart werden muss. Wer am Essen sparen muss, spart damit auch schnell an der eigenen Gesundheit.
Und jemand der jeden Monat darauf achten muss, dass sein/ihr Lohn noch bis zur nächsten Gehaltsüberweisung reicht, der hat eben nicht, die selbe Lebensqualität, wie jemand der/die auch bei unerwarteten Ausgaben, oder Einkommenseinbußen, sich nicht sofort Sorgen machen muss die Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können.
Rudolf Fissner
Der Vergleich DDöR - BRD hat gezeigt, dass die Lebenserwartung vor allem mit dem Wirtschaftssystem zusammen hängt.
Frederik Nyborg
@Rudolf Fissner Wenn Sie nur auf die Wirtschaft schauen, dann wäre China mit seinem Mischsystem aus Planwirtschaft und Marktwirtschaft zu erwähnen. Das Reich der Mitte hat uns wirtschaftlich schon längst überholt. Die bauen in einer Woche Krankenhäuser, Flughäfen und ganze Städte. Das schafft die Marktwirtschaft und der deregulierte Kapitalismus nicht!
Schnetzelschwester
@Frederik Nyborg China kann man nicht mit Deutschland vergleichen, man muss eher ganz Europa (incl. Nicht-EU) zum Vergleich heranziehen. Die Provinzen sind teilweise größer als ganze EU-Länder, und die wirtschaftlichen Umstände spreizen sich wie in Europa Moldawien bis Dänemark. Die soziale Ungleichheit ist in China noch größer als bei uns. Arme Wanderarbeiter im ländlichen Westchina verdienen umgerechnet ca 240€ im Jahr, ein IT-Spezialist in Shanghai 6000€ im Monat.
Der soziale Sprengstoff, der sich dadurch aufbaut, treibt Xi wahrscheinlich nachts den Angstschweiß auf die Stirn und lässt ihn noch mehr Unterdrückungswerkzeuge bauen.
Die Chinesische KP ist genauso "kommunistisch" wie unsere CxU "christlich". Ist nur noch Folklore in einem Alte-Gelbe-Männer-Machtapparat. Also fast wie bei uns. Der einzige Unterschied: Die Chinesen können ihre Regierung nicht abwählen, wir tun es nicht.
Rudolf Fissner
@Frederik Nyborg Der offizielle Begriff für das Wirtschaftssystem in China lautet "Sozialistische Marktwirtschaft" nicht Planwirtschaft. Mit Planwirtschaft ist man dort nicht vorangekommen.
de.wikipedia.org/w...he_Marktwirtschaft
Kaboom
@Frederik Nyborg Ihnen ist offenbar nicht bekannt, dass die von Ihnen erwähnte Geschwindigkeit ihre Ursache darin hat, dass die Bewohner der Grundstücke, auf denen Gebäude geplant sind, ganz schlicht vertrieben werden. Es gibt keine Einspruchsmöglichkeiten o.ä..
Und ob der Erfolg Chinas dauerhaft sein wird, muss sich erstmal zeigen. Diktaturen - das lehrt die Geschichte - werden früher oder später - mehr oder weniger blutig - beendet.
Frederik Nyborg
@Kaboom Doch das ist mir bekannt, ich bin kein Befürworter des politischen und sozialen Systems in China. Ich bin ein Befürworter der Menschenrechte und die werden weltweit durch den wirtschaftlichen Erfolg der Chinesen immer mehr zurückgedrängt. Meine Feststellung galt nur dazu, dass die Gleichung nicht mehr aufgeht - freie Marktwirtschaft gleich Erfolg und alles was Planwirtschaft aufzeigt gleich Misserfolg. China hat, was die reinen volkswirtschaftlichen Kennzahlen (bspw. BSP) anbelangt, wesentlich mehr Erfolg. Das Mischsystem aus Planwirtschaft und Marktwirtschaft ist diesbezüglich also erfolgreicher. Daher wird das 21 Jahrhundert auch das chinesische werden. Die Weltsituation im Hinblick auf Menschenrechte werden darunter aber erheblich leiden. Und ob China wirklich zusammenbricht wage ich zu bezweifeln, da dort aufgrund des technischen Fortschritts und der Digitalisierung mittlerweile ein Überwachungsstaat herrscht, gegen den Oppositionelle friedlich oder gewaltsam wenig ausrichten können.
Kaboom
@Frederik Nyborg Wirtschaftswachstum (oder andere ökonomische Parameter) bei einem Schwellenland wie China mit dem von Industrieländern zu vergleichen, ist wenig sinnvoll. Mit der gleichen "Logik" könnte man schließen, dass das indische Kastensystem dem westlichen Gesellschaftssystem überlegen sei, weil das indische Wirtschaftswachstum ebenfalls wesentlich höher ist, als das der Industrieländer.
In einem aber gebe ich Ihnen Recht: China wird definitiv wirtschaftlich (und vermutlich militärisch) zur globalen Nr. 1 werden. Das liegt auch an China, aber nicht nur. Der Niedergang der USA durch den ständigen Machtzuwachs immer durchgedrehterer Gruppen (von den Neocons über die Tea Party bis hin zu den Trumpisten und Qanon) spricht Bände und wird Effekte haben,
Anna Schneider
@Frederik Nyborg Nyborg
Wollen Sie China jetzt ernsthaft als Vorbild hinstellen? Wir können ja gerne unser Lohnnveau und Sozialsystem dem chinesischen Modell anpassen. Wären Sie dann glücklich?
Jäger Meister
@Anna Schneider Ja, das wollen manche anscheinend hier...
Frederik Nyborg
@Anna Schneider Nein, wie kommen Sie denn darauf. Ich habe nur festgestellt, dass der Totalitarismus mittlerweile erfolgreicher ist wirtschaftlich als der freie Westen, das bedauere ich sehr, denn ich bin ein Befürworter der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit. Das leistet China leider überhaupt nicht und bringt damit die Menschenrechte noch mehr in Bedrängnis. Die Gleichung, die Herr Fissner aufstellt, funktioniert nur nicht mehr. Freie Marktwirtschaft ist erfolgreich und Planwirtschaft bzw. Mischsysteme sind nicht erfolgreich. Das stimmt nicht mehr. Das Land mit der kommunistischen Einheitspartei ist aufgrund ihres wirtschaftlichen Mischsystems aus Planwirtschaft und Marktwirtschaft erfolgreicher, also was die reinen volkswirtschaftlichen Kennzahlen betrifft, bspw. BSP usw.
Rudolf Fissner
@Frederik Nyborg Hm ... In DE werden die Menschen im Schnitt 3-4 Jahre älter als in China,
Frederik Nyborg
@Rudolf Fissner Das ist nicht viel. In ein paar jähren haben die uns da auch noch überholt!
Rudolf Fissner
@Frederik Nyborg Nicht viel?!
Das sind 4 Milliarden Menschenjahre in China
Jalella
Sehr gut, dass Frau van Dyk auch die Erbschatzsteuer und die Vermögen anspricht. Derzeit reden viele von Besteuerung, aber das ändert an der Armut der unteren Schichten nichts, da sie schon keine Steuer zahlen. Man muss erstmal etwas haben, von dem man Steuern zahlen kann.
Dazu gehört ein anständiger Lohn und die Tatsache, dass der nicht gleich komplett für die Miete drauf geht.
Anna Schneider
@Jalella Jalella
Was bringt ein anständiger Lohn, wenn nach Abzug von Steuer und Sozialabgaben nicht so viel mehr übrig bleibt als vorher (man muss ja auch noch mit höheren Kosten für die arbeitsplatznahe Wohnung, Fahrtkosten, Bekleidung rechnen)
Andreas J
@Anna Schneider Einkommenstreigerungen machen keinen Sinn weil man dann mehr Steuern und Sozialabgaben zahlen muss? Sinnfrei was sie da schreiben.
Wurstprofessor
@Andreas J Nein, ist es nicht. Z.B. "Aufstocker" und andere, die versuchen, dem Hartz-System zu entkommen, sind teilweise "Grenzsteuersätzen" von ca. 80% ausgesetzt. Knapp über dem Betrag, der sich aus Vollzeit bei Mindestlohn ergibt, beginnt die Steuerprogression so richtig zu beißen, d.h. die Abgabenlast steigt schneller an als irgendwo sonst in der Kurve.
Ich glaube, darauf wollte Anna Schneider hinaus.
LeSti
Nun frage ich mich, was macht ein Mensch mit Hauptschulabschluss in einer Ausbildung, wenn zum 18. Geburtstag ein halbes Durchschnittsvermögen ausbezahlt wird? Ich bin geneigt, hier mehr von einem Subventionsprogramm v. A. für die Branchen Auto, Handy etc., Bekleidung, Getränke und Tourismus auszugehen als von einer Maßnahme, die nachhaltig Vermögen nach unten verteilt. Da wäre eine Ausweitung von Förderprogrammen zum Erwerb von Wohneigentum vermutlich sinnvoller. Das ließe sich dann auch gezielt einsetzen, um energetisch sinnvolle Immobilien zu fördern.
Wurstprofessor
@LeSti Um Auto, Handy, Suff und Fraß usw. bereitzustellen arbeiten ja auch überall auf der Welt Leute...
warum_denkt_keiner_nach?
@LeSti "Nun frage ich mich, was macht ein Mensch mit Hauptschulabschluss in einer Ausbildung, wenn zum 18. Geburtstag ein halbes Durchschnittsvermögen ausbezahlt wird?"
Stimmt. Die sind ja alle dumm...
Wurstprofessor
@warum_denkt_keiner_nach? Naja, so wie die Hauptschule sich in letzter Zeit entwickelt hat... man kann ja "dumm" vielleicht etwas akademischer formulieren, aber der Durchschnitt der Erbegnisse eines normierten einschlägigen Tests wird in dieser Gruppe sehr wahrscheinlich unter dem einer ansonsten ähnlichen Gruppe Gymnasiast_innen liegen...
warum_denkt_keiner_nach?
@Wurstprofessor Mir ging es mehr um die Verachtung, die aus solchen Aussagen spricht...
Normalo
@warum_denkt_keiner_nach? Es ist ein Teufelskreis: Die - meist gebildeteren - Langfrist-Denker sagen "Haben kommt von Behalten" und werden dadurch (und mit einer ordentlichen Portion Glück) auf Dauer - kann Jahre oder auch Generationen dauern - zu "Reichen". Sie können sich dann Dinge leisten, die als Statussymbol gelten, ohne die Ausgabe groß zu merken, und haben Zeit und Geld für gelebte Bildung - und bringen ihren Kindern bei: "Haben kommt von Behalten.".
Andere wollen den Status auch und geben ihr weniges Geld für seine Symbole aus. Die merken dann irgendwann, dass man bestimmte Äpfel nicht essen kann und fette Labels auf den Klamotten diese auch nicht wärmer machen. Und bleiben arm, und gehen nicht aufs Gymnasium, sondern kaufen vom schnellstmöglich erstverdienten Geld den nächsten nicht-essbaren Apfel - und bringen Ihren Kindern bei, dass Weihnachten wichtig ist, weil es dann Äpfel umsonst gibt.
Wenn es Verachtung ist, diese Tendenzen festzustellen, dann Asche auf mein Haupt.
Lieblich
@LeSti Was mache ich mit Wohneigentum, wenn ich wg. der Arbeit mehrmals umziehen muss?
Kaboom
@Lieblich Wie wärs mit Vermieten? Dann können Sie - weiter Vorteil - eventuell noch nicht zurückgezahlte Kredite für ihre Immobilie steuerlich absetzen.
Rudi Hamm
"Die Linken werden auch medial gerne als nicht koalitionsfähig abgehakt."
Das könnte aber auch daran liegen, dass wegen ihrer drastisch zu allen anderen Parteien abweichenden Vorstellungen sie tatsächlich nicht koalitionsfähig sind.
Auch stelle ich mich die Frage, warum die Linke so wenig Zustimmung hat, wenn doch die Mehrheit der Wähler angeblich "von unten nach oben" geschröpft werden.
Anna Schneider
@Rudi Hamm Rudi
Liegt vermutlich daran, dass die Linken gar nicht vorhaben, die wirklich Reichen zu schröpfen. Sondern in erster Linie die Normalverdiener (die dann einfach mal als reich deklariert werden).
Kaboom
@Anna Schneider So viel zum Thema "Ahnungsfrei und Spass dabei".
warum_denkt_keiner_nach?
@Anna Schneider Steht im Wahlprogramm der Linken aber eindeutig anders. Sie wollen den Normalverdienern mehr Geld in der Tasche lassen.
Die Linke hat das als einzige Partei so ausführlich im Programm.
Winnetaz
@Rudi Hamm Die Linke ist im Bund nicht koalitionsfähig. Das liegt auch an weltfremden Forderungen der Linken. "Bundeswehr raus aus Afghanistan!" haben sie bspw. jahrelang gerne plakatiert. Jetzt sieht man, wo es hinführt, wenn man solchen Forderungen leichtfertig nachkommt.
warum_denkt_keiner_nach?
@Winnetaz "Bundeswehr raus aus Afghanistan!"
Ja. Das war die Forderung. Eine überstürzte Flucht unter Zurücklassung der Zivilisten war damit nicht gemeint.
Kaboom
@Rudi Hamm Verfolgen Sie einfach die Berichterstattung. Über Inhalte der Linken wrd so gut wie nicht berichtet. Kleines Beispiel gefällig? Im letzten BT-Wahlkampf stellte die Linke ihr Steuerkonzept vor. War (AFAIR) bis 80k/160k (Single/verh.) wesentlich vorteilhafter als die Konzepte aller anderen Parteien. Kam allerdings so gut wie nirgendwo vor. Wohingegen irgendwelchen Streitereien oder dem Privatleben von Wagenknecht ständig breitester Raum gegeben wird.
Pfanni
„Privatversicherte leben länger als Kassenpatienten, Beamte länger als Arbeiter“
Ich bin Kassenpatient, trotzdem wurde mir von meiner Kasse bisher keine Leistung verweigert. Falls mein Leben „verkürzt“ sein sollte, dann gewiss nicht deswegen. Ein Bekannter, der privat versichert ist, beklagt sich häufig, dass er immer wieder Leistungen einfordern muss, die er von einer Krankenkasse ohne Probleme bekäme. Ob das seine Lebenserwartung steigert?
Im Übrigen ist die Lebenserwartung seit Beginn der BRD deutlich gestiegen (und nicht etwa gesunken!). Ich glaube kaum, dass dies allein auf die Handvoll Reichen und Superreichen zurückzuführen ist!
Gefahrengebietler
@Pfanni Nein, dass die Lebenserwartung gestiegen ist, liegt an den Fortschritten in der Medizin.
warum_denkt_keiner_nach?
@Pfanni "Im Übrigen ist die Lebenserwartung seit Beginn der BRD deutlich gestiegen (und nicht etwa gesunken!)."
Hat auch niemand behauptet.
Anna Schneider
@Pfanni Pfanni
Liegt wahrscheinlich daran, dass sie gar nicht erfahren, was ein Privatpatient alles so angeboten bekommt. Ich habe den direkten Vergleich z.B. ein verändertes Muttermal. Beim Kassenarzt 3 Wochen auf den Termin gewartet. Dann hieß es: Ja ist auffällig, machen Sie bitte einen Op Termin. Der war dann nochmal 5 Wochen später. Ich, panisch, habe zuhause einer Privarklinik angerufen und das Ding auf eigene Kosten am nächsten Tag rausmachen lassen. War noch alles gut. Aber das nur mal als Beispiel, dass der Unterschied Kassen/Privatpatient sogar überlebensentscheidend sein kann.
Normalo
@Anna Schneider Was heißt "War noch alles gut."? Klingt zumindest so, dass es eben NICHT überlebenswichtig war, die OP sofort durchzuziehen. Wenn der Kassenarzt erkennen (oder zumindest nicht ausschließen) konnte, dass Sie SOFORT eine OP brauchten, dann hätte er auch mehr sagen müssen als "Besorgen Sie sich mal einen Termin.". Für sowas gibt es Arztbriefe und zur Not auch das Telefon. Dann wird auch ein früherer Termin frei. Die werden nämlich für genau solche Fälle vorgehalten.
Davon abgesehen: Es ist richtig, dass der Kassenbetrieb nicht immer mit dem Luxus sofortiger Behandlung und ganz kurzfristiger Terminierung aufwarten kann. Auch sonst ist einiger Schnickschnack dabei, den Kassenpatienten schlicht nich tbekommen können. Das liegt natürlich daran, dass die Privatversicherungen deutlich besser zahlen (WENN sie zahlen). Nur gibt es zwei Probleme:
1. Was auch immer die Privatversicherungen NICHT zahlen, muss der Patient aus eigener Tasche zu denselben erhöhten Preisen berappen.
2. Für die gesamte Bevölkerung geht Privatmedizin gar nicht. Die Gesundheitskosten würden das BIP auffressen. Auch das risikobasierte Beitragsmodell, das die Privatversicherungen trägt, wäre mit sozialer Abstaffelung nicht zu halten.
Die Alternative zur "Klassenmedizin" ist also nicht "Privat für Alle", sondern "Kasse für Alle". Und das wiederum brächte deutlich weniger Anreize für die Leistungserbringer, besser zu werden. Im Moment wirken die Privatpatienten da als Wettbewerbsanheizer. Gibt es sie nich tmehr und alle abreiten budgetiert nach altenm Kassenbrauch, dann hat der einzelne Leistungserbringer - egal ob staatlich oder privat getragen - nur noch ein Interesse, nämlich Kostenoptimierung.
Wonneproppen
www.welt.de/wirtsc...der-Deutschen.html
Hier wird ziemlich gut belegt, dass a) die soziale Spaltung ab statt zunimmt und b) diese lange nicht so groß ist, wie angenommen.
Im übrigen ist Deutschland nicht reich sondern mit über 1.300.000.000.000 Euro brutal verschuldet. Griechenland lässt grüßen.
Shasu
@Wonneproppen Die Springer-Presse sagt, dass es keine soziale Spaltung gibt (lt. Titel da ja hinter Paywall), dann muss es ja wohl so sein. Gut dass die vielen Sozialforscher, die klar belegen, dass es eine solche gibt, sich allesamt irren. :-)
Wonneproppen
@Shasu "DIE Springerpresse?" Der linke Spiegel oder die konservative Welt? Oder die ganze Bandbreite dazwischen?
Die zitieren im übrigen nur Studien. Töten Sie nicht den Boten, wenn Ihnen die Nachricht nicht gefällt.
lexi star
@Wonneproppen Dass die Welt einen artikel schreibt der behauptet, dass soziale spaltung abnehme und nicht so groß sei, ist jetzt nicht überraschend.
Kaboom
@Wonneproppen Erklären Sie doch bitte mal, was genau die Staatsverschuldung mit privatem Vermögen zu tun hat. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt.
Achja: Es gibt tatsächlich im Jahre 2021 noch Leute, die glauben, das die Probleme Griechenlands vor ein paar Jahren etwas mit der Verschuldung des Landes zu tun hatten? Sehr erheiternd!
Wonneproppen
@Kaboom 'was genau die Staatsverschuldung mit privatem Vermögen zu tun hat.'
Rente, Pflege, Sicherheit, die komplette Infrastruktur, Kindergärten, die 50 Milliarden Sozialhilfeausgaben jährlich. Sonst eigentlich nichts.
Kaboom
@Wonneproppen LOL, nun wiederum möchten Sie den dritten Hund durchs Dorf jagen mit der These, dass der Schuldenstand etwas mit den staatlichen Ausgaben zu tun habe? Dann erklären Sie doch bitte mal, wie es sein kann, dass Japan einen Schuldenstand von rund 250% des BIP hat, aber wunderbar klarkommt und keinerlei Probleme bei "Rente, Pflege, Sicherheit, die komplette Infrastruktur, Kindergärten".
Du liebe, Güte, dass es in 2021 immer noch Leute gibt, die die neoliberalen Märchen von vor 20 Jahren glauben ...
warum_denkt_keiner_nach?
@Wonneproppen Es behauptet auch niemand, dass D als Staat reich ist. Es geht um einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung.
PS: Ausgerechnet hier einen kostenpflichtigen Artikel zu verlinken, ist ein guter Witz.
Wonneproppen
@warum_denkt_keiner_nach? Guter Journalismus kostet.
warum_denkt_keiner_nach?
@Wonneproppen Die Welt als guter Journalismus. Echt lustig :-)
Gabriel Renoir
Aufgrund der Steuerprogression steigen die Steuern. Die 10 Prozent der Haushalte mit den höchsten Einkommen zahlen fast die Hälfte des gesamten Aufkommens der Einkommensteuer. Wenn Sie über 50% Steuern gehen, werden Leute lieber mehr Urlaub machen, als die Hälfte des Zusatzeinkommens abzugeben. Die Korrelation zwischen Lebenserwartung und Armut ist falsch. Man muss sich die Korrelation zwischen Details der Lebensführung (zB Übergewicht, Ernährungsgewohnheiten ...) und Lebenserwartung ansehen.
schnabeltier
@Gabriel Renoir Im Interview geht es dezidiert um Vermögen und dass dieses beinahe abgabenfrei (Frau van Dyk spricht von 2%) als Erbschaft weitergegeben werden kann, was über einen gewissen Zeitraum zu einer starken Konzentration von Vermögen in einem kleinen Teil der Gesellschaft führt (geführt hat). Die Korrelation zwischen Lebenserwartung und Armut ist statistisch nachweisbar. Die Frage, wie die Kausalität hinter dieser Korrelation aussieht ist strittig und wird ja hier auch diskutiert.
Nilsson Samuelsson
Danke fuer den Interview der noch einmal aufzeigt, wie soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit Gesellschaften spalten und destabilisieren.
Ich errinere mich an einen Artikel von Jens Jessen in der Zeit von 1. September 2011 mit dem titel "Unterwegs zu Plutokratie" ( www.zeit.de/2011/3...nzkrise-Demokratie ) Jessen benennt schon vor 10 Jahren die Themen aus dem Interview mit Frau van Dyk.
Ich denke es gibt zur zeit sehr starke konservative Kräfte, die sehr viel tun und ausgeben, damit diese Themen nicht all zu sehr im Wahlkampf diskutiert werden. Trotzdem brauchen wir Veränderung und eine Regierung ohne CDU, die auch mit Klima und Umwelt im Blick unsere Gesellschaft wieder Nachhaltig stabiliert.
Boba Test
ich finde es gibt einen blinden Fleck in dieser problematischen Situation, das linke Parteien so schwach oder fast gar nicht im Bereich konkrete soziale Gerechtigkeit aktiv sind:
die deutschen Wähler*innen.
jede Partei auch die "linken" haben schiss, konkret über Enteignung, Umverteilung oder Steuerreform etc zu reden.die Armen haben keine Lobby, wenn für Geringverdiener mal wieder was angehoben wird interessiert es niemanden. WennKühnert über deutsche Wohnen spricht, haben Leute paradoxerweise schiss um ihren Vorgarten.
die Deutschen, selbst wenn sie unter den Umständen leiden, glauben Ihnen würde etwas weg genommen werden/die DDR kommt wieder/haben Angst das nicht mehr nach Leistung bezahlt wird(dabei wurde es das noch nie)
... die neoliberalen Märchen sind komplett DNA unserer Kultur geworden und auch eine SPD hat sich dadurch profiliert Hartz 4 und "kein Recht aufFaulheit" raus zu hauen
Rudi Hamm
@Boba Test "Armen haben keine Lobby, wenn für Geringverdiener mal wieder was angehoben wird interessiert es niemanden"
Doch haben sie, die Wahlurne. Doch stellt sich die Frage, warum Millionen "Arme" trotzdem anders wählen.
Rudolf Fissner
Oberdeckdebatten
Der größte Teil der Welt hat fast nichts. Und hier streitet man sich um die Verteilung des Bratens auf dem Oberdeck.
Anna Schneider
@Rudolf Fissner Richtig. Wenn man schon die Reichen noch höher besteuert, müsste der Mehrertrag nicht für H4 hierzulande ausgegeben werden, sondern direkt nach Afrika transferiert werden. Selbst H4 Empfäger sind reich. Global gesehen.
Rudolf Fissner
@Anna Schneider So sehe ich es auch.
Frederik Nyborg
@Anna Schneider Oh je, da haben sich ja zwei gefunden ...
Rudolf Fissner
@Frederik Nyborg Nach ihren Antworten auf andere Kommentatoren zu beurteilen, sind sie zu 90% die Nummer zwei bei mir und anderen 🤪
Winnetaz
@Rudolf Fissner Auf dem Oberdeck liegt nur die eine Hälfte im Liegestuhl. Die untere Hälfte muss die Drinks servieren und nach der Party die Planken schrubben.
Frederik Nyborg
@Rudolf Fissner Wenn der Braten hier gerecht verteilt ist, dann kann der Braten auch weltweit gerechter verteilt werden. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Ansonsten ist es wie mit dem Klimaschutz und den Leuten, die argumentieren, bringt doch alles nichts, der Rest der Welt ist an allem Schuld!
Rudolf Fissner
@Frederik Nyborg Klar doch. Prioritäten sind wichtig. Aber warum wollen Sie die Hungernden zuletzt versorgen? Das ist nicht links, das ist links getarnter Neoliberalismus.
Und nein, Klimaschutz funktioniert anders herum. Somalia ist nicht der Hauptverursacher! Wir haben mitnichten den größten Teil des Bratens verdient weil wir zu den Hauptverursachern des Klimawandels gehören.
warum_denkt_keiner_nach?
@Rudolf Fissner Ja. Im Vergleich mit dem Rest der Welt geht es uns gut. Das ändert aber nichts daran, dass in D die Unterschiede gewaltig sind.
PS: Die DDR Führung hat auch gern auf andere Länder verwiesen :-)
Normalo
@warum_denkt_keiner_nach? ad PS: Die Negativbeispiele musste sie sich aber mit deutlich spitzeren Fingern raussuchen - oder irgendeinen totalen Quark erzählen, was da abgeht...
warum_denkt_keiner_nach?
@Normalo "Die Negativbeispiele musste sie sich aber mit deutlich spitzeren Fingern raussuchen"
Nein. Auch damals war es schon so, dass es dem weitaus größerem Teil der Menschheit schlechter ging, als den Menschen in Dresden, Berlin, Magdeburg usw.
Rudolf Fissner
@warum_denkt_keiner_nach? Na ja. Die DDör hatte ja auch eingeredet kapitalistisch erwirtschaftetes Startkapital und ging nicht bei Null an.
warum_denkt_keiner_nach?
@Rudolf Fissner Jeder Staat baut auf Vorgängern auf. Das Startkapital bestand übrigens, nicht nur, aber zu einen großen Teil, aus Trümmern.
PS: Das Startkapital in Bayern war teilweise aus dem Osten "evakuiert" :-)
Rudolf Fissner
@warum_denkt_keiner_nach? Na ja. Bildung und Know How waren vorhanden. Ein Großteil der Firmen und Produktionsstätten auch noch.
Und wollen Sie sagen dass nur die "Dummen und Mitläufer nicht aus der DDÖR evakuiert sie sind?
Yossarian
Mal ne andere These: Egal welche linke Truppe sich mal aufgemacht hat, irgendwann waren mit einmal nicht mehr die Leute mit den richtigen Ideen am Ruder, sondern Vielschwätzer, die alles "realistisch" und "pragmatisch" angingen - seltsamerweise war das immer die Richtung des "Kapitals". So wurde Brandt entsorgt, durch den Feldwebel Schmidt, Ditfurth, Trampert, Ebermann durch den Realo und Albright-Wurmfortsatz Fischer (KGE und Trittin sind ja immer noch dabei), Lafontaine musste dem Hannover-Gang-Boss Schröder das Feld überlassen, Wagenknecht mit ihren Themen wurde von den gegenderten Kipping und Riexinger abserviert, und Baerbock hat jetzt schon die Kapitalisten Schule der Young global Leaders durchlaufen.
Könnte Methode hinterstecken. Die fröhliche Ausplünderung der BRD wird jedenfalls weitergehen.
rughetta
@Yossarian wo ist jetzt die these? ich lese da nur wirre behauptungen.
Kaboom
@rughetta Sie nennen Fakten "wirre Behauptungen" Sehr erheiternd!
Yossarian
@Yossarian War eigentlich ne Antwort an shasu
Mainzerin
"Dass die klassenspezifische Lebenserwartung in einem so wohlhabenden Land im Wahlkampf nach der Coronapandemie ein Tabu bleibt, das ist für mich das größte Versagen der linken Parteien."
Falls Sie die SPD zu den linken Parteien zählen, dann ist das kein Wunder! Schließlich hat bei rot-grün der SPD Kanzler Hartz IV eingeführt - einen der Hauptgründe des sozialen Absturzes!
In der Folge hat sich Kanzler Schröder in Davos selbst gerühmt den effektivsten Niedriglihnsektor in der EU erzeugt zu haben...
Wieso sollte da irgend jemand seine Hoffnung in eine rot-grüne Koalition plus X setzen, wenn es um sozialen Ausgleich gehen muss?
Winnetaz
@Mainzerin Selbst die CDU gehört zu den linken Parteien. Sie ist dank Merkel bis auf wenige Ausnahmen (Maaßen, Merz und Co.) komplett sozialdemokratisiert. Darum wird die SPD auch kaum mehr gewählt. Sie ist Opfer des eigenen Erfolges geworden. Vergleichen Sie mal die Positionen der heutigen CDU mit der von vor 25 Jahren - damals war man in der CDU noch konservativ.
Kaboom
@Winnetaz Aus Sicht von jemand, der selbst politisch am äußersten rechten Rand steht, sieht das vermutlich so aus.
Anna Schneider
Die Aussage, dass wer reich ist lebt länger ist falsch und längst widerlegt. Richtig ist, dass wer fit (geistig und körperlich) ist, mehr verdient. Auch Arme können gesund leben, die Krankenversorgung ist die gleiche. Und mal die Glotze auszulassen und statt dessen durch den Wald zu joggen, ist auch keine Vermögensfrage.
Kaboom
@Anna Schneider Können Sie ihre Einfälle eigentlich auch belegen?
warum_denkt_keiner_nach?
@Anna Schneider "Auch Arme können gesund leben, die Krankenversorgung ist die gleiche."
Ein schlechter Witz. Oder? Es ist ein großer Unterschied, ob man als Kassen- oder Privatpatient einen Termin braucht. Und das ist nur ein Beispiel.
Rudolf Fissner
@warum_denkt_keiner_nach? Der Unterschied ist doch wohl eher ob man eine Krankenkassenversorgung hat oder nicht. Und die liegt in DE im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Welt bei 99,9%. Sie vergleichen Probleme auf höchstem Niveau.
warum_denkt_keiner_nach?
@Rudolf Fissner Warum beschleicht mich wohl der Verdacht, dass diese ständigen Hinweise auf den Rest der Welt davon ablenken sollen, hier etwas zu tun?
Aber zum Thema. Es ist schon ein Unterschied, ob man als Kassenpatient oder Privatpatient einen Termin machen will. Vor allem bei Fachärzten.
Mal abgesehen davon, dass sich die richtig Wohlhabenden Therapien, Kuren, Spezialisten ect. leisten können, für die keine Kasse aufkommt.
Sputnik-HH
@warum_denkt_keiner_nach? Wenn man ernsthaft krank ist bekommt jeder sofort einen Termin. Und wird in jedem Krankenhaus gleich gut oder schlecht behandelt, egal welche Kasse zahlt. Und wenn es um Vorsorgeuntersuchungen geht, und die haben noch am ehesten, bzgl. ärtzlicher Behandlung, Einfluß auf ihre Lebenserwartung, dann kommt es auf ein paar Tage mehr oder weniger nicht an.
Es gibt keinen Beweis das Privatpatienten länger leben wie Kassenpatienten. Schreibt ihnen ein GK Versicherter aus Überzeugung und Faktenlage. Genausowenig wie Menschen in Ländern mit einem Einheits KV System eine höhere Lebenserwartung haben.
Rudolf Fissner
@warum_denkt_keiner_nach? Das soll nicht ablenken hier etwas zu tun, das soll aufrufen sich die wirklichen Probleme auf der Welt anzuschauen und anzugehen, statt sich immer nur um Luxusprobleme zu kreisen.
Wir brauchen hier wahrlich nicht noch fetteren Konsum, noch größere Wohnungen. Das Klima haben wir mit unserem fetten Fußabdruck bereits zur genüge platt gemacht.
warum_denkt_keiner_nach?
@Rudolf Fissner Stimmt. Deshalb müssen wir besser verteilen, statt insgesamt mehr zu verbrauchen. Wenn es uns hier gelingt, eine wirklich (auch klima-) gerechte Gesellschaft aufzubauen, wäre das ein gutes Vorbild für den Rest der Welt.
So machen uns andere nur unsere Fehler nach.
Winnetaz
@warum_denkt_keiner_nach? Nein, das ist schon richtig. Ich bin selbst Kassenpatient und fühle mich gut versorgt.
Ich denke, es ist eher eine Frage der Bildung und damit einhergehend die Einsicht, wie ein gesunder Lebensstil aussieht. Das hat jeder selbst in der Hand. Bewegung kostet nichts. Nicht-Rauchen spart sogar erheblich viel Geld ein. Das gleiche gilt für den Verzicht auf Alkohol. Damit sind die größten Risiken bereits eliminiert und die durchschnittliche Lebenserwartung steigt um Jahre!!
Oliver Koch
@Winnetaz Dann warte mal ab, bis Du mal 2 Jahre auf einen Therapieplatz warten musst...
warum_denkt_keiner_nach?
@Winnetaz "...fühle mich gut versorgt."
Gefühl und objektive Realität müssen nicht immer identisch sein.
Andreas J
@Anna Schneider Experten des Landwirtschaftsministeriums haben erst vor kurzem veröffentlicht das eine Gesunde Ernährung mit 5,09 EUR pro Tag nicht möglich ist. Zudem belegen alle Zahlen das Reiche länger leben. Die Schuld, ganz nach neliberaler manier, einfach den Betroffenen in die Schuhe zu schieben, ist schon sehr daneben. Nix ist wiederlegt!
CarlaPhilippa
@Anna Schneider Woher haben Sie diesen Befund? Wenn ich mir die Studienlage so anschaue, sehe ich ganz verschiedene Befunde. Das liegt auch daran, dass sich Kausalitäten kaum nachweisen lassen, man kann es meistens auch anders herum deuten. Wenn Sie DIE Killerstudie dazu haben, nur her damit.
Lieblich
@Anna Schneider Frau van Dyk hat die sozioökonomischen Daten mit diesem Resultat ausgewertet. "Das ist falsch" ist mir als Argument zu dünn, erst mal nur Meinung. Sicher haben Sie Quellen für Ihre Behauptung. - Der individualistische Ansatz ist natürlich zum Einen bequem, weil er die Politik aus der Verantwortung nimmt - jeder kann (fast) alles erreiche, wenn er es nur entschlossen angeht - und hat zum Anderen dieses prickelnde calvinistische Moment - arbeite hart (an Dir) und entsage der Bequemlichkeit.
Rasmuss
@Anna Schneider [...] Beitrag entfernt. Bitte beachten Sie die Netiquette. Vielen Dank! Die Moderation
Anna Schneider
@Rasmuss Ich bin sehr offen für Argumente. Aber auf diesem (Ihrem) Niveau diskutiere ich nicht so gerne. Tut mir leid.
Peter Lorenz
@Anna Schneider Wer widerlegt es mit welchen Aussagen?
Frederik Nyborg
@Anna Schneider Sie haben das ganz offensichtlich nicht verstanden. Dann wollen wir mal differenzieren! Das mache ich extra für Sie, wie nett von mir: Wer Bildung und Vermögen besitzt, verfügt auch eher über die Ressourcen, sich Zugang zu einem gesunden, resilienten Lebensstil zu verschaffen. Arbeitet meist nicht in körperlich anstrengenden verschleißenden Berufen und kann sich insgesamt gesellschaftlich besser und gesünder positionieren. Wenn ich bspw. zu den Pflegekräften sagen würde, sie sollen auch mal weniger Überstunden machen und mehr joggen, dann fühlen die sich auch völlig zu Recht verarscht!
Paul Rabe
@Frederik Nyborg "Wer Bildung und Vermögen besitzt, verfügt auch eher über die Ressourcen, sich Zugang zu einem gesunden, resilienten Lebensstil zu verschaffen"
Dem möchte ich Widersprechen. Es ist NUR(!) die Bildung.
Vermögen ist dazu nicht notwendig.
Wer gebildet ist kann in Deutschland, weil unser Gesundheitssystem ausreicht, durchaus gesund leben.
natürlich gibt es schlecht bezahlte Berufe die gesundheitsschädlich sind, aber das scheint nicht der Hauptgrund für die Unterschiede zu sein.
Arbeitslose haben ja eine besonders niedrige Lebenserwartung, da scheint es nicht primär am gesundheitsschädlichen Beruf zu liegen.
Soziale und psychische Faktoren scheinen eine der Hauptursachen zu sein.
Ein gebildeter, armer, aber gesellschaftlich anerkannter Schriftsteller, mag eine höhere Lebenserwartung haben als ein gesellschaftlich nicht geachteter H4 Empfänger...
Frederik Nyborg
@Paul Rabe Der Zugang zu Bildung ist aber für Menschen mit Vermögen oder einem hohen und auch noch mittleren Einkommen wesentlich einfacher. Diese Interdependenz ist Ihnen sicherlich auch bekannt.
Paul Rabe
@Frederik Nyborg Der Zufang zu Bildung, bis zum Abitur, ist in Deutschland sehr günstig.
Das Wissen zu erhalten wie sich gesund zu ernähren, genügt im Zweifel zB auch ein Hauptschulabschluss.
Der soziale Umgang mag eher entscheidend sein, wer in eine gesunde Lebensweise von den Eltern eingeführt wird, der behält die bei.
Das ist aber, in Deutschland, keine Frage des Einkommens. Auch von H4 kann man sich Gemüse und ein paar Jogging Schuhe leisten
Frederik Nyborg
@Paul Rabe Die bereits gebildeten bzw. kakdemischen und mit einem besseren Einkommen ausgestatteten Haushalte bieten Ihren Kinder aber besseren Zugang zu Bildung, bessere Nachhilfemöglichkeiten, da die finanziellen und intellektuellen Möglichkeiten auch vorhanden sind usw. Die Aufstiegsmöglichkeiten aus einem bildungsfernen Haushalt sind in Deutschland im Vergleich zu anderen Industrienationen unterdurchschnittlich. Hier hat Deutschland noch sehr viel Nachholbedarf. Sie sollten auch die Infos von anderen Kommentatoren hier zur Kenntnis nehmen, bspw. Andreas J: "Experten des Landwirtschaftsministeriums haben erst vor kurzem veröffentlicht das eine Gesunde Ernährung mit 5,09 EUR pro Tag nicht möglich ist. Zudem belegen alle Zahlen das Reiche länger leben. Die Schuld, ganz nach neoliberaler Manier, einfach den Betroffenen in die Schuhe zu schieben, ist schon sehr daneben. Nix ist widerlegt!"
Paul Rabe
@Frederik Nyborg Es ist zum Beispiel Fakt dass die Zahl der Raucher in unteren Gesellschaftsschichten relativ gesehen höher ist und das obwohl rauchen ja sehr teuer ist.
Auch der Zucker Konsum ist dort höher.
Dafür werden dort, relativ gesehen, seltener Ausdauer Sportarten betrieben.
Das ist eine Frage des Lebensstils und der Erziehung aber keine Frage des Einkommens.
Anna Schneider
@Frederik Nyborg Das ist eben genau nicht wahr. Sondern eine ziemlich offensichtliche Ausrede. Ein gesunder Lebensstil ist keine Frage des Geldes. Dass z.B. selber kochen meist billiger ist als Dosenfr... ist doch längst errechnet worden. Und ihr Beispiel mit der Krankenschwester geht völlig fehl. Da müsste erst geklärt werden, ob Krankenschwester wirklich früher sterben als z.B. Manager mit 80 Stunden Wochen. Ich halte daher ihre Ausführungen für ziemlich unsinnig.
Oliver Koch
@Anna Schneider Selber kochen ist nur dann billiger, wenn man entweder für mehrere kocht, oder aber Möglichkeiten hat, viel zu kochen und dieses zu lagern. Z.B. einfrieren.
Ist das nicht der Fall, ist kochen viel zu teuer. Im Gegensatz zu einer Lebensmittelfabrik ist man als Hartz 4 Empfänger nicht von der Energieumlage befreit... Strom ist teuer.
Frederik Nyborg
@Anna Schneider Sie missachten die Bildung und dass der Zugang für Vermögende und die oberen Einkommensschichten deutlich erleichtert ist. Und Ihr Manager Mythos ist schon von Florian Engel ausführlich widerlegt!
Florian Engel
@Anna Schneider Nur um ein Detail Ihrer Argumentation aufzugreifen. Die 80 Stunden arbeitenden Manager sind ein - beliebter - Mythos. Das belegen Studien immer wieder. Und wo Manager tatsächlich 80 Stunden arbeiten, besteht ein Großteil dieses Arbeitens aus weder körperlich noch geistig anstrengendem Absitzen der Zeit. David Graeber hat das Problem in seinem letzten Buch zu Bullshit Jobs sogar auf eine breitere Basis gestellt.
Und generell geht ein geringeres Einkommen mit einem ungesünderen Lebensstil einher, das ist bewiesen allein schon dadurch wo man wohnt. Von Verkehr (Lärm, Abgase) belastete Gegenden ebenso wie der Industrie nahe Viertel sind günstiger weshalb sich besagte Krankenschwester dann eben nur dort einen Wohnung leisten kann, statt im Grünen oder am Wald. Anderes Beispiel, aus meiner eigenen Familie, die untere Mittelschicht darstellt. Die sind vor 5 Wochen im Ahrtal abgesoffen. Raten Sie bitte mal, wieviele Einkommensmillionäre da NachbarInnen waren. ;-)
Orwell1984
@Anna Schneider Ja dann schmeißen Sie doch mal mit Ihren Belegen um sich, die es dazu längst geben soll.
Anna Schneider
@Orwell1984 Verkürzt ist doch ihre Arguemtation: Ich bin arm, also muss ich mich von Chips und Bier ernähren.
Und diese ist definitiv falsch.
Ich kenne sehr viele Geringverdiener, die es sich leisten können und vor allem WOLLEN, abends noch in die Küche zu stehen, Kartoffeln zu schälen und Gemüse zu schnippeln.
Abdurchdiemitte
@Anna Schneider Nun bitte, in der Küche stehen, Kartoffeln schälen und Gemüse schnippeln müssen wir ja wohl alle, um satt zu werden, unabhängig von Einkommens- und Besitzunterschieden … und das Bild vom ausschließlich Chips und Bier verzehrenden H4-Empfänger ist ja auch nur ein Klischee, egal von welcher Seite es gestreut wird.
Allerdings finde ich in Ihren Kommentaren kein einziges Argument, das die Aussage widerlegt, dass ein Zusammenhang zwischen Einkommensunterschieden, gesundheitsförderndem Lebensstil und Lebenserwartung besteht - wie schon von Mitforisten moniert wurde.
Wobei mein Urgroßvater täglich eine Zigarre nach der anderen gequalmt hat und damit trotzdem genau 100 Jahre alt wurde … aber er war ja auch kein H4-Empfänger (Ironie).
sàmi2
@Anna Schneider "Ich kenne sehr viele Geringverdiener, die es sich leisten können und vor allem WOLLEN, abends noch in die Küche zu stehen, Kartoffeln zu schälen und Gemüse zu schnippeln."
Die gibt es sicher, aber sind die repräsentativ?
Sich was zu kochen und gesunde Lebensmittel einzukaufen, erfordert Wissen und Können. Wer in einem Umfeld aufwächst, in dem er das nicht lernt und in dem das Gegenteil normal ist, entwickelt einen entsprechenden Lebensstil. Das wird verstärkt durch Arbeitsbedingungen, die Erschöpfung verursachen und das Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühl beschädigen. Damit schwinden Fähigkeit, Kraft und Motivation, die eigene Lebensweise zu verändern. Die Vorstellung davon, dass es überhaupt anders gehen könnte und sollte, kommt vielleicht gar nicht erst auf, wenn man damit beschäftigt ist, einen schwierigen Alltag zu bewältigen.
Ihnen fällt es ja offenbar auch schwer, sich vorzustellen, dass es anders sein könnte, als Sie es kennen.
Paul Rabe
@sàmi2 Ich denke wir sind uns einig dass die Erziehung einen großen Einfluss hat, aber Erziehung ist primär eine Sache der Eltern und gar nicht so sehr vom Einkommen abhängig , oder?
Meine Eltern sind nach dem Krieg geflüchtet und waren komplett mittellos, Sie hatten absolut gar nichts!
Aber sie haben uns Kinder eine Erziehung mitgegeben wo sie viel Wert auf die typischen Kopf Noten gelegt haben (ja ich weiß, die sind nicht mehr so richtig Hipp)
Also habe ich persönlich mich mein Leben lang gesund ernährt, habe Sport getrieben etc. und es auch zu Zeiten wo ich selber, zum Beispiel Student, in der Statistik als „arm“ dagestanden habe.
Ja, dafür kann ich nichts, ich hatte das große Glück eine richtigen Erziehung. Aber dieses Glück hatte nichts mit dem Einkommen meine Eltern zu tun.
PS ich musste mir mein Studium komplett selbst erarbeiten, meine Eltern hatten kein Geld dafür.
miri
@sàmi2 "Wer in einem Umfeld aufwächst, in dem er das nicht lernt ..." -- es ist also wieder nur die Bildung! Ich bin auch mit wenig Geld, aber viel Substanz erzogen worden. Und sehe vor dem Sozialkaufhaus die 1-Euro-Jobbenden und Kund*innen stehen und -- rauchen... Ich glaube, fürs Rauchen wäre in meinem Elternhaus einfach das Geld nicht dagewesen.
Ja, ja, es wird schon gehen
@Anna Schneider Wie schön, dass Sie diese Menschen kennen und Sie so die von Ihnen angepriesene (aber immer noch nicht belgte...räusper, räusper) Studienlage verifizieren (a.k.a Alltagstheorie).
Dass ein Leben am/unter dem Existenzminimum vielleicht dafür sorgt, dass die Menschen ständig damit beschäftigt sind sich Sorgen machen zu müssen, die psychische Belastung also so hoch ist, dass da gar keine Zeit mehr bleibt, um sich über die eigene Gesundheit Gedanken zu machen, hat hier noch keine*r erwähnt. Zudem ist Mensch, der von Grundsicherung lebt damit beschäftigt ständig zum Jobcenter zu rennen, weil irgendein Nachweis fehlt, um irgenwann mal die Kohle, um sich die ungeschälten Kartoffeln leisten zu können, zu bekommen (und nein, zum Jobcenter rennen hat nichts mit Joggen zu tun!).
Also, freuen Sie sich für die Menschen in Ihrer Umgebung, die offensichtlich resilient genug sind es hin zu bekommen statt eine Differenzierung in Menschen die zu blöd sind und andere die beweisen, dass wir ein 'super' System haben, vorzunehmen. Die empirisch mehrfach widerlegte Figur des 'faulen Arbeitslosen' ist übrigens älter als das Sozialverrsicherungssystem.
Anna Schneider
@Ja, ja, es wird schon gehen Ich finde es eine ziemlich billige Ausrede zu sagen "ach ich habe so viele Sorgen, ich MUSS mich jetzt ungesund ernähren". Und dann noch die anderen auch noch dafür die Schuld zu geben. Und das gerenne zum Jobcenter vorzuschieben, grenzt schon fast ans Lächerliche. Was denken, sie wie es einem Normalverdiener mit 60 Stunden Woche aufwärts geht.
Außerdem habe ich nicht gesagt, dass die Menschen in meiner Umgebung repräsentativ sind. Da gibt es auch solche und solche. Aber es gibt eben auch solche, die mit wenig Geld sehr gesund und bewußt leben. Wahrscheinlich gesünder als so mancher Topmanager.
Daüberhinaus pflege ich nicht irgendwelchen pauschalen "Figuren". Alles was ich sage, dass "Armut" in Deutschland trotzdem eine gesunde Lebensführung möglich macht.
Wobei ich "Armut" in Deutschland ohnehin als seltsamen Begriff sehe. Wahrscheinlich wären 90% der Weltbevölkerung gerne so "arm" wie die "Armen" hier.
Ja, ja, es wird schon gehen
@Anna Schneider Naja, Sie dürfen das selbstverständlich finden wie Sie wollen.
Es geht doch nicht darum starren Kausalzusammenhängen zu folgen, die rein rational choice mäßig argumentieren, sondern eben auch darüber nachzudenken, dass es weitere Einflussfaktoren gibt.
Dann bin ich sehr froh, dass Sie keine "pauschalen Figuren" pflegen. Die machen das Leben für viele zwar einfacher, lohnen aber nicht, weil sie Misgunst schaffen.
Dass Argument, dass in Deutschland Arme im globalen Vergleich 'reich' sind, wurde hier auch schon an andere Stelle vorgebracht. Deshalb möchte ich von Stephan Lessenich "Neben uns die Sintflut" empfehlen. Er schafft es m.E. Reichtum und Armut global zu betrachten, ohne daraus ein Totschlagargument entgegen armer Menschen in D (oder anderswo) zu machen. Auch für Nicht-Soziolog*innen gut zu lesen. Allerdings muss ich zugeben, dass es nun auch schon gut drei Jahre her ist, dass ich das Buch gelesen habe.
Florian Engel
@Anna Schneider Ihnen ist schon klar, dass das knapp gesagt heißt: "Wer nur will, der kriegt das hin." Aber Gesundheit hängt eben nicht nur von Ernährung oder anderen, mindestens teilweise Entscheidungen eines bedingt freien Willens ab. Ich habe es zuvor geschrieben, Einkommen und Wohnlage hängen eng zusammen und damit auch Gesundheit. Und Ernährung wird sozialisiert, das zeigen z.B. Studien von Frerichs und Steinrücke, ebenso wie das Handeln in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen starken sozialisatorischen Voraussetzungen unterliegt, die wiederum immer noch sehr klassenspezifisch sind. Nicht mehr so ausgeprägt wie früher, aber nach wie vor wird in unteren und mittleren Einkommensschichten das "stärkende" Essen mit mehr Fleisch bevorzugt, obwohl die körperliche Arbeit häufig nicht mehr die Ursache dafür ist. Es trägt sich aber fort. Und diesen Menschen zu sagen "Ernährt euch halt besser" verkennt sowohl deren soziale wie persönliche Lage sowie die Macht der Herkunft. Und damit sind wir nicht mal beim Thema Geschlecht angekommen, das da natürlich auch wieder ne Rolle spielt - je nach Schicht oder Klasse - siehe Kaufmann: de.wikipedia.org/w...an-Claude_Kaufmann
warum_denkt_keiner_nach?
@Anna Schneider "Ich bin arm, also muss ich mich von Chips und Bier ernähren."
Bitte einfach mal ein paar Vorurteile über Bord werfen.
nanymouso
@Anna Schneider Keine Lüge so gut wie die, an der das meiste wahr ist...
Sie geben die Argumentation (un-)bewusst verfälsched wieder, um sie dann als falsch zu "entlarven".
Genau, wie der Artikel es auch beschreibt, ist vorallem "Überlebensstress" ein Lebensverkürzer. Und davon haben die schlecht bezahlten und oft befrisstet Beschäftigten viel mehr zu ertragen.
Nach einem Monat aus überlangen Tagen mit körperlich und psychisch anstrengender Arbeit gehen auch Sie weder im Wald Joggen noch aufwendig frische Ware einkaufen um sie dann genauso aufwendig zuzubereiten. Niemand gibt Ihnen in Ihrem Job mittags Zeit ausreichend, in Ruhe und gesund zu essen.
Abends sind Sie hungrig, müde, demotiviert. Sie wollen einfach nur noch satt sein und Ihre Ruhe haben. Was beides durch den Aufwand eines gesunden Lebensstils konterkariert wird.
Zur Ruhe kommen Sie trotzdem nicht, denn Kinder, die Sie sich bestenfalls mit ihrem ebenfalls arbeitendenden Partner (bei Reichen arbeitet ein Partner fast nie) teilen, müssen auch in ihrem Leben unterstützt werden. Kindermädchen? Fehlanzeige.
Außerdem ist Ihr Job anstrengender, weil Sie stets fürchten wegoptimiert zu werden. Ein Mensch in Führungsposition muss dann keine unmittelbare Zahlungsunfähigkeit fürchten, Sie schon. Sie leben jeden Monat für den nächsten Monat.
Das sind die Stressoren, die Sie als einfacher Mensch nicht abschalten können.
Wenn Sie diesen Ausführungen nicht glauben, dann sagt das nicht, dass sie nicht wahr seien, sondern spricht über Ihre eigene Unerfahrenheit.
lexi star
@Anna Schneider niemand außer dir hat gesagt, dass sich geringverdienende von chips und bier ernähren würden. daran zeigt sich eher was für eine hart klassistische weltsicht du hast
charly_paganini
@Anna Schneider Man muss verstehen, dass die Argumente zur eigenen Ideologie passen. Also, da oben die Bösen und unten die Guten. Sonst funktioniert für viele doch das eigne Weltbild nicht mehr.
Frederik Nyborg
@charly_paganini Wer im Glashaus des unterkomplexen Weltbildes sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen!
Wonneproppen
@Frederik Nyborg Reiche haben nicht selten eine 60-Stunden-Woche, Herzinfarkte und zwei, drei Scheidungen. Soviel zum gesunden Beruf. Fragen sie mal die Merkel, wieviel die schläft, oder Spitzenmanager.
Und der Vorredner hat Recht. 20€ Fitnesstudio, nicht rauchen und saufen, dafür joggen und Liegestütze sind für jeden drin. Gemüse ist sogar billiger als Fleisch oder Süßkram.
Kaboom
@Wonneproppen Offenkundig kennen Sie wirklich niemand aus dieser Bevölkerungsgruppe.
Wonneproppen
@Kaboom Von den Reichen oder Armen? Wie sind "die" denn so alle.
Frederik Nyborg
@Wonneproppen 60 Stundenwochen, Herzinfarkte und Scheidungen haben die unteren Einkommensschichten ebenso. Insbesondere wenn Sie noch schlecht bezahlte Nebenjobs benötigen, um die monatlichen Ausgaben zu stemmen. Und zum Schluss kommt halt die Bildung ins Spiel und dazu haben Vermögende und die oberen Einkommensschichten leichter Zugang!
Wonneproppen
@Frederik Nyborg Aha, am Ende unterscheiden sich die Menschen gar nicht so. Vielleicht spart man sich die Spaltung.. ähh Klassenkampf dann einfach? Jeder hat seine Probleme und mit irgendwelchen Bonzen will ich nicht tauschen. Bin nicht so der Neidtyp.
Frederik Nyborg
@Wonneproppen Es geht hier auch nicht um Neid, sondern um Bildung, Einkommen, Vermögen und Gesundheit. Ihr Versuch es auf Neid zu reduzieren ist doch etwas sehr vereinfachend und absichtlich ignorant.
Rasmuss
@Wonneproppen BILD bildet dir deine Meinung.
warum_denkt_keiner_nach?
@Wonneproppen "20€ Fitnesstudio, nicht rauchen und saufen, dafür joggen und Liegestütze sind für jeden drin."
Mal ein Blick in die Realität. Meine nicht besonders gut bezahlten Kollegen sind heute morgen aufgebrochen, um mehre hundert Kilo Schwere Schaltschränke an ihre Position zu wuchten. Danach müssen noch 240² Alukabel angeschlossen werden. Glauben Sie wirklich, die brauchen ein Fitnessstudio?
Gabriel Renoir
@Frederik Nyborg Das kann so sein. Ist aber kein Mechanismus. Ich kenne Menschen, die mit sehr wenig Geld leben, aber trotzdem gesund. Die das sogar als bewusste Entscheidung tun, lieber mehr Zeit als Karriere.
Ja, ja, es wird schon gehen
@Gabriel Renoir Aber das ist doch ein Unterschied, ob ich es mir 'leisten' kann mich dazu zu entscheiden weniger zu Arbeiten und mehr Zeit für was auch immer zu haben oder ob ich auf drei Jobs/ Hartz IV angewiesen bin, weil ich eben keine Rücklagen, kein Soziales Netzwerk, dass das trägt etc. habe.
Frederik Nyborg
@Ja, ja, es wird schon gehen Stimmt, aber leider wollen das manche Leute einfach nicht einsehen. Ich weiß nicht ob das Ignoranz, mangelnde Empathie oder die Sache ist, von der Einstein gesprochen hat im Kontext der Unendlichkeit...
Shasu
Man muss schon echt fragen, wieso vor allem die linken Parteien so wenig programmatisch bieten, wenn es darum geht soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen.
Besonders beeindruckend ist die Abnahme von sozialer Kompetenz bei den Grünen und der SPD zu beobachten. Die Grünen sind mittlerweile vollkommen weg von der Friedens-Öko-Partei der 80er, hin zu einer etwas grüneren CDU.
Und der SPD hat das ständige Regieren überhaupt nicht gut getan. Man hat so ziemlich alle sozialen Werte und Ansprüche über Bord geworfen, und umgibt sich heutzutage nur noch mit Worthülsen, was die Aufstellung eines Lobbyisten wie Scholz auch klar versinnbildlicht.
Es ist schade, aber wie so oft in der Geschichte, muss der Karren wohl erstmal richtig in den Dreck fahren bevor sich etwas ändert im Land der Glückseligen, wo 20% auf Kosten von 80% leben, und lachhafterweise durch Besetzung aller wichtigen Posten in Wirtschaft/Politik/Medien die Meinung weitestgehend vorgeben.
Rudi Hamm
@Shasu "wo 20% auf Kosten von 80% leben"
Erklären sie mir bitte, warum dann diese 80% trotzdem keine Partei wählen, die solche Umstände abschafft? Irgend etwas stimmt nicht an ihrer Aussage.
Shasu
@Rudi Hamm 30% wählen gar nicht, 20% wählen seit Jahrzehnten immer dasselbe aus Gewohnheit. Der Rest meint irgendwo dazuzugehören, und wählt wie es passt, weil ja jeder in Deutschland reich werden kann. Zumindest wäre das mein Tipp. ;-)
Abgesehen davon, es gibt keine Partei die die Umstände abschaffen würde. Alle die sich bis oben durchbeißen, werden solange geschliffen von Lobbyverbänden, negativer Berichterstattung, Negativ-Campaigning etc. pp. bis sie irgendwann mal "regierungsfähig" werden. Und solange sie nicht "regierungsfähig" sind wie z.B. Die Linke jetzt im Bund, und die Grünen in den 80ern, finden sie auch keine Koalitionspartner. Eine lose-lose-lose-Situation. :-D
Rolf B.
@Rudi Hamm Nun, das ist einfach erklärt.
Wer gegen seine eigenen Interessen stimmt, ist Opfer von Ideologie. Denn Ideologie ist nichts anderes als falsches Bewusstsein. Das hatte Marx schon vor weit über hundertfünfzig Jahren beschrieben. Ist also nichts Neues.
Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel:
Es hat Arbeitnehmer bei der Deutschen Bundesbahn gegeben, die sich heftig beschwerten über die sehr guten Tarifabschlüsse einer kleinen Gewerkschaft. Sie beschwerten sich aber nicht über ihre Dummheit, eine weniger gute Gewerkschaft zu unterhalten und keine Streikbereitschaft zu zeigen. Sie beschwerten sich ausschließlich über den viel zu guten Tarifabschluss.
Wonneproppen
@Shasu Soso, es wird was "vorgegeben". Also mich zwingt niemand, eine bestimmte Person zu wählen. Und als Parteimitglied bestimme ich direkt über Kandidaten, nicht Lobbyisten. Dass Firmen ihre Spitze selbst aussucht... Nun, wer sonst?
Medien.. Wie die TAZ?
Shasu
@Wonneproppen Natürlich wird es das. Wer macht die Themen welche groß öffentlich gespielt werden? Sie? Ich?
Soziale Ungerechtigkeit, der Abbau des Sozialsystems, die Fokussierung von Kapital auf einige wenige...das sind doch alles Themen, die nicht erst gestern in DE aufgetreten sind. Diese Probleme gibt es schon seit Jahrzehnten, und sie verschärfen sich von Jahr zu Jahr.
Aber statt diese Themen ständig zu pushen, und immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen, und damit die Politiker anzutreiben etwas dagegen zu tun, werden Nebenschauplätze thematisiert.
Aber klar, ich kann Ihnen gerne auch Beispiele für Themenmanipulation nennen. Falls Sie sich erinnern, gab es zu Beginn d. Jahres eine Maskenaffäre. Im gleichen Zuge kam dann auch eine Aserbaidschan-Affäre zum Vorschein. Das wurde ein paar Wochen thematisiert, und dann auf einmal wurde es überschattet von einem "Riesen-Streit" in der Union zw. Laschet und Söder wg. der Kanzlerkandidatur. Das wurde Wochen lang rauf- und runtergespielt, als wenn es überhaupt von irgendwelcher Relevanz wäre. Sie glauben dass das alles Zufall war? Gut, ich nicht. Resultat: Nach dem ganzen Unions-Geblubber hatten die meisten Leute die ganzen Affären vergessen.
Klar denke ich nicht, dass alle Themen vorgegeben werden. Aber heutzutage können Sie eine Medienagentur engagieren, damit diese gezielt ein Thema pusht (siehe Baerbock-Lebenslauf etc. pp.)
Und es gibt Medien wie Springer, die mit reißerischen Parolen auch versuchen die Stimmung in die eine oder andere Richtung zu lenken.
Aber die wirklich großen Probleme? Werden verhältnismäßig selten thematisiert.
Nilsson Samuelsson
@Shasu Engagieren Sie doch umgehend fuer die Linke, schon jetzt im Wahlkampf. Vor allem brauchen wie eine Regierung ohne CDU die ja permanent daran arbeiten, soziale Ungerechtigkeit zu verschärfen.
Gerhard Krause
@Nilsson Samuelsson Wir Schrumpfgermanen sind rund 75 Jahre neoliberal durchmanipuliert worden und daher leider wohl auch beratungsresistent.
Dämliche Bierweisheiten, wie zB "Man kann eine Mark nur ein Mal ausgeben.", bilden den Grundpfeiler ökonomischer Lernprozesse. Die Linke begreift's mE gleichfalls nicht in dem zumindest von mir gewünschten Maße.
Lieblich
@Nilsson Samuelsson Das ist das Thema: Veränderung braucht Akteure, und Parteien oder NGOs sind keine zuständigen Behörden, bei denen ich was einfordern kann.
Anna Schneider
@Shasu In Baden Württemberg sind die Grünen mit Kretschmann, Palmer und Özdemir nicht einmal mehr die grüne CDU. Sie SIND die CDU. Nur moderner.
Wonneproppen
@Anna Schneider Wenn man die als Konservativ ansieht, muss man selbst sehr, sehr weit links stehen.
resto
@Wonneproppen Anna Schneider hat völlig recht. Was, bitte schön, ist bei Kretschmann u. Co. links? Können Sie mir das sagen? Die Grünen sind in BaWü jetzt die Platzhalter, so wie es die CDU vorher war. Es handelt sich einfach um einen Kohortenwwechsel, wobei anteilsmäßig von den 60-69-Jährigen am meisten Grün gewählt wurde; bei den 18-24-Jährigen war es die FDP!!