Kommunist über 100 Jahre Kampf: „Die Jugend ist nicht scharf genug“
Der Kommunist Julius Christiansen hat kürzlich seinen 100sten gefeiert. Der Diskurs zum Ukraine-Krieg erschreckt ihn. An der DDR fand er vieles gut.
wochentaz: Herr Christiansen, wie wird man eigentlich 100?
Julius Christiansen: Das habe ich mich auch gefragt, denn keiner von meinen Bekannten hat geglaubt, dass ich so alt werde. Ich war ja nie ein Freund von Traurigkeit. Zwei oder drei Gründe hab ich: Einmal habe ich immer draußen gelebt, immer im Freien gearbeitet. Jahrelang bin ich den Sommer über mit meinem Boot durch die Gegend gefahren: frische Luft, Natur. Und dann wusste ich, wofür ich lebe. Das bilde ich mir heute noch ein: Was du getan hast, war das Richtige, auch wenn du manchmal Fehler gemacht hast und was einstecken musstest. Aber du hast für deine Kollegen was getan.
Was meinen Sie damit?
Wenn man eine Belegschaft von 700 Leuten hat, ein Jahr im Betrieb ist und dann derjenige ist, der von elf Betriebsräten mit den meisten Stimmen gewählt wird, weil ich bekannt war im Hafen, dann sagt man sich: Ach Gott, dann war doch nicht alles verkehrt, was du gemacht hast. Dieses Bewusstsein hat mir Kraft gegeben. Aber das Schönste ist: Ich habe 30 Jahre lang keinen Arzt gehabt. Alle zwei Jahre gehe ich zur Grundüberholung, lasse das Blut und das alles checken – aber ich nehme keine Tabletten, auch keine Schlaftabletten. Ich höre Radio.
Radio zum Einschlafen!
Ja, nachts um elf wache ich automatisch auf. Der Tag von heute, politisch gesehen, wird noch mal gesendet und dann kommen noch andere politische Sendungen. Ich schlafe zwischendurch mal ’ne halbe Stunde, höre das aber bis um sechs Uhr morgens.
Sind Sie noch in der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, aktiv?
Der Mensch
Julius Christiansen, 100, wurde in Hamburg geboren und lebt heute noch dort. Der Hafenarbeiter war sein Leben lang politisch aktiv, zunächst als Betriebsrat und in der IG Metall, später auch in der Friedensbewegung. Wie sich Klassengegensätze auswirken, hat er schon als Kind erlebt.
Die Partei
Nach dem Krieg ist Julius Christiansen in die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) eingetreten. Stalins Verbrechen waren ihm nicht so präsent – jedenfalls verblassten sie hinter dessen Verdienst als Sieger über den Faschismus. Die Wende 1989 betrachtet er aus Arbeitersicht als Niederlage. Noch heute nehmen ihn seine Genossen so ernst, dass sie ihn nicht in ihre Parteitagspapiere luschern lassen. (knö)
Beim letzten oder vorletzten Parteitag in Frankfurt wurde ich zwar nicht delegiert, aber ich wurde von den Senioren eingeladen. Als Gast saß ich oben auf dem Rang und konnte runtergucken. Unter mir saß die Gruppe aus Hamburg, die mich kannte. Da wurde denn der Antrag gestellt, ich sollte meinen Kopf zurückziehen, damit ich nicht in die Papiere gucken konnte.
Ganz schön krass!
Das ist ’ne Tatsache! Wir hatten hier ein paar Jungs in der Partei, die kamen von der Hochschule oder sonst woher, die hatten ganz andere Vorstellungen als ein Arbeiter. Die wurden immer moderner. Und ich sage: Wir müssen auch in den Gewerkschaften arbeiten, müssen uns für die Leute einsetzen. Da gab es einen Zwiespalt. Aber ich konnte den ganzen Tag zuhören, um meine eigenen Schlüsse zu ziehen.
Können Sie mit den Debatten, die heute in der DKP geführt werden, etwas anfangen?
Ich hab’ zu wenig Verbindung. Ich gehe nur noch zur Seniorengruppe der Gewerkschaften. Die Jugend ist entweder nicht scharf genug oder zu langweilig. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen anders wird, wenn die Bewegung gegen den Ukrainekrieg stärker wird. Ich habe das Gefühl, dass die Kundgebung von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer in Berlin ein Anfang war, dass da mehr kommt – so wie damals, als die Friedensbewegung hochkam und wir mit mehreren Hunderttausend Leuten in Bonn waren.
Was haben Sie gedacht, als Olaf Scholz im Bundestag vor einem Jahr die Zeitenwende ausgerufen hat?
Ich habe daran gedacht, dass wir im letzten Krieg eine ähnliche Zeit hatten wie heute. Die ganze Presse war voll: Wir müssen Krieg führen, wir müssen Waffen schicken. Dass ein Sozialdemokrat wie Olaf Scholz so von Waffen spricht und nicht das Wort Frieden in den Mund nimmt, dass er nicht versucht, irgendwas politisch zu lösen, hat mich erschreckt.
Aber Scholz hat doch bis kurz vor dem Einmarsch mit Putin verhandelt.
25 Millionen Russen sind umgebracht worden durch deutsche Panzer und jetzt schicken wir wieder Panzer dorthin. Das muss man sich mal vorstellen! Wladimir Putin hat in seiner Rede im Bundestag 2001 eine enge Zusammenarbeit angeboten. Die Amerikaner haben gemerkt: Hier bahnt sich was an, und fingen an, dagegenzuarbeiten. Und jetzt redet der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg davon, man müsse Russland besiegen. Die Töne sind doch genau die gleichen wie im Zweiten Weltkrieg. Vor dem Krieg gab es eine Ausstellung hier in Hamburg in der Spitaler Straße. Da wurde uns gezeigt, wie die Russen angeblich sind: Wie sie Kinder an den Beinen hielten und ihnen mit dem Krummschwert die Köpfe abschlugen.
Heute leben wir ja in einem ganz anderen Land.
Aber die Stimmung, die ist genauso, das ist es ja, was mich so wundert.
Es gibt keine Ausstellung, in der Russen Kindern die Köpfe abschlagen.
Ich habe mir in den letzten Tagen alle politischen Sendungen angesehen. Wenn da drei, vier Teilnehmer für Waffenlieferungen waren, gab es vielleicht einen, der Einwände hatte, und alle vier haben auf den einen eingedroschen. Und das war nicht eine Sendung, das waren Dutzende Sendungen.
Na ja, aber die andere Meinung kommt ja immerhin zu Wort im Unterschied zu Russland.
Dafür lief die Geschichte, wie grausam die Russen in der Ukraine gewesen sein sollen, auf allen Sendern. Ich höre Klaus von Dohnanyi, der miterlebt hat, wie die Verträge mit Gorbatschow ausgehandelt wurden, und weiß, was da besprochen wurde, aber das wird mit der Hand weggefegt. Mich hat gefreut, dass zur der Kundgebung von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer 15.000 Leute gekommen sind, trotz Regen und Schnee. Die Fernsehkamera hatte aber nur die Bühne ihm Auge. Sie hat nicht einmal geschwenkt, um die Massen zu zeigen. Krieg bringt keine Lösung!
Was soll denn im Fall der Ukraine geschehen? Die wehrt sich ja offensichtlich.

Was damit wird, muss man verhandeln. Ich bin dafür, dass die Menschen frei leben können. Dafür bin ich. Aber man muss dann auch eine Sicherheit haben, dass die Russen in der Ukraine frei leben können. Die Russen in der Ukraine wurden zuletzt sehr eingeengt.
Sie haben ja selbst als junger Mensch Krieg erlebt.
Ich war nicht direkt Angehöriger der Wehrmacht, sondern dienstverpflichtet als Experte und Seemann bei der Marine. Im März 1945 haben wir uns mit sechs Mann in Ostpreußen einen kleinen Schlepper genommen, sind nach Bornholm, von dort nach Schleswig rüber. Alles war kaputt. Da haben wir uns geschworen: Nie wieder Krieg, nie wieder! Hier in Hamburg habe ich mich dann für die Friedensbewegung eingesetzt.
Ihre Tochter hat erzählt, dass Sie gleich nach dem Krieg der Kommunistischen Partei beigetreten sind. Warum nicht der SPD?
Das hat den einfachen Grund, dass mein Vater Kommunist war. Er war in der KPD. Dadurch hatte ich schon Verbindung. Als die Nazis stark wurden, hielten die Jungs von den sozialdemokratischen und kommunistischen Eltern zusammen. Das war eine Gemeinschaft gegen die Nazis. Ich habe aber auch Literatur gelesen, mich schlau gemacht, und dann bin ich in die Kommunistische Partei eingetreten.
Wie war das dann als Kommunist in der Nachkriegszeit?
Nicht angenehm. Ich bin gleich in die Gewerkschaft eingetreten, in den Verband, der zum Hafen gehörte. 1951 haben die Schauerleute für eine Lohnerhöhung gestreikt. Es gab verschiedene Fachgruppen. Ich war zum Beispiel Wäger und Warenkontrolleur. Ich habe dann unsere Leute aufgefordert, dass wir uns solidarisieren mit den Schauerleuten, um gemeinsam zu kämpfen. Der Streik war gegen die Gewerkschaften, die sich dagegen ausgesprochen hatten. Drei Wochen lang haben wir gestreikt. Dann fing unsere Mehrheit an zu bröckeln, denn wir kriegten ja kein Streikgeld von der Gewerkschaft. Wir mussten sammeln, um den Leuten ein paar Groschen geben zu können. Aber man kann nicht mit einem Drittel der Belegschaft einen Streik weiterführen. Dann geht er kaputt. Am Ende haben wir entschieden, wir machen jetzt erst mal Schluss und versuchen, innerhalb der Gewerkschaften weiterzuarbeiten, aber da wurde ich aus der Gewerkschaft rausgeschmissen. Auch aus dem Gesamthafenbetrieb der Stadt wurde ich ausgeschlossen, aber ich war ein guter Facharbeiter und ein kleiner Privatbetrieb hat mich dann eingestellt.
Sie sind aus einem städtischen Betrieb rausgeflogen wegen des Streiks?
Ja, und nachher bin ich in die Deutsche Angestellten Gewerkschaft (DAG) eingetreten. Ich wollte organisiert sein. Ich kriegte Monatslohn und dachte, dann trittst du in die Angestelltengewerkschaft ein. In einem größeren Betrieb bin ich dann später in die IG Metall gegangen.
Das heißt, da spielte die Vorgeschichte dann keine Rolle.
Nee. Hier hängt eine Urkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft in der IG Metall. Dass ich die bekommen habe, ist ja auch schon bald 25 Jahre her. Ich bin heute noch Mitglied der IG Metall.
Kommen wir noch mal zurück zu der Zeit vor dem Krieg. Waren Sie in der HJ, der Hitlerjugend?
Ich musste, weil ich im Verein Fußball spielen wollte, Mitglied der HJ sein. Wir hatten eine Clique unten an der Elbe. Da waren wir in der Marine-HJ.
Was hat Ihr Vater dazu gesagt, dass Sie in der HJ waren?
Der hat gar nichts dazu gesagt. Wahrscheinlich hat er auch schon illegal gearbeitet, teilweise, und hat gedacht, lass den jungen Mann, das ist vielleicht ein bisschen Deckung. Im letzten Schuljahr hab ich ’ne Laufstelle gehabt, wo ich Schuhmacherzubehör ausfahren durfte. Um so eine Stelle zu bekommen, musste man zum Schuldirektor und sich das bestätigen lassen. Und da sagt der Schuldirektor: Wissen Sie, für wen Sie arbeiten? Ich sage. Nee, wieso, das steht doch da. Sagt er das, und wissen Sie, was das ist? Das steht Leon de Kohen. Das heißt Leon, der Priester! Das ist ein Jude. Das war mir scheißegal. Ich kriegte 4 Mark. Dafür war ich jeden Tag nach der Schule von 14 bis 18 Uhr unterwegs und auch sonnabends.
Ihre Familie war arm.
Dazu will Ihnen ein Beispiel erzählen. In die Schule gekommen bin ich am Sandberg, in der Nähe des Fischmarkts. Das war die ärmste Gegend Hamburgs. Da waren wir schon mit ausländischen Kindern zusammen, von Leuten, die in Hamburg gestrandet waren. Mein Vater war damals erwerbslos, wie viele andere. Von der Schule und der Kirche aus kriegten wir damals Zettel mit Namen. Damit durften wir zum Mittagessen gehen. Da haben Sie an so ’ner Villa geklingelt, und dann saß die Familie unten in dem großen Souterrain und guckte zu, wie Sie essen. Man muss sich vorstellen, was man da Kindern antut – obwohl es gut gemeint war von der Kirche und der Schule. Wir haben uns als Kinder auch geschämt, dass unser Vater hausieren gegangen ist, um seine Familie zu ernähren. Gummibänder und selbst geschriebene Kochrezepte hat er verkauft. Noch während des Krieges ist meine Mutter mit dem Waschbrett losgegangen und hat bei anderen Leuten gewaschen. Das haben wir als Kinder ja alles mitgekriegt.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Wussten Sie nichts von Stalins Verbrechen, als Sie in die KPD eingetreten sind?
Stalin, nein, das kam ja erst viel später im Kalten Krieg heraus. Stalin hatte den Krieg gewonnen. Er war für uns derjenige, der die Nazis zerschlagen hat. Zugleich wussten wir schon von den Juristen und Beamten, die Nazis waren und alle im Amt blieben. Den Vorarbeiter, der in der Partei war, den haben sie rausgeschmissen, aber die im Staatsdienst waren, die haben sie alle sitzen lassen. Und dann wurde ich in der Friedensbewegung sehr eifrig, habe hier im Hafen beim Friedenskomitee mitgearbeitet, auch in Bremerhaven. Das war auch in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde, gegen die Aufrüstung, gegen den Vietnamkrieg.
Gaben Ihnen die Aufstände in der DDR, Ungarn und der Tschechoslowakei nicht zu denken?
Wir waren der Meinung, dass das vom Westen gesteuert war. Ich hab ja damals auch Literatur gelesen, hab die Philosophen gelesen und so weiter. Da hatte man ein bisschen Ahnung, während man ganz am Anfang ja nur gefühlsmäßig und durch täglichen Beweis Kommunist geworden war. Das habe ich mir später angeeignet.
Waren Sie denn mal in Ostdeutschland oder überhaupt im Ostblock?

Da war ich noch höchstens zum Arbeiten. Ich wurde von meiner Firma aus hingeschickt, musste Getreide in Wismar und Stralsund kontrollieren. Ich habe da wochenlang gelebt und gewohnt, meistens im Seemannsheim.
Wie war Ihr Eindruck von der DDR?
Na ja, das war ein bisschen steif. Es war alles etwas anders wie hier: Rock ’n’ Roll und so was war nun nicht so öffentlich. Das kam uns zuerst ein bisschen komisch vor. Dafür haben wir zum Beispiel festgestellt, dass Kaffee in Dresden genauso viel kostet wie in Rostock. Jeder größere Betrieb hatte seine eigenen Betriebsärzte. Das Gesundheitswesen war wesentlich besser, das Schulwesen auch. Ich war zum Beispiel in acht verschiedenen Grundschulen, weil meine Eltern die Miete nicht bezahlen konnten und wir umziehen mussten oder weil die Schule überfüllt war. Jedes Mal andere Lehrer, jedes Mal anderer Unterricht. Das muss man sich mal vorstellen. Später habe ich mich gewundert, warum ich nicht einmal sitzen geblieben bin. Trotzdem war das eine Schande!
Wann sind Ihnen zum ersten Mal Zweifel gekommen, dass da was nicht stimmen könnte im Ostblock?
Zweifel direkt habe ich nicht gehabt. Ich habe wirklich gedacht, der Westen will jetzt nachholen, was er im Krieg nicht geschafft hat: Russland kaputtmachen. Die Westmächte wollten ja gar nicht mit den Russen zusammen gegen die Nazis ziehen. Die wollten ja, dass Russland alleine gegen Deutschland kämpft und kaputtgeht, damit die Nazis kaputt gehen, und die Russen auch.
Wie haben Sie den 9. November 1989 erlebt, den Mauerfall?
Scheiße, so hab ich gedacht. Jetzt geht es kaputt, jetzt müssen wir wieder neu anfangen!
Hätten Sie sich träumen lassen, dass die Mauer fällt?
Irgendwie habe ich gedacht, also gut, vielleicht bleibt die Partei bestehen oder die Menschen bleiben, aber das ist nicht gelungen. Der Westen hat die Menschen überzeugt, dass das kapitalistische Leben eben besser ist. Damit mussten wir uns abfinden als Kommunisten.
Haben Sie sich die DDR angesehen? Danach? Es ging ja ein bisschen darum, eine Bilanz zu ziehen, wie gut der „real existierende Sozialismus“ funktioniert hat.
Der hat ja gar nicht existiert, das war ein Versuch, der wurde ja noch gar nicht richtig vollendet. Mir hat gefallen, dass das, was ich als Arbeiter hier als schlecht erlebt habe, für die Arbeiter da drüben gut war. Die Mieten waren günstig, keiner durfte aus der Wohnung rausgeschmissen werden. Und ich fand auch gut, dass nicht die Kriegsgewinnler, die mit dem Zweiten Weltkrieg ihre Profite gemacht haben, nach dem Krieg wieder obenauf waren. Und heute ist es dasselbe: Wer verdient das Geld? Die Kriegsindustrie oder die Elektroindustrie. Und wir? Wir müssen erhöhte Mieten bezahlen.
Aber das Experiment DDR hatte sich totgelaufen.
Die haben da drüben gelebt, die hatten zu essen, und das hätte sich auch weiterentwickeln können. Da gab’s diese riesigen Konzerne nicht, die die Profite abgefischt haben wie hier – ich bin froh, dass sie 1989 nicht geschossen haben! Stellen Sie sich mal einen Bruderkrieg vor. Das wäre doch schlimm gewesen! Und jetzt haben wir das Gleiche, jetzt wird wieder geschossen. Das geht doch nicht allein um die Ukraine, sondern es steht Kapital gegen Kapital. Jeder will die größten Profite haben. So ist das in meiner Sicht.
Obwohl keiner Profit rausgezogen hat, ist ja die Infrastruktur verkommen. Die Straßen waren schlecht, die Betriebe veraltet.
Die hatten auch die Braunkohle, die Abgase und so weiter. Aber vieles war auch gut. Als Kapitalist würde ich sagen, der Sozialismus ist scheiße, aber als Arbeiter: Was hab’ ich zu verlieren?
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen








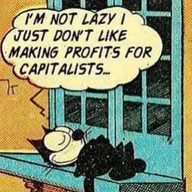






meistkommentiert
Nato-Gipfel
Europäischer Kniefall vor Trump
Wirtschaftsministerin gegen Klimaziele
Reiche opfert uns den Reichen
Soziale Kürzungen
Druck auf Arme steigt
Söder bei Reichelt-Portal „Nius“
Keine Plattform für Söder
Psychisch kranke Flüchtende
Konsequente Hilfeverweigerung
„Compact“-Urteil
Die Unberechenbarkeit von Verboten