Zoff in der Linkspartei: Linker Rosenkrieg
Seit Sahra Wagenknechts von der AfD bejubelten Rede im Bundestag herrscht offener Kampf in der Partei.
Die Explosion fand am Donnerstagvormittag vor einer Woche im Bundestag statt. Die Erschütterungswellen sind bis heute zu spüren. Für die Detonation sorgte Sahra Wagenknecht, die der Regierung vorwarf einen „beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen“.
Die Sanktionen würden die „deutsche Wirtschaft“ ruinieren. Die AfD applaudierte. „Sie haben recht!“ rief AfD-Fraktionschefin Alice Weidel begeistert. Die Hälfte der Linksfraktion blieb der Show demonstrativ fern. Die Linkspartei unterstützt eigentlich Sanktionen gegen Putin wegen des Ukrainekrieges. Nach Wagenknechts Tirade steht man wieder als Putins fünfte Kolonne mit AfD-nahen Postionen da.
Seitdem hagelt es Angriff und Gegenangriff, Austritte und Vorwürfe. Partei und Fraktion sind im Ausnahmezustand. Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und prominenter Genosse, gab sein Parteibuch zurück. Was Wagenknecht „vom Stapel ließ, war zu viel“, so Schneider.
Sein Austritt tut der Linkspartei derzeit besonders weh. Denn eigentlich will diese jetzt überall zusammen mit Sozialverbänden gegen die unbrauchbaren Entlastungspakete der Regierung demonstrieren. Ein Abgang zur Unzeit. Genauso wie der Streit um Wagenknecht. So richtig heiß sind in diesem Herbst bislang nur die internen Schlachten in Linkspartei und -fraktion.
Es herrscht Streit um fast alles. Auch darüber, was warum geschehen ist. Wieso durfte Wagenknecht, die in der Fraktion keine Funktion hat, in der im Parlament zentralen Haushaltsdebatte überhaupt reden? Dass Wagenknecht einen Feldzug gegen die Sanktionen führt, war bekannt, der Eklat absehbar.
KritikerInnen sehen die Verantwortung bei der Fraktionsspitze aus Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali. Beide hätten Wagenknecht als Rednerin gegen skeptische Einwände aus der Fraktion durchgesetzt. Bartsch widerspricht: „Der Vorschlag kam von den Haushältern und nicht von der Fraktionsspitze. Niemand hat in der Fraktionssitzung den Antrag gestellt, dass Sahra Wagenknecht nicht reden möge“, so Bartsch zur taz.
Offener Brief: Wir sind es leid“
Linke Abgeordnete, die schon damals das Kommende ahnten, haben das etwas anders in Erinnerung. Mohamed Ali habe jede Kritik lautstark abgeschmettert. Die Fraktionsspitze wollte diese Rede. Die einzige Bedingung war, dass Wagenknecht nicht wieder die Öffnung der Pipeline Nord Stream 2 fordern dürfe. Bartsch, eigentlich Reformer, hat schon vor Jahren ein Bündnis mit Wagenknecht geschlossen.
Manche linke Abgeordnete halten Wagenknecht für das größte Problem und Fraktionschef Bartsch, der der Eigenwilligen immer wieder den Rücken frei hält, mittlerweile für das zweitgrößte Problem der Partei. Es geht dabei um mehr, als um Wagenknechts Egotrip. Es geht darum, wer die Fraktion führen soll. Und wie lange es die noch gibt.
Der erste Protest nach dem Eklat im Bundestag kam von drei Landtagsabgeordneten aus dem Osten, Katharina König-Preuss aus Thüringen, Jule Nagel aus Sachsen und Henriette Quade aus Sachsen-Anhalt. „Wir sind es leid“, heißt ihr offener Brief. Ob es um die Aufnahme von Geflüchteten, die Coronapolitik oder um das Verhältnis zu Russland gehe, immer wieder schieße Wagenknecht quer.
Sie müsse aus der Fraktion ausgeschlossen werden, Mohamed Ali und Bartsch müssten als politisch Verantwortliche zurücktreten, so die Forderung. Ähnlich sieht es die Bundestagsabgeordnete Cornelia Möhring.
Den offenen Brief der drei Ostfrauen hat sie noch nicht unterschrieben, sie will erst sehen, was die Fraktionssitzung am kommenden Dienstag bringt. „Ich erwarte von der Fraktionsführung, dass Konsequenzen gezogen werden“, sagt Möhring zur taz am wochenende. So könne es nicht mehr weitergehen. Es gebe völlige „Führungslosigkeit der Fraktion“.
Christian Leye, früher Wagenknechts Büroleiter in NRW, heute Bundestagsabgeordneter, zählt zu der überschaubaren Unterstützergruppe, die Wagenknecht in der Fraktion noch hat. Die Rede war „politisch richtig und trifft einen Nerv in der Bevölkerung“, so der Linke aus Duisburg gegenüber der taz am wochenende. Man müsse „über Entspannung im Wirtschaftskrieg“ debattieren dürfen. Der AfD-Applaus ficht ihn nicht an: „Die NPD fordert auch den Mindestlohn. Sind wir deshalb jetzt dagegen?“
Das Blame Game hat begonnen
Die Wagenknecht-Anhänger sehen sich nicht als Brandbeschleuniger der innerparteilichen Krise, sondern als deren Opfer. „Es wird eine harte Linie gegen Wagenknecht und den Teil der Partei durchgezogen, der sich politisch dort verortet.
Angesichts des Tempos der Eskalation kann ich keine Prognose für die Zukunft abgeben“ so Leye. Also Spaltung der Fraktion? Das würde Leye „bedauern“, doch wenn es so komme, gehe es auf das Konto jener, die „den Ausschluss von Wagenknecht aus der Fraktion fordern“.
Wagenknechts Auftritt hat wie ein Katalysator gewirkt. Der Riss, der nun sichtbar geworden ist, geht tief. Die linke Anhängerschaft ist bei den Russlandsanktionen gespalten. Die eine Hälfte ist dagegen, die andere dafür. Viele WählerInnen im Osten haben Sympathien für eine putinfreundliche Haltung. Manche glauben, dass im Osten die Hälfte der Partei und auch der Landtagsfraktionen auf Wagenknechts Seite steht – wenn es hart auf hart kommt.
Möhring hält eine Trennung jedenfalls für besser, als einfach so weiter zu machen. „Lieber eine Linke Gruppe im Bundestag, die klare linke Positionen vertritt, als eine Fraktion, bei der niemand weiß, wofür sie steht“. Das Blame Game, wer an der möglichen Trennung Schuld ist, hat längst begonnen.
Die Konsequenzen einer Abspaltung wären schmerzhaft und hart. Falls Wagenknecht und ihre AnhängerInnen die Fraktion verlassen, würde die Linksfraktion im Bundestag zu einer Gruppe mit weniger Rechten und weniger Geld schrumpfen.
Schon drei Austritte reichen, damit die 39-köpfige Fraktion ihren Status verliert. Dieses Szenario wäre einmalig in der Parlamentsgeschichte, doch die Fraktionsführung spielt es schon durch. Welche juristischen Folgen hätte das? Wie viele MitarbeiterInnen könnte man in diesem Fall halten?
Kein zweiter Wagenknecht-Fall
Die Parteiführung steht bei alldem etwas hilflos an der Seitenlinie. Wagenknechts Auftritt hat Janine Wissler und Martin Schirdewan kalt erwischt. Sie hatten nach dem Bundesparteitag Ende Juni in Erfurt gehofft, die Streitereien erstmal eingedämmt zu haben.
Die Kampagne eines „heißen Herbstes der sozialen Proteste“ lief an, die Umfragen zeigten eine zaghafte Aufwärtsbewegung. „Gerade in diesen Zeiten braucht es eine starke Linke, vielleicht mehr denn je“, so Wissler gegenüber der taz am wochenende. Doch stattdessen beschäftigt sich die Partei mit sich selbst.
Die Kommunikation zwischen Partei und Fraktion ist wieder auf dem Nullpunkt angelangt. Für Donnerstag war eine gemeinsame digitale Sitzung der Parteispitze mit den Landesvorsitzende anberaumt. Auch die Fraktionsspitze war dazu geladen. Doch Bartsch und Mohamed Ali kamen nicht. Jetzt sollen sie erneut eingeladen werden.
Wie geht es nun weiter? Janine Wissler fordert: „Wer in Parlamenten für Die Linke spricht, muss die Positionen der Partei vertreten.“ Doch der Parteivorstand hat keine formelle Möglichkeit, das gegenüber der Fraktionsspitze durchzusetzen. Bei der Fraktionssitzung am kommenden Dienstag wollen manche Wisslers Forderung durchbringen. RednerInnen im Bundestag sollen dann die Parteiposition vertreten müssen – einen Fall Wagenknecht 2.0 soll es nicht geben.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.
Der öffentliche Zoff geht derweil munter weiter. Wagenknecht koffert Parteichef Schirdewan als „Fehlbesetzung“ an. Sie sieht sich in der selbst geschneiderten Rolle der Volkstribunin, während die „Parteifunktionäre in ihren Twitterblasen“ lebten. Katina Schubert, Vizechefin der Partei, kontert, Wagenknecht sei „offenkundig auf Zerstörung aus“. Der alte Spruch „Freund, Feind, Parteifreund“ war selten so treffend.
Der Streit dreht sich auch um die Frage: Was dürfen Linke sagen? Wo ist die Grenze des Erlaubten? Diether Dehm, Ex-MdB und treuer Vasall von Wagenknecht, hat diese rote Linie kürzlich mit Schwung übertreten, als er öffentlich eine Konkurrenzkandidatur bei der Europawahl 2024 forderte. Das sei „eindeutig parteischädigend“ und müsse „zwingend zum Parteiausschluss führen“, sagt Katina Schubert. In der Parteizentrale will man Dehm loswerden. „Wir prüfen unter Hochdruck einen Ausschlussantrag“, so Schubert.
Der Zoff hat tiefere Gründe. Es geht um die existentielle Frage, was die Linkspartei eigentlich sein soll. Eine Partei, die der AfD Konkurrenz macht – putinaffin und EU-skeptisch? Oder eine internationalistische, weltoffene und moderne Partei, die mit SPD und Grünen konkurriert?
Ausschluss, Fehlbesetzung, Zerstörung: Die Linkspartei hat bis jetzt jede Krise irgendwie überstanden, mit halbseidenen Kompromissen oder einfach aus Erschöpfung. Doch jetzt kann es anders kommen. Es ist offen, ob Bartsch mit dem Appell an die Einheit wie immer das letzte Wort haben wird. Seine Macht bröckelt. Besonders übel nehmen viele dem Fraktionschef seine Unfähigkeit zu begreifen, dass Wagenknechts Auftritt ein Fehler war. Sein Fehler. Ulrich Schneider begründete seinen Austritt intern auch damit, dass Bartsch Wagenknecht eisern weiter verteidigt. Und auch, wenn sich wieder ein Formelkompromiss findet – die Spaltung ist längst da. Die Frage ist, wer Schuld hat am Zustand der Linken.
In der Partei geht es aktuell zu wie in einer ruinierten Ehe: Man erträgt sich kaum noch gegenseitig, und wartet auf einen günstigen Zeitpunkt für die Scheidung. Oder ist die Angst, die Wohnung und das Auto zu verlieren am Ende doch wieder größer?
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
















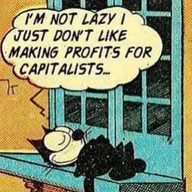

meistkommentiert
Neunzig Prozent E-Autos bei Neuwagen
Taugt Norwegen als Vorbild?
Rassismus der CDU
Merz will Doppelstaatler ausbürgern
Nach Unfällen zu Silvester
Scholz hält Böllerverbot trotz Toten für „irgendwie komisch“
Dreikönigstreffen der FDP
Lindner schmeißt sich an die Union ran
Merz’ neueste Abschiebeforderungen
Kein Ausrutscher
Regierung in Österreich
Warnsignal für Deutschland