Streitgespräch über Brandmauern: „Es gibt Schnittmengen zwischen Union und AfD“
Die AfD darf nicht in die Nähe der Macht gelangen, sagen die Politikwissenschaftler Thomas Biebricher und Christian Stecker. Doch wie verhindert man das?
taz: Herr Stecker, brauchen wir eine Brandmauer gegen die AfD?
Christian Stecker: Vorneweg: Die AfD beschimpft andere als Volksverräter und hat Sympathien für Putin und Orbán. Wenn sie die Mehrheit hätte, würde sie mit der Minderheit wohl nichts mehr demokratisch aushandeln. Deswegen sollte die AfD nicht in die Nähe von Regierungsmacht kommen. Aber die Brandmauer ist trotzdem falsch. Sie ist undemokratisch, weil wir nicht nur die Partei, sondern auch die Wähler ausschließen. Was man zur AfD sagt, sagt man auch ihren Wählern. Deshalb plädiere ich für einen differenzierten Umgang.
51, ist Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Uni Frankfurt. Sein Buch „Mitte/Rechts. Die internationale Krise des Konservatismus“ ist 2023 erschienen.
Christian Stecker, 46, ist Professor für Politikwissenschaft an der TU Darmstadt. Sein Buch „Ohne Koalitionskorsett und Brandmauern“ erscheint im Februar
taz: Und das heißt was?
Stecker: Demokraten dürfen mit der AfD kein Remigrationsgesetz verabschieden, das die Gleichheit der Staatsbürger unterminiert. Aber wenn man auch ablehnt, dass die Union mit der AfD die Grunderwerbsteuer senkt oder finanzielle Unterstützung beim Führerscheinerwerb beschließt – dann schließt man AfD-Wähler unverhältnismäßig stark aus. Sie haben weniger Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen. Das ist ein undemokratischer Verdachtsfall, wenn man es im Verfassungsschutzdeutsch ausdrücken will.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
taz: Herr Biebricher, ist die Brandmauer undemokratisch?
Thomas Biebricher: Nicht in diesem Sinn. Dass AfD-Wähler nicht in der Regierung repräsentiert sind, ist nicht so gravierend. Es gibt in parlamentarischen Demokratien kein Anrecht darauf, in der Regierung präsent zu sein.
Stecker: Der Ausschluss der AfD ist etwas anderes als der normale Ausschluss von Oppositionsparteien. Für Grüne und Linke gelten andere Spielregeln.
Biebricher: Stimmt. Aber diese Spielregel ist nicht undemokratisch. Es gibt viele historische Fälle, in denen Parteien ausgeschlossen wurden. In einer pluralen Demokratie können Parteien frei entscheiden, mit wem sie nicht zusammenarbeiten. Was aber stimmt: Es schadet der politischen Kultur, wenn auf die Dauer ein immer höherer Prozentsatz von Wählerinnen und Wählern keine Chance hat, ihre Parteien an der Regierung beteiligt zu sehen. Langfristig ist das eine ungünstige, eigentlich eine untragbare Situation. Eine Demokratie hält das nur begrenzte Zeit durch.
taz: Warum sind Sie trotzdem für die Brandmauer, Herr Biebricher?
Biebricher: Sie ist schlicht und einfach notwendig. Sonst wird die AfD normalisiert und kommt der Macht immer näher. Ist die Salonfähigkeit erst einmal verliehen, kann man sie nicht mehr zurückholen. Die Funktion des Gatekeepings, also dass bestimmte Positionen und Rhetoriken als inakzeptabel markiert werden, geht verloren. Aber die Brandmauer ist als Strategie im Umgang mit der AfD tatsächlich nur die am wenigsten schlechte Option. Die Kosten sind hoch. Die AfD bleibt etwa in einer bequemen Verantwortungslosigkeit. Es gibt keinen Anreiz, sich zu mäßigen. Götz Kubitschek …
taz: … ein rechtsextremer Verleger …
Biebricher: … sagt, dass die Brandmauer auch die AfD schützt. Da ist viel dran. Und die Bündnisse, die gegen die AfD geschlossen werden, sind oft sehr breit. Das schadet dem Profil der Parteien.
taz: Herr Stecker, Sie halten die AfD für genauso gefährlich wie Thomas Biebricher, sind aber gegen die Brandmauer. Was also dann?
Stecker: Ich glaube, dass es auch ohne Brandmauer gehen muss.
taz: Und wie?
Stecker: Wir müssen Regieren neu denken. Wir sollten Minderheitsregierungen mit wechselnden Mehrheiten ausprobieren. Das Koalitionskorsett, das wir heute haben, ist eine westdeutsche Erfindung aus den Fünfzigerjahren: hier Regierung, dort Opposition, streng getrennt voneinander. Das passte damals, in unser fragmentiertes Parteiensystem von heute passt es nicht mehr. Es beschleunigt den Niedergang der Volksparteien und steigert die Unzufriedenheit mit der Demokratie. Deutschland sollte sich an skandinavischen Ländern orientieren. Ein flexibleres Modell von wechselnden Mehrheiten würde den Zwang für die regierenden Parteien mildern, überdehnte Kompromisse zu machen.
taz: Die Union sollte also in einzelnen Fragen die Mehrheit mit der AfD suchen?
Stecker: Der Vorteil daran ist, dass es keinen Ausschluss der Wähler der AfD mehr gibt – ohne dass die AfD an der Regierung beteiligt werden muss. Ich plädiere unabhängig von der AfD schon lange für dieses Modell. SPD und Grüne hätten 2013 mit wechselnden Mehrheiten mit der Linken Bürgerversicherung und Reichensteuer durchsetzen können, also mehr Politik in ihrem Sinne.
taz: Also waren die gemeinsamen Abstimmungen der Union mit der AfD Ende Januar 2025 zur Migrationspolitik im Bundestag aus Ihrer Sicht richtig?
Stecker: Wenn man das desaströse Kommunikationsmanagement von Merz wegnimmt – ja. Die SPD hätte auch etwas davon: Sie müsste sich nicht mit der Faust in der Tasche auf Migrationskompromisse mit der Union einlassen und sich, wie beim Familiennachzug, in den Augen ihrer progressiven Wähler unglaubwürdig machen.
Biebricher: Eine Analyse im Auftrag der CDU kommt zu dem Schluss, dass die Abstimmungen mit der AfD der Union bei der Bundestagswahl geschadet haben. Das ist ein bekanntes Problem: Wer mit dem Rand Politik macht, verliert in der Mitte. Merz hat sich unglaubwürdig gemacht und Zweifel geweckt, ob die Absage an eine Zusammenarbeit mit der AfD weiterhin gilt.
Stecker: Kein Widerspruch. Es war falsch, wie es gemacht wurde. Die Union hat dadurch nichts gewonnen, aber die Linke gestärkt.
taz: Herr Biebricher, ist eine Minderheitsregierung, die mit wechselnder Mehrheiten regiert, eine gute Idee? In der Union liebäugeln ja tatsächlich manche mit dieser Option.
Biebricher: Ich habe Zweifel, dass das funktionieren würde. Das Modell wechselnder Mehrheiten wird schnell kollabieren. Wenn die Union mit der AfD abstimmt, werden SPD, Grüne und Linkspartei sagen: Wir spielen nicht mit.
Stecker: Es wird so sein, dass die SPD den Fall der Brandmauer als Mobilisierungsthema nutzen würde. Aber solche parteitaktischen Kalküle sollten Publizistik und Politikwissenschaften nicht hindern zu sagen: Wir möchten konstruktive Politik. In der Welt der Koalitionsdemokratie ist die Brandmauer notwendig. In einem System mit wechselnden Mehrheiten nicht.
Biebricher: Wenn die Union mit der AfD Gesetze beschließt und sich SPD und Grüne danach weigern, mit der Union gemeinsame Sache zu machen, dann wäre schnell Schluss mit den wechselnden Mehrheiten. Dann gäbe es de facto eine Duldung der Minderheitsregierung der Union durch die AfD. Für die AfD wäre das die ideale Konstellation. Denn: Beteiligt sich die AfD an einer Regierung, verliert sie den Anti-System-Nimbus. In dem Duldungsmodell nimmt sie politisch Einfluss, ohne Teil des Systems zu werden. Sie hat das Beste von beidem, von Opposition und Regierung. Man kann das in Schweden beobachten. Die rechten Schwedendemokraten tolerieren die bürgerliche Regierung und betrieben gleichzeitig Trollfabriken, die die Regierung unterminiert, die sie selbst zu stützen vorgeben.
Stecker: Es stimmt, die Duldung ist nur eine andere Form des Koalitionskorsetts. Ich plädiere für thematisch flexible Mehrheitsbildungen, an denen die AfD beteiligt sein kann. Die Union hätte zum Beispiel die rechte Migrationspolitik, die sie jetzt mit der SPD umgesetzt hat, mit der AfD umsetzen können. Die AfD hätte sich dann entscheiden müssen, ob sie auf ihren Extrempositionen beharrt und sich verweigert, oder ob sie Kompromisse eingeht.
taz: Wäre das eine gute Idee, Herr Biebricher? Manche in der Union glauben ja, dass sie in einer Minderheitsregierung mehr „CDU pur“ durchsetzen könnten.
Biebricher: Da klingt das rechte Narrativ an, dass es eigentlich eine rechte Mehrheit in der Bevölkerung gebe, aber die bekomme nur linke Politik, weil die Union wegen der Brandmauer in einer babylonischer Gefangenschaft mit linken Parteien stecke. Das lässt völlig aus dem Blick, dass es auch in der CDU mittige Milieus gibt, die nicht wollen, dass die Migrationspolitik noch härter wird, als sie jetzt schon ist, und die auch nicht wollen, dass Deutschland aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austritt. Außerdem würde ich stark anzweifeln, dass die Bundesregierung gerade linke Politik betreibt; wo denn?
Stecker: Ja, die Möglichkeiten der Union ohne Brandmauer werden von interessierter Seite maßlos übertrieben. Aber was stimmt: Die Wähler wandern derzeit stark nach rechts, die Politik folgt dem aber nicht in gleichem Maße. Kleine Anekdote: Horst Seehofer hat als Bundesinnenminister aus einem Gutachten des Verfassungsschutzes Passagen streichen lassen, die die AfD als verfassungsfeindlich markieren sollten, weil CSU-Politiker fast dasselbe gesagt hatten. Es gibt Schnittmengen zwischen Union und AfD. In einem Modell mit wechselnden Mehrheiten wäre es für die Union möglich, die AfD bei Themen wie Staatsbürgerschaft oder Migration zu Kompromissen zu zwingen und sie bei anderen Themen wie Putin oder der EU maximal zu konfrontieren.
Biebricher: Aber warum sollte sich die AfD zu Kompromissen zwingen lassen? Sie könnte die Union etwa in der Migrationsfrage doch weiter vor sich hertreiben. Ohnehin ist fraglich, ob es in einer Union-Minderheitsregierung wirklich mehr „CDU pur“ gäbe. Die Union hat dann zwar alle Ministerien besetzt, aber die Forderungen, die die anderen stellen können, werden sehr hoch sein. Jede andere Partei kann in jeder Situation sagen: Ihr habt keine Mehrheit, wenn wir es nicht mit euch machen, was ist dann los? Es ist auch zweifelhaft, ob das Modell wechselnder Mehrheiten, das in Dänemark funktionieren kann, für Deutschland, das außenpolitisch verlässlich sein muss, übertragbar ist.
taz: In Sachsen-Anhalt kann die AfD bei der Landtagswahl im Herbst so stark werden, dass sich alle anderen Parteien verbünden müssen, um eine Regierung ohne AfD zu bilden. Sollten die anderen Parteien, vermutlich unter Führung der CDU, das dann tun?
Biebricher: Das würde das Narrativ der AfD bekräftigen, dass sie vom System ausgeschlossen wird. Es gibt die Gefahr, dass sich eine rein destruktive Mehrheit zusammenfindet. Aber es ist notwendig, die AfD von der Regierung fernzuhalten. Denn wenn die CDU mit ihr zusammenarbeitet, öffnet sie ihr den Weg an die Macht. Wenn die Brandmauer einmal fällt, wird man sie nicht mehr aufbauen. Das ist eine irreversible Entscheidung.
Stecker: Wenn sich in Sachsen-Anhalt eine Allparteienkoalition gegen die AfD bildet, wird das die Parteiendemokratie, so wie wir sie kennen, nicht überleben. Die Brandmauer setzt in der Union, vor allem im Osten, enorme Fliehkräfte frei. In Sachsen-Anhalt gab es schon 2019 eine Denkschrift von CDU-Politikern, man solle das Nationale mit dem Sozialen versöhnen. Wenn die CDU mit der Linken zusammenarbeitet, werden diese Fliehkräfte noch stärker. Wenn drei, vier, fünf frustrierte CDU-Abgeordnete zur AfD wechseln, kann die AfD auch auf Umwegen zur absoluten Mehrheit kommen.
Biebricher: Übrigens würde der Entzauberungseffekt durch die Einbindung der AfD, auf den so viele setzen, nur eintreten, wenn die AfD tatsächlich allein regiert. In einer Koalition kann die AfD immer der anderen Partei die Schuld geben.
taz: Die Fliehkräfte in der CDU könnten aber auch in die andere Richtung gehen. Eine Annäherung an die AfD würde ein Teil der CDU in Westdeutschland nicht mitmachen. Riskiert die CDU, wenn sie die Tür zur AfD einen Spalt öffnet, ihre eigene Zerstörung?
Biebricher: Davon bin ich fest überzeugt. Wenn ein paar CDUler oder vielleicht auch die Fraktion in Sachsen-Anhalt mit der AfD zusammenarbeiten, vielleicht weil sie sich auch nicht mehr von der Bundes-CDU gängeln lassen will, kann es schwierig werden. In der Union gibt es zahlreiche Konfliktlinien, die dann aufbrechen können. Ob sich Ost gegen West, die Flügel, die Ministerpräsidenten, CDU und CSU, auch Jens Spahn und Merz auf eine gemeinsame Linie einigen würden, ist fraglich. Da könnte eine Dynamik entstehen, die die Partei zerlegt. Deshalb sind auch kleine Annäherungsmanöver an die AfD so gefährlich für die Union.
Stecker: Aber die Alternative einer Anti-AfD-Koalition wäre doch auch Selbstmord. Der neurechte Stratege Benedikt Kaiser sagt, die AfD müsse nur geduldig sein. Die Union werde in der nächsten ideologisch völlig überdehnten Koalition an ihren Widersprüchen zerbrechen.
Biebricher: Benedikt Kaiser hat nur recht, wenn die Lage bleibt, wie sie jetzt ist. Die Wahrnehmung der Bevölkerung kann sich ändern, wenn es mit der deutschen Wirtschaft wieder aufwärts geht und die Menschen das Gefühl haben, sie werden gut regiert. Ob und wann das gelingt, ist natürlich eine offene Frage.
taz: Die Union fährt in der Migration einen harten Kurs, die Zustimmungswerte der AfD steigen aber weiter.
Biebricher: Das zeigt, dass es sich für CDU und CSU nicht lohnt, unbedingt rechte Migrationspolitik zu betreiben. Objektiv gehen die Zahlen der Asylsuchenden nach unten. Aber es gibt keinen erkennbaren Effekt bei den Umfragen. Das muss zu denken geben.
Stecker: Viele AfD-Wähler fühlen sich von der Merkel-CDU betrogen. So wie die linken SPD-Wähler sich von Schröder durch die Hartz-IV-Gesetzgebung betrogen fühlten. Und für diesen Vertrauensbruch gab es aus Sicht dieser enttäuschten Wähler noch nicht einmal eine Entschuldigung.
taz: Der Historiker Andreas Rödder, selbst CDU-Mitglied, schlägt vor, die AfD mit einer begrenzten Einbindung zu spalten – in einen Teil, der mitregieren will, und Radikale, die ein anderes System wollen. Finden Sie das plausibel?
Biebricher: Nein. Das hätte vielleicht 2013 funktioniert. Da hätte man vielleicht die Spreu vom Weizen noch trennen können. Aber inzwischen ist der ganze Laden doch auf Höcke-Linie. Es gibt auch international kaum Beispiele, wo diese Taktik geklappt hat.
taz: Wo hat es sich für konservative Parteien denn ausgezahlt, Rechtspopulisten und Rechtsradikalen die Tür zur Macht zu öffnen?
Biebricher: Es gibt vor allem Gegenbeispiele. In Österreich, den Niederlanden und Italien kann man ziemlich gut zeigen, dass sich das letztendlich für die Konservativen nie gelohnt hat oder sogar ziemlich desaströs geendet ist. Italien hat die längste Erfahrung damit, dort geht es bis 1994 zurück. Und dort hat man wirklich eine beständige Hegemonieverschiebung nach rechts. Anfangs war die Forza Italia die stärkste Partei in diesen Bündnissen, dann die Lega, jetzt sind es die Fratelli d’Italia – wobei man sagen muss, dass die Fratelli bis dato vergleichsweise moderat agieren. Auch in Österreich gibt es diese Umkehrung: Da war die ÖVP am Anfang Seniorpartner – mittlerweile wäre sie nur Juniorpartner. Und in den Niederlanden hat man eine ähnliche Geschichte. Da hat man ein komplizierteres Parteiensystem, aber die Tendenz ist klar: Wenn man mit Geert Wilders Partei zusammenarbeitet, profitiert man eher nicht.
taz: Aber Geert Wilders Partei hat bei der letzten Wahl verloren.
Biebricher: Das stimmt. Aber die Parteien, die mit ihm zusammengearbeitet haben, haben noch viel heftiger verloren, teilweise sind sie ja ausradiert worden. Historisch ist es so: Wenn diese Parteien in der Regierung waren, gab es für sie danach meist eine kurze Delle in den Zustimmungswerten. So ging es der FPÖ nach der ersten Regierung unter ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel und auch der Wilders-Partei nach der ersten Regierungsbeteiligung. Aber mittel- und langfristig geht es weiter nach oben. Es gibt keinen Entzauberungseffekt. Sondern eine weitere Normalisierung.
Stecker: Die Debatte ist wissenschaftlich gesehen hochkompliziert. Wir reden über Ursache-Wirkung-Beziehungen in völlig unterschiedlichen politischen Systemen – und die Welt drumherum hat sich auch verändert. Als Politikwissenschaftler können wir das nicht genau sagen. Dafür wird ein bisschen zu laut erzählt, dass wir wissen: Wenn wir die Rechten einbinden, dann stärkt es sie.
taz: Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die die Zusammenarbeit in vielen europäischen Ländern untersucht hat, kommt aber zu einem recht eindeutigen Ergebnis: In maßgeblichen Fällen sei „eine ‚Zähmung‘ rechtspopulistischer oder gar rechtsextremer Parteien durch Kooperation nicht gelungen“. Geschwächt worden seien eher die Mitgliedsparteien der EVP. Warum überzeugt Sie das nicht?
Stecker: Meine Skepsis ist der Komplexität sozialwissenschaftlicher Forschung geschuldet. Die Staaten, Parteien und Zeiten sind so unterschiedlich, dass es weder zur Vorhersage für den Abstieg noch für den Aufstieg immer gültige Rezepte gibt.
Biebricher: Es stimmt natürlich, dass wir als Politikwissenschaftler mit Blick auf die Zusammenarbeit nicht hundertprozentig klar benennen können, was was bewirkt. Aber eine Kausalität liegt sehr nahe. Und deshalb sollten sich konservative Parteien ziemlich genau überlegen, ob sie mit Rechten zusammenarbeiten. Das ist in vielen Fällen sehr schlecht ausgegangen.
Unser Mittel gegen Antifeminismus
Wir machen linken Journalismus aus Überzeugung: kritisch, unabhängig und frei zugänglich für alle. Es gibt keinen Bezahlzwang, keine Paywall. Das geht nur, weil sich viele freiwillig beteiligen und unsere Arbeit unterstützen. Auch im Digitalen muss Journalismus, der für mehr Gleichberechtigung eintritt, finanziert werden. Unsere Leser:innen wissen: Journalismus entsteht nicht aus dem Nichts. Damit wir auch morgen noch unsere Arbeit machen können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Schon über 48.000 Menschen machen mit und finanzieren damit die taz im Netz - kostenlos für alle. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5 Euro sind Sie dabei. Jetzt unterstützen



















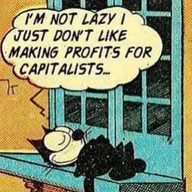


meistkommentiert