Wer ist die Letzte Generation?: Ungehorsam, aber zivil
Die Aktionen der Letzten Generation bekommen gerade viel Aufmerksamkeit. Wer engagiert sich da – und ist die Gruppe jetzt hierarchisch organisiert?
L ange hatte Lisa Reiche geglaubt: Wenn endlich richtig viele Menschen für mehr Klimaschutz protestieren, dann ändert die Regierung ihre Politik. Dann wird endlich etwas gegen diese Katastrophe getan. Am 20. September 2019, einem Freitag, verliert sie diesen Glauben.
Zusammen mit ihren Freundinnen nimmt sie an diesem Tag an der Klimastreik-Demo von Fridays for Future teil, die durch Berlin-Mitte zieht. Sie tanzt zu den Bässen, die von den Lautsprecherwagen dröhnen, und lacht, wenn sie auf einem der Schilder einen witzigen Spruch entdeckt.
17 Jahre ist Lisa Reiche damals. Sie freut sich, dass so viele Menschen in ihrem Alter auf dieser Demonstration sind, und so viele, die noch jünger sind als sie. Am Abend scrollt sie auf ihrem Handy durch die Nachrichten: Mehr als 250.000 Menschen allein in Berlin auf der Straße, über 1,4 Millionen in ganz Deutschland. Sie hat das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Es ist ein gutes Gefühl.
Doch als sie weiter scrollt, erfährt sie auch: Während die Demonstration durch die Straßen zog, verabschiedete der Koalitionsausschuss ein Eckpunktepapier für die deutschen Klimaziele bis 2030. Und egal, welchen Kommentar sie liest, alle sind sich einig: Die beschlossenen Maßnahmen sind nicht ausreichend, zu zaghaft, zu spät.
Geldstrafen werden oft privat getragen
„Ich habe mich damals so ohnmächtig gefühlt, so hilflos“, sagt sie heute, wenn sie sich an diesen Tag erinnert.
Jetzt, gut drei Jahre später, fühle sie sich nicht mehr ohnmächtig. Sie ist nicht mehr bei Fridays for Future aktiv, sondern Teil der Gruppe, die sich Letzte Generation nennt. Eine Gruppe, die momentan mit ihren Aktionen nicht nur mehr Aufmerksamkeit bekommt als jede andere der Klimabewegung, sondern die auch extrem schnell wächst: Anfang des Jahres bestand die Organisation nach eigenen Angaben aus gerade einmal 30 Aktivist:innen, heute seien es mehr als 700 bundesweit, fast 140 allein in Berlin.
Dabei wirkt es nicht besonders attraktiv, bei der Letzten Generation mitzumachen: Früh aufstehen, sich im Berufsverkehr mitten auf die Straße setzen, die Hand mit Sekundenkleber am Asphalt festkleben, sobald die Polizei kommt. Sich beschimpfen lassen, wegtragen lassen, in Polizeigewahrsam gebracht werden, manchmal für Tage, in Bayern auch für Wochen. Am vergangenen Donnerstag blockierten die Aktivst:innen die Start- und Landebahn des Münchner Flughafens, störten auch am Berliner Flughafen den Betrieb. Die Empörung war wieder groß.
Die Geldstrafen müssen die Aktivist:innen häufig privat tragen, anders als bei anderen Gruppen, wo dafür Unterstützung organisiert wird.
Dazu kommt: Die Letzte Generation ist hierarchischer organisiert, als man es sonst aus sozialen Bewegungen kennt, in denen Basisdemokratie eigentlich groß geschrieben wird. Welche konkreten Forderungen erhoben werden, wann wo welche Aktionen gemacht werden und wie diese medial vermittelt werden, bestimmt das sogenannte Strategieteam, eine Kerngruppe aus einer Handvoll Menschen, auf deren Zusammensetzung der Rest der Gruppe keinen Einfluss hat.
Und die Gruppe polarisiert stark: Aus allen Ecken hagelt es Kritik. Da ist ein rechter Mob, der sich unter dem Hashtag „Letzte Degeneration“ über Aussehen und Verhalten der Klima-Aktivist:innen lustig macht und die vielen Kommentare teilt, in denen in Medien von BILD bis FAZ gefordert wird, die „kriminellen Klima-Kleber“ zu verbieten. Da ist auch der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der die „Radikalisierung der Wenigen“ verurteilt, oder SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der den „Absolutismus“ der Gruppe kritisiert. Selbst in der Umwelt- und Klimabewegung wird heftig über die Letzte Generation gestritten: Nutzen sie der Sache, oder schaden sie ihr?
An einem Donnerstagabend im Dezember sitzt Lisa Reiche auf einer Bühne in einem Raum mit rosa Wänden, sie trägt einen grünen Kapuzenpullover und die rötlich gefärbten Haare offen. Reiche hält hier, in einem Nachbarschaftszentrum in Prenzlauer Berg, einen der vielen Vorträge, die die Letzte Generation in ganz Deutschland anbietet.
22 Menschen sind gekommen. Das Alter der Besucher:innen reicht von 16 bis Mitte 60, auch sonst ist es eine sehr gemischte Gruppe. Ein Mann mit langen Haaren und Vollbart, der sich in breitem Bayerisch über die Grünen aufregt. Eine junge, schüchtern wirkende Frau, die mit leiser Stimme von ihrer Angst vor der Klimakatastrophe erzählt. Ein Student Mitte 20, dem die Forderungen der Letzten Generation alle nicht weit genug gehen.
Die Vorträge sind wichtig für die Gruppe, darüber gewinnt sie neue Mitglieder: Wer möchte, kann am Ende seine Kontaktdaten abgeben und wird zu einem Aktionstraining eingeladen. Wer dort teilgenommen hat, kann bei den Straßenblockaden mitmachen.
Gut 20 Minuten spricht Reiche über das Ausmaß der Klimakatastrophe und über die schrecklichen Szenarien, die der Welt drohen. Man merkt, dass sie diesen Vortrag nicht selbst geschrieben hat, manchmal stolpert sie bei schwierigen Stellen, später wird sie die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen und lachen, voll peinlich, die Fehler.
Aber für den Verlauf des Abends ist das nicht wichtig. Wichtig ist, dass das Publikum nach dem Vortrag in Kleingruppen aufgeteilt wird, in denen zwei Fragen diskutiert werden: Was fühle ich, nachdem ich das gehört habe? Und: Wie kann ich mich einbringen?
Mehr als anderthalb Stunden diskutieren die Besucher:innen miteinander. Sie erzählen sich gegenseitig, wie es ihnen mit der Klimakrise geht, reden über Angst, Verzweiflung, Hoffnung, dazu wird eine Dose mit selbst gebackenen Keksen herumgereicht. Es werden Fragen zur Letzten Generation gestellt, kritische Fragen auch, die Reiche und mehrere andere Mitglieder beantworten. Sie betonen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, bei der Gruppe mitzumachen. Man muss sich nicht auf die Straße kleben, man kann auch für andere kochen. Am Ende geben fast alle Anwesenden die ausgefüllten Bögen mit ihren Kontaktdaten ab.
Lisa Reiche holt gerade ihr Abi nach, sie hat zuerst eine Ausbildung gemacht, wohnt jetzt in einem Hausprojekt und arbeitet als Einzelfallhelferin für Kinder mit Beeinträchtigungen. Sie ist ein Mensch, der starke Empathie für die Schwachen aufbringt, seien es kleine Kinder oder die Bewohner:innen der Teile der Welt, die am stärksten unter den Klimafolgen leiden.
Wenn sie über ihre Gefühle spricht, wird ihre Stimme etwas lauter. Sie erzählt davon, wie schrecklich sie sich mit ihren Privilegien fühlt. Die Letzte Generation hilft ihr gegen dieses Gefühl. „Ich hab total Hoffnung, dass es doch noch klappt“, sagt sie. „Weil wir es schaffen, dass alle darüber reden, und weil immer mehr Leute bei uns mitmachen wollen.“
Seit Anfang des Jahres ist Lisa Reiche bei der Letzten Generation dabei. Wenn sie Schulferien hat, klebt sie sich mit auf die Straße, aber sie will vor allem ansprechbar sein für die vielen Neuen, die in die Gruppe kommen. Um die „Bienen“, wie intern die Menschen genannt werden, die an den Aktionen teilnehmen und dafür teils Wochen oder Monate in eine andere Stadt ziehen, kümmern sich die „Gärtnerinnen und Gärtner“, die selbst nicht an Blockaden teilnehmen wollen: Kochen, psychologische Unterstützung organisieren, auch mal eine Auszeit. Fast jeden Abend gibt es in Berlin die Möglichkeit, gemeinsam zu essen, über die letzte Aktion und die nächsten Planungen zu sprechen, aber vor allem, sagt Reiche, darüber, wie man sich fühlt.
Gefühle – schlechtes Gewissen, Scham, Angst, Wut, Mitgefühl – sind für viele ein wichtiger Motor, das wird auch in Gesprächen mit weiteren Aktivist:innen deutlich. Viele von ihnen waren vorher bei Fridays for Future oder Extinction Rebellion aktiv, viele haben bereits heftige politische Enttäuschungen hinter sich, obwohl sie noch so jung sind.
Theo Schnarr gehört da schon zu den Älteren. Er ist 31 Jahre alt, Doktorand der Biochemie an der Uni Greifswald. Schnarr ist groß, Handballer, er trägt einen Vollbart und spricht mit ruhiger Stimme. „Meine Frau und ich, wir haben bisher ein richtig braves Leben geführt“, sagt er. „Schule, dann das Biochemiestudium, guter Abschluss, jetzt die Doktorarbeit.“
Als Naturwissenschaftler hat er sich schon früh mit dem Klimawandel beschäftigt, aber mit Aktivismus hatte er bis zur Letzten Generation keine Berührungspunkte. Im März ging Schnarr zu einem Vortrag der Gruppe in Greifswald. Vier Wochen später klebt er sich bei den Aktionen der Gruppe in Frankfurt am Main auf die Straße, kommt in Polizeigewahrsam, mehrmals, einmal fünf Tage am Stück.
„Nachdem wir den Vortrag gehört hatten, haben meine Frau und ich uns intensiv mit zivilem Ungehorsam auseinandergesetzt“, sagt Schnarr. Sie hätten sich mit den theoretischen Konzepten dahinter beschäftigt, Bücher gelesen, historische Beispiele mit dem verglichen, was die Letzte Generation heute macht. Am Ende seien sie beide zu dem Schluss gekommen, dass die Aktionen der Letzten Generation gerechtfertigt seien, unterstützenswert. Mit seiner Mutter, die im öffentlichen Dienst arbeitet, habe er durchgesprochen, was ein Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis für seine beruflichen Aussichten bedeuten könnte. „Aber ich finde es nicht schlimm, wenn ich bei einem Bewerbungsgespräch darauf angesprochen werde, denn ich kann ja gut begründen, warum ich an diesen Aktionen teilnehme.“
Früher, erzählt Schnarr, habe er in seinem Freundeskreis versucht, für das Thema Klimawandel und den eigenen Konsum zu sensibilisieren. „Ich war immer der, der vorgeschlagen hat, beim Grillen auf Fleisch zu verzichten.“ Unzählige Witze habe er sich darüber anhören müssen. Er sagt das ganz nüchtern, ohne Groll, aber mit einer klaren Bilanz: Weiter kam er so nicht.
Er, der fast sein ganzes Leben von einer großen Koalition regiert wurde, habe schon gehofft, dass sich mit der Ampelregierung etwas ändere, sagt Schnarr. „Es gibt ja auch ein paar Verbesserungen in anderen Bereichen, aber die Realität der Klimasituation wird einfach nicht anerkannt. Über die Klimaziele wird geredet, als wären das Fußballergebnisse: Tja, nicht geklappt, schade, aber kann man nicht ändern.“
Nur, sind die Aktionen der Letzten Generation die richtige Form, um das zu ändern? Wie sehen das jene, die sich schon länger mit Klimaprotesten beschäftigen?
Christoph Bautz ist ein wichtiger Mann in der deutschen Protestszene, ein Kampagnenprofi. Er baute Attac Deutschland mit auf und gründete 2004 die Nichtregierungsorganisation Campact, die politische Kampagnen zu verschiedenen Themen vorantreibt. Was meint er: Helfen die Aktionen der Letzten Generation oder schaden sie, weil sie so viel Wut und Unverständnis verursachen, sogar bei Menschen, die Klimaschutz eigentlich wichtig finden?
Bautz erzählt dazu eine Anekdote: Zur Bundestagswahl 2021 hatte Campact mehr als 5 Millionen Türhänger zum Thema Klimapolitik produziert, die sie vorher an Fokusgruppen testeten. Selbst bei Teilnehmer:innen „aus dem rot-grünen Milieu“ habe es ein klares Ergebnis gegeben: Alle Formulierungen, die die Klimakrise realistisch beschrieben, seien als „zu alarmistisch“ eingestuft worden. „Die Leute waren zwar für moderaten Klimaschutz. Aber wir haben gemerkt: Die Dramatik der Situation ist selbst in diesem Milieu noch nicht angekommen.“
Vor der Letzten Generation habe die Klimabewegung ein Problem gehabt, sagt Bautz: „Da gab es jahrelang ein Mehr vom Selben.“ Fridays for Future habe noch mehr Demonstrationen organisiert, Ende Gelände noch mehr Kohlegruben besetzt. „Aber leider nutzt sich das medial mit der Zeit ab, die Aufmerksamkeit schwindet.“ Erst die Letzte Generation habe es geschafft, wieder wirklich große Aufmerksamkeit für Klimaschutzforderungen zu erzielen.
Weder an den inhaltlichen Forderungen noch daran, dass sich die Letzte Generation für zivilen Ungehorsam als Aktionsform entschieden hat, habe er Kritik, sagt Bautz. Ihn beschäftige das Thema Vermittelbarkeit, die Frage, wo die Konfliktlinie gezogen wird: „Wenn sich die Letzte Generation im Berufsverkehr auf die Straße klebt, dann gibt es einen Konflikt mit weiten Teilen der Bevölkerung.“ Sich etwa vor das Verkehrsministerium oder die Parteizentrale der Grünen zu kleben, sagt Bautz, sei aus seiner Sicht der bessere Weg: „Das macht klar, dass der Konflikt nicht innerhalb der Bevölkerung verläuft, sondern zwischen Bevölkerung und Regierung.“
Während die Letzte Generation in der Klimabewegung am Anfang eher belächelt wurde, haben die heftigen Angriffe auf die Gruppe einen Solidarisierungseffekt erzeugt. Christoph Bautz verurteilt diese Angriffe scharf, spricht von „Kampagnencharakter“ und davon, dass es darum gehe, die gesamte Bewegung zu diskreditieren.
Bei Greenpeace sieht man das ähnlich. Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser sagt über die Angriffe auf die Letzte Generation: „Das ist eine Ablenkungsdebatte, die geführt wird, um nicht über die eigenen Versäumnisse sprechen zu müssen.“ Er teile die Anliegen der Letzten Generation: „Was mir fehlt, ist eine Reaktion der Ampelregierung, die sagt: Ja, die Gruppe hat einen Punkt, wir müssen jetzt dringend handeln, bevor es zu spät ist.“
Doch auch Kaiser macht einen Unterschied deutlich: „Greenpeace war und ist bekannt für spektakuläre und wirkungsvolle Aktionen des zivilen Ungehorsams, die immer am Ort des Geschehens stattfinden.“ Im Berliner Regierungsviertel demonstrieren, das Verkehrsministerium blockieren, die Kohlegrube besetzen: So läuft Protest normalerweise. Die Letzte Generation verfolgt eine andere Strategie, weil sie eine andere Vorstellung davon hat, wie Veränderung funktioniert.
„Uns geht es darum, permanent den Druck oben zu halten, konstruktive gesellschaftliche Spannung zu erzeugen“, sagt Carla Rochel, eine der Sprecher:innen der Organisation. Dass die Forderungen der Gruppe – ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, Tempolimit, 9-Euro-Ticket – viel weniger radikal sind als die Aktionsform, ist eine bewusste Strategie.
Der Gedanke: Je stärker die Störung ist, die die Gruppe erzeugt, und je umsetzbarer ihre Forderungen sind, desto weniger verständlich ist es für die Bevölkerung, warum die Regierung die Forderungen nicht einfach erfüllt.
Die Gruppe habe auch andere Protestformen ausprobiert, als sich im Berufsverkehr auf die Straße zu kleben, sagt Rochel. „Im Frühling haben wir Protestaktionen an Pipelines gemacht – es hat kaum jemanden interessiert.“ Ähnlich sieht es Theo Schnarr: „Mir macht das keinen Spaß, da auf der Straße zu sitzen und mich beschimpfen zu lassen, geschlagen zu werden“, sagt er. „Aber die Aufmerksamkeit, die wir jetzt bekommen, die für Veränderung notwendige gesellschaftliche Spannung, würden wir niemals kriegen, wenn wir uns stattdessen vor ein Ministerium setzen.“
Aber ist jede Aufmerksamkeit gute Aufmerksamkeit?
„Natürlich fühlt es sich skurril an, gefühlt das zwanzigste Interview dazu zu geben, welche Art von Sekundenkleber wir benutzen“, sagt Carla Rochel. „Aber es ist ja nun auch nicht so, dass die, die sich jetzt über unsere Aktionsformen empören, vorher die ganze Zeit über die Klimakrise geredet hätten.“ Dass in deutschen Wohnzimmern gerade so viel über die Letzte Generation diskutiert wird, findet sie gut: „Wenn es darum geht, ob das, was wir machen, legitim ist, geht es ja immer auch darum, ob das Ausmaß der Klimakrise diesen Protest rechtfertigt. Dann wird endlich über dieses Ausmaß gesprochen.“
Die aktuelle Debatte über die Letzte Generation zeigt auch, wie schnell das öffentliche Gedächtnis vergisst. Messerscharf wird gerade in vielen Artikeln eine Linie gezogen: Das ist guter Protest, das ist schlechter Protest.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Die Letzte Generation steht auf der Seite des schlechten Protests, andere Gruppen werden in das andere Feld einsortiert, etwa Fridays for Future. Wie erbittert noch vor wenigen Jahren, als die Organisation neu war, darüber diskutiert wurde, ob es legitim ist, dass Schüler:innen für das Klima die Schule schwänzen: Vergessen. So wie vergessen ist, welchen Anfeindungen die Anti-AKW-Bewegung jahrzehntelang ausgesetzt war.
Straßenblockaden als Protestform sind nicht neu, neu ist die Intensität und Ausdauer, mit der die Letzte Generation sie betreibt. Bei der Wahl der Blockadeorte zielen sie darauf ab, so viel Störung wie möglich zu erzeugen. Betrachtet man das Verhältnis der Anzahl der Aktivist:innen, die dafür benötigt werden, und die Aufmerksamkeit, die sie bekommen, ist das Ergebnis ein extrem effizienter Ressourceneinsatz.
Diese Effizienz hat ihren Preis: Wer bei der Letzten Generation mitmacht, hat wenig Mitspracherecht. Jeden Sonntag, erzählen die Aktivist:innen, gibt es eine Videokonferenz, an der alle Aktivist:innen teilnehmen können und in der das Strategieteam vorstellt, was als Nächstes geplant ist. Der Rest der Gruppe kann dazu Fragen stellen und Feedback geben, aber was mit diesem Feedback passiert, entscheidet das Strategieteam.
„Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sich den ganzen Tag Zeit nehmen, um über die nächsten Schritte zu beraten“, sagt Lisa Reiche. „Es gibt immer die Frage: Setzt du auf Effektivität oder auf möglichst flache Hierarchien?“, sagt Theo Schnarr. Ihm ist Effektivität gerade wichtiger.
„Wir tun alles für eine gute Feedback-Kultur“, sagt Carla Rochel, die zum Strategieteam gehört. „Aber wir haben leider bei anderen Organisationen gesehen, dass Basisdemokratie zu viel Zeit braucht, die wir nicht haben.“ Die Strategie der Letzten Generation ist avantgardistisch, auch wenn sie Forderungen hat, hinter denen Mehrheiten stehen. Es geht um Druck. Es geht nicht darum, Mehrheiten zu gewinnen, weil die Gruppe überzeugt ist, dass es diese längst gibt. Was ihre konkreten Forderungen angeht – 9-Euro-Ticket, Tempolimit – stimmt das. In Bezug auf die tiefgreifenden Veränderungen, die notwendig wären, um die Klimakrise zu bekämpfen, ist es mit den Mehrheiten nicht ganz so einfach.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, politischen Erfolg zu bemessen. Dass die Demonstrationen von Fridays for Future oder die Massenaktionen von Ende Gelände nichts bewirken, wie es bei der Letzten Generation heißt, greift zu kurz. Klar ist: Gerade schafft es die Letzte Generation besser, Spannung zu erzeugen. Sie ist erfolgreich, das macht sie attraktiv.
Das sehen auch andere: „Uns ist wichtig, an basisdemokratischen Strukturen festzuhalten und auf die Systemfrage aufmerksam zu machen, aber natürlich diskutieren wir über unsere Aktionsformen, wenn wir sehen, mit wie wenig Menschen es der Letzten Generation gerade gelingt, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen“, sagt eine Sprecherin von Ende Gelände der taz. Auch bei Fridays For Future heißt es, dass in der Gruppe über Aktionsformen diskutiert werde.
Bisher galt: Wer politisch etwas verändern möchte, braucht einen langen Atem. Wenn nächstes Jahr die drei letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden, sind mehr als 50 Jahre seit den ersten Anti-AKW-Protesten vergangen. Was die Letzte Generation gerade versucht, ist, eine Abkürzung zu finden. Wenn das nicht klappt, hat sie ein Problem: Kaum vorstellbar, dass sie die aktuelle Intensität ihrer Blockaden über Jahre aufrecht erhalten kann.
Und selbst wenn das gelänge, kämen auch hier die erbarmungslosen Mechanismen öffentlicher Aufmerksamkeit zum Tragen, für die ein Mehr vom Selben nicht funktioniert. Vielleicht findet das Strategieteam auch auf diese Herausforderung eine Antwort. Vielleicht hat es sich bis dahin längst gespalten. Vielleicht hat sich die Gruppe weiter radikalisiert.
Doch das sind Zukunftsfragen. Für Lisa Reiche und Theo Schnarr sind gerade andere Themen wichtig. Reiche will nächstes Jahr ihr Abi machen, gerade überlegt sie, ob sie danach anfängt zu studieren oder jeden Tag bei der Letzten Generation mitmacht. Sie tendiert zu Zweiterem.
Und Theo Schnarr fragt sich, ob er für die Aktionen der Gruppe auch richtig ins Gefängnis gehen würde. Davor habe er Bammel, sagt er. Aber er habe auch das Gefühl, sich in so einer Situation auf seine sozialen Beziehungen verlassen zu können. Es klingt, als sei dieser Schritt für ihn nicht ausgeschlossen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
















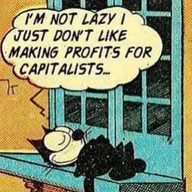










meistkommentiert
Israels Angriff auf den Iran
Völkerrechtliche Zeitenwende
Altersgrenze für Social Media
Das falsche Verbot
Wohnraumverteilung in Deutschland
Eine Seniorin, 100 Quadratmeter
Cannabis-Anbau
Söders Kampf gegen das Gesetz
Wiederaufbau der Dresdner Carola-Brücke
Vierspurig über die Elbe
Abbau von Mineralien
Schäden ins Ausland ausgelagert