Propalästinensische Demos am Wochenende: Freiheit der Andersdenkenden
Das Demonstrationsrecht ist ein Wert an sich. Auch Parolen, die die Mehrheit unerträglich findet, sind geschützt – gut so.
I n ganz Deutschland sind am Wochenende Palästinenser:innen und Unterstützer:innen auf die Straße gegangen, um gegen die israelische Militäroperation in Gaza und für ein freies Palästina zu demonstrieren. Unabhängig vom Inhalt ist es gut, dass diese Demonstrationen stattfinden konnten. Kurz nach den Hamas-Massakern vom 7. Oktober sah das noch anders aus. Damals wurden in vielen deutschen Städten propalästinensische Kundgebungen weitgehend verboten.
Das Demonstrationsrecht ist ein Recht der Minderheiten, daran muss immer wieder erinnert werden. Seine Garantie ist dort relevant, wo die Mehrheitsgesellschaft von „unerträglichen Parolen“ redet und Verbote fordert. Das Demonstrationsrecht schützt nicht nur nützliche Anliegen – wer soll das auch entscheiden? –, sondern ist in einer freiheitlichen Gesellschaft ein Wert an sich. Zivilgesellschaft, das sind nicht nur die „Guten“.
Natürlich führt ein liberales Demonstrationsrecht dazu, dass vor dem Brandenburger Tor oder dem Berliner Fernsehturm Parolen gerufen werden, die der deutschen Regierungspolitik diametral gegenüberstehen. Solche Bilder schwächen aber nicht die deutsche Staatsräson, die völlig zu Recht zum Schutz für Israel steht. Sie stärken vielmehr Deutschlands Glaubwürdigkeit im weltweiten Eintreten für Grundrechte.
Es ist doch peinlich, dass Außenministerin Annalena Baerbock vorige Woche in Aserbaidschan den Journalist:innen erklären musste, warum in Deutschland so viele Demonstrationen verboten werden, um anschließend wieder zu kritisieren, dass Aserbaidschan Oppositionelle unterdrückt.
Die Grenze ist das Strafrecht
Die Grenze für die Demonstrationsfreiheit markiert das Strafrecht. Das Rufen strafbarer volksverhetzender Parolen wie „Tod den Juden“ ist natürlich auch auf Versammlungen verboten. Wenn die Berliner Polizei aber bereits alle „israelfeindlichen“ Parolen verbietet, geht das zu weit. Bei Meinungsäußerungen ist das Strafrecht ohnehin stets eng auszulegen. Wichtig ist auch, dass bei den Prognosen, ob es zu Straftaten kommen wird, mit Augenmaß gehandelt wird. Es kann für ein Verbot nicht genügen, dass in der Vergangenheit bei einem anderen Veranstalter in einer anderen Stadt strafbare Parolen skandiert wurden.
Demonstrationen müssen in Deutschland nicht genehmigt werden, sie sind per se erlaubt. Verbote sind die absolute Ausnahme; in der Regel genügen Auflagen. Wenn hiergegen verstoßen wird, kann die Polizei ein volksverhetzendes Plakat beschlagnahmen und muss nicht gleich die ganze Kundgebung auflösen. So wurde an diesem Wochenende auch weithin in Deutschland verfahren. Ganz unabhängig vom Inhalt der Kundgebungen ist das ein Erfolg.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







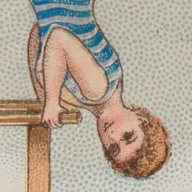












meistkommentiert
Wohnraumverteilung in Deutschland
Eine Seniorin, 100 Quadratmeter
Steigende Wohnkosten
Reich die Vermieter, arm die Mieter
Israels Angriff auf den Iran
Völkerrechtliche Zeitenwende
Wiederaufbau der Dresdner Carolabrücke
Kaputte Brücken sind Chancen
Altersgrenze für Social Media
Das falsche Verbot
Cannabis-Anbau
Söders Kampf gegen das Gesetz