Kopftuch für Lehrerinnen: Ende eines Kulturkampfs
Als letztes Bundesland muss Berlin Lehrerinnen mit Kopftuch zulassen. Dass Gerichte das wiederholt einfordern mussten, ist peinlich für die Politik.

D ie letzte Abwehrschlacht ist geschlagen, das Rückzugsgefecht verloren. Das Land Berlin darf seinen Lehrerinnen nicht pauschal verbieten, ein Kopftuch zu tragen. Das hatte das Bundesarbeitsgericht in Erfurt zwar bereits vor zweieinhalb Jahren festgestellt.
Doch die damalige Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) wollte das so nicht hinnehmen und reichte, unterstützt von der Rechtsanwältin Seyran Ateş, Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Diese Beschwerde wurde jetzt abgewiesen. Damit endet ein Berliner Sonderweg – und zugleich auch ein zäher und erbittert geführter Kulturkampf.
Der begann vor ziemlich genau 25 Jahren, als die deutsch-afghanische Lehrerin Fereshta Ludin in Baden-Württemberg nicht in den Schuldienst aufgenommen wurde, weil sie im Unterricht aus Glaubensgründen ein Kopftuch tragen wollte. Damit begann 1998, was als „Kopftuchstreit“ in die deutsche Geschichte eingehen sollte. Die rechtspopulistischen „Republikaner“ saßen damals noch im Stuttgarter Landtag und machten Druck, und die damalige CDU-Kultusministerin Annette Schavan gab sich betont hart: Das Kopftuch sei ein „Symbol des Islamismus“ und der „Unterdrückung der Frau“ und habe nichts in Lehrerzimmern zu suchen. Diese schrillen Töne sollten die Debatte fast zwei Dekaden lang prägen.
Es ging dabei meist um mehr als nur um das Kopftuch: Bei vielen „Islamkritiker:innen“ schwangen Verschwörungsfantasien von einer angeblich schleichenden „Islamisierung“ mit.
Mit seinem ersten Kopftuch-Urteil 2003 sorgte das Bundesverfassungsgericht für Verwirrung. Viele Bundesländer verstanden es als Aufforderung, gesetzliche Kopftuchverbote für Lehrerinnen einzuführen. Das Land Berlin ging sogar darüber hinaus und untersagte es allen Lehrkräften an öffentlichen Schulen, im Dienst irgendein religiöses Symbol zu tragen – egal ob Kopftuch, Kippa oder Kreuz am Hals. Erst zwölf Jahre später stellten die Richter:innen in Karlsruhe klipp und klar fest, ein pauschales Kopftuchverbot sei nicht mit der Religionsfreiheit vereinbar, die das Grundgesetz garantiert. Nur wenn der Schulfrieden bedroht sei, könne es im Einzelfall verboten werden.
Seither unterrichten in mehreren Bundesländern an staatlichen Schulen muslimische Lehrerinnen, die ein Kopftuch tragen. Der Schulfrieden wird dadurch nicht gestört – außer durch intolerante Eltern oder Kolleg:innen, die damit ein Problem haben. Die Schreckensszenarien haben sich nicht erfüllt, die moralische Panik war unbegründet.
Natürlich dürfen Lehrkräfte nicht missionieren. Das gilt aber nicht nur für muslimische Lehrerinnen und das war auch schon immer so. Bisher ist auch nicht bekannt, dass Schüler:innen beim Anblick eines Kopftuchs spontan zum Islam konvertiert wären. Ganz im Gegenteil: Wenn selbst Lehrerinnen ein Kopftuch tragen, dann taugt es nicht mehr als Zeichen des Protests, als Mittel zur Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft oder der Erwachsenenwelt. Durch seine Normalität wird das Kopftuch mehr und mehr entpolitisiert.
Fast alle Bundesländer erlauben Lehrerinnen inzwischen ein Kopftuch, wenn diese das wollen – alle, außer Berlin. Die Hauptstadt zahlte zuletzt sogar lieber Entschädigungen an Lehrerinnen, die sich diskriminiert fühlten, als ihr fragwürdiges „Neutralitätsgesetz“ abzuschaffen. Der Name ist geschickt gewählt, aber irreführend: Er verkehrt den Sinn staatlicher Neutralität in sein Gegenteil. Denn ein wirklich religionsneutraler Staat beschneidet nicht die Religionsfreiheit seiner Lehrer:innen und macht ihnen auch keine Bekleidungsvorschriften. Das hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt.
Im Berliner Sonderweg wirkt ein preußischer Staatsprotestantismus nach, der sichtbare Zeichen der Religiosität stets mit Argwohn beäugte. Im Kaiserreich richtete sich das gegen Katholiken, in der „Berliner Republik“ gegen Muslime. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass in Berlin – neben der AfD – nur noch die Partei mit dem „C“ im Parteinamen an dem Gesetz festhalten will. Es gefährde „den Frieden und Zusammenhalt“, wenn religiöse Symbole „in staatlichen Einrichtungen demonstrativ zur Schau gestellt werden“, kommentierte die Berliner CDU-Politikerin Cornelia Seibeld trotzig den Entscheid aus Karlsruhe. Die kirchenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus meinte damit natürlich nicht Weihnachtsbäume oder Osterschmuck, sondern das Kopftuch bei Lehrerinnen.
Dass Gerichte immer wieder auf Religionsfreiheit für alle pochten zeigt zwar einerseits, dass der Rechtsstaat funktioniert. Allerdings brauchten die Gerichte dafür viel Zeit. Und auf die Politik wirft das kein gutes Licht. Insbesondere christdemokratisch geprägte Landesregierungen trieben lieber populistische Gesetze voran, die muslimische Lehrerinnen im Namen einer vorgeblich christlichen „Leitkultur“ diskriminierten.
Und selbst im liberalen Berlin trauten sich nicht mal SPD, Linke und Grüne, das umstrittene Kopftuchverbot aus eigenem Antrieb abzuschaffen, sondern warteten lieber das Urteil aus Karlsruhe ab. Wer sich fragt, warum manche Muslime der deutschen Politik distanziert gegenüberstehen, könnte hier eine Antwort finden.
Der Kampf um das Kopftuch hat sich inzwischen von den Schulen auf andere Gebiete verlagert. Einige Bundesländer haben neue Gesetze eingeführt, die es Richterinnen, Staatsanwältinnen und sogar Referendarinnen untersagen, im Gerichtssaal ein Kopftuch zu tragen.
Das Kopftuch bleibt also auch weiterhin ein Reizthema – es ist heute aber nicht mehr das einzige Thema, das derartige Überreaktionen provoziert. Der Kampf gegen „Wokeness“, gegen „Cancel Culture“ und andere vermeintliche Auswüchse einer angeblich überbordenden „Identitätspolitik“ hat das Kopftuch inzwischen als Angstthema Nummer eins abgelöst.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










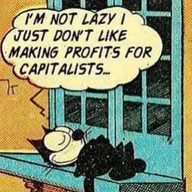

meistkommentiert