Palästinensische Häftlinge: Entlassen aus dem Gefängnis, das Männer bricht
Im Zuge des Geisel-Deals kamen auch fast 2.000 palästinensische Gefangene aus israelischen Haftanstalten frei. Freigelassene berichten von Folter.

Seine Geschichte erzählt Khalil so: In jener Septembernacht dieses Jahres, als das israelische Militär ihn festnahm, fuhr er mit seinem Lastwagen zum Grenzübergang Kerem Schalom. Die Augen zusammengekniffen, habe er versucht, die unbefestigte Straße vor seiner Windschutzscheibe auszumachen.
Er wollte in Kerem Schalom Hilfsgüter laden und sie zu einer Verteilstelle in Westgaza bringen. Das Steuern des Lastwagens über die Schotterpiste war mühsam, sagt er. Als er schließlich ankam, warteten bereits fünf Lastwagen vor ihm. Er reihte sich ein und wartete darauf, dass das israelische Militär die Genehmigung erteilte, den Grenzbereich zu betreten und die Güter – Kisten mit Zucker, Thunfisch, Nudeln – aufzunehmen.
Der Prozess sei Routine gewesen, erzählt er weiter. Doch in der Dunkelheit sei plötzlich eine metallene Stimme aus einem Lautsprecher ertönt: Er solle aussteigen und die Ausweise aller Fahrer einsammeln. Das Herz habe ihm in der Brust geschlagen, die Angst sei über ihn gekommen. Dennoch habe er die Ausweise eingesammelt. Wie weiter angewiesen habe er alle sechs Karten auf dem Boden abgelegt, etwa 100 Meter von den Lastwagen entfernt. Aus dem Augenwinkel habe er den Umriss eines Panzers gesehen, leise die Stimmen der Soldaten gehört. Die Minuten seien kaum vergangen. Schließlich habe ihn die Stimme aus dem Lautsprecher angewiesen, die Ausweise wieder einzusammeln. Doch es lagen nur noch fünf da.
Dieser Artikel wurde möglich durch die finanzielle Unterstützung des Recherchefonds Ausland e.V. Sie können den Recherchefonds durch eine Spende oder Mitgliedschaft fördern.
Da habe er bereits geahnt, dass etwas nicht stimmte. Er habe versucht, nachzufragen. Doch die Stimme aus dem Lautsprecher habe ihn angewiesen, still zu sein und die Waren auf seinen Lastwagen zu laden. Er habe damit begonnen, Kiste um Kiste. Dann habe die Stimme aus dem Lautsprecher seinen Namen gerufen, und den eines der anderen Fahrer, ein ihm unbekannter Mann.
Militante Palästinenser werden nun nach Ägypten deportiert
Dann sei die Anweisung gekommen, sich auszuziehen, die Hände hochzuhalten. In der Kühle der Nacht hätten er und der andere Fahrer ihre Kleidung abgelegt. Soldaten umringten sie, legten ihnen Handschellen an, verbanden ihnen die Augen. Dann kamen die Schläge, die Tritte. Eine lange Fahrt folgte, bis in gebrochenem Arabisch eine Stimme sagte: „Willkommen in dem Gefängnis, das Männer bricht.“ Wieder Schläge, Tritte, Beleidigungen. Und schließlich die Auflösung: Das israelische Militär hatte ihn in ein Gefängnis in der südlichen Wüste Negev verbracht.
Dass Khalil, der seinen echten Namen nicht veröffentlicht sehen möchte, nun seine Geschichte erzählen kann, liegt an dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas. In dessen Zuge kamen nicht nur alle zwanzig lebenden israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen frei, sondern auch fast 2.000 palästinensische Gefangene aus israelischen Haftanstalten.
Unter ihnen sind etwa 250, die wegen besonders schwerer Taten den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen hätten sollen: militante Palästinenser, die etwa während der zweiten Intifada Anfang der 2000er Jahre Terrorangriffe begingen oder dabei halfen. Viele von ihnen kehren nicht in den Gazastreifen oder das Westjordanland zurück, sondern werden deportiert, etwa nach Ägypten.
Unter den Freigelassenen sind aber auch über 1.700 Menschen aus dem Gazastreifen. Sie wurden nicht während des Überfalls militanter palästinensischer Gruppen in Südisrael am 7. Oktober 2023 festgenommen, sondern im Laufe des darauffolgenden Kriegs. Die meisten sind Männer, doch auch einige Frauen und Kinder sind unter ihnen. Viele wurden unter dem Titel des „unrechtmäßigen Kämpfers“ verhaftet.
Im Krankenhaus ist die Untersuchung schnell vorbei
Warum es ihn erwischt hat, versteht Khalil bis heute nicht, sagt er. „Ich arbeite als Lastwagenfahrer schon seitdem ich sehr jung war. Ich habe keine Beziehungen in die Politik. Ich kenne nicht mal den Namen des palästinensischen Premierministers.“
In Haft sei er immer wieder befragt worden, erzählt er: Wo sich Truppen der Hamas in Gaza versteckten, wo sich Tunnel befänden. Sie hätten ihm Bilder gezeigt von dem Haus, in dem er damals untergekommen war, in Südgaza. Und ihn gefragt, was er über die benachbarten Gebäude erzählen könne. Nichts, habe er geantwortet, er sei ja aus dem Norden vertrieben worden. Auch die anderen Fragen habe er nicht beantworten können, sagt er.
Nun, nach etwa einem Monat in Haft, ist Khalil wieder zurück im Gazastreifen. Am späteren Montag kommt er dort an, nachdem alle lebenden Geiseln aus Gaza freigelassen worden sind.
Khalil und die über 1.700 anderen werden zunächst in das Nasser-Spital in der Stadt Chan Junis in Südgaza gebracht. Bilder zeigen die Szenerie: Eine große Menschentraube begrüßt die Ankömmlinge, sie schwenken palästinensische Fahnen, manche halten Bilder ihrer vermissten Angehörigen hoch. Bewaffnete Männer in schwarzer Kluft und bis zu den Augen maskiert überwachen das Geschehen. Sie gehören wohl zur Hamas.
Der medizinische Check-up ist schnell vorbei. Zu groß ist die Masse der Menschen, die an diesem Tag nach Gaza zurückkehrt. Es wurde der Blutdruck gemessen, einmal gefragt, ob man Schmerzen habe – das sei alles gewesen. So erzählt es Khalil.
Seiner Familie möchte Khalil nichts erzählen
Seine Familie hat auf ihn gewartet. Gehofft, dass er aus der Haft zurückkehren möge. Doch nicht alle Angehörigen wüssten, ob ihre Lieben in israelischen Gefängnissen säßen oder tot seien, sagt Naji Abbas von der Nichtregierungsorganisation Physicians for Human Rights. Es sei die Linie des israelischen Haftsystems geworden, so gut wie keine Informationen über Gefangene herauszugeben. Selbst wenn israelische Anwälte ganz offiziell anfragten, erhielten sie oft keine Auskunft.
Khalils Familie wusste, wo er war: Die anderen Lastwagenfahrer hatten seine Verhaftung mitbekommen. In seiner Zeit im Gefängnis, erzählt Khalil, habe er Fürchterliches erlebt. Gewalt sei an der Tagesordnung gewesen, die Soldaten in ihrer Anwendung kreativ. So sei er mit gefüllten Wasserflaschen geschlagen worden, ins Gesicht, auf die Brust. Er habe Hunger gelitten, nicht duschen dürfen, sei misshandelt worden.
Tal Steiner vom Public Committee Against Torture in Israel, einem Verband, der sich gegen Folter einsetzt, sagt: Schon vor dem 7. Oktober 2023 seien die Bedingungen in israelischen Haftanstalten nicht einfach gewesen. „Aber willkürliche Gewalt war nicht normal vor dem 7. Oktober“, betont sie. Die Berichte der Gefangenen – über bewusstes Aushungern, physische und psychische Gewalt – seien alle ähnlich. Und Dutzende Häftlinge seien in den vergangenen beiden Jahren in israelischen Gefängnissen umgekommen, die taz dokumentierte zwei dieser Fälle.
Auch Khalil erzählt: Er sei an einen Punkt gelangt, wo er einfach nur noch wegwollte aus der Haft – egal um welchen Preis. „Das war kein Leben, sondern die Schlange zur Hölle“, sagt er. Mit seiner Familie, die ihn an diesem Montag wieder in die Arme schließt, will er nicht über das Erlebte sprechen, zu schlimm die Erinnerungen. „Niemand in dieser Welt hat mich beschützt“, sagt er, „kein Gesetz und keine Regierung.“ Bis, gewissermaßen, zu diesem Deal – der zumindest seine Haft beendete.
Hinweis: Im Text fand sich ein Fehler bei einem Pronomen. Wir haben das korrigiert.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen


















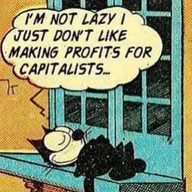

meistkommentiert