Fairer Kapitalismus: Gerechtigkeit ist machbar
Der Kapitalismus ist ein knallhartes Spiel – doch es könnte fairer laufen: mit einem globalen Mindestlohn und dem Ende aller Steueroasen.
Empfohlener externer Inhalt
An Sven selbst kann es nicht liegen, dass er so wohlhabend ist, denn er fährt ja den gleichen Bus wie Ram. Aber Sven hat das Glück, in Schweden zu leben, das in seinen Betrieben sehr viele Maschinen einsetzt. Von dieser gesamtwirtschaftlichen Produktivität profitieren auch Angestellte, die in kaum technisierten Berufen arbeiten. Also Busfahrer, Lehrer oder Pfleger.
Die Geschichte von Sven und Ram stammt von dem südkoreanischen Ökonomen Ha-Joon Chang, und sie erklärt gut, wie Länder zu Reichtum kommen. Sie müssen in ihre Produktivität investieren. Leider sind Maschinen teuer und lohnen sich nur, wenn menschliche Arbeitskraft noch teurer ist – wenn also die Löhne hoch sind. Im Globalen Süden sind die Gehälter jedoch meist kümmerlich, sodass es sich nicht rentiert, in Technik zu investieren.
Bangladesch ist ein gutes Beispiel: Dort sind rund vier Millionen NäherInnen damit beschäftigt, Kleidung für den Westen herzustellen. Sie sitzen an elektrischen Nähmaschinen – nutzen im 21. Jahrhundert eine Technik, die bereits im 19. Jahrhundert in Europa erfunden wurde. Theoretisch könnte man auch automatisierte Textilmaschinen aufstellen. Es ist kein Naturgesetz, dass Jeans per Hand geschneidert werden müssen. Aber diese Maschinen wären zu teuer, weil Arbeitskräfte in Bangladesch so billig sind.
Es wird schwerer die Industriestaaten einzuholen
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Rasante Entwicklung ist nur möglich, wenn der Staat einsteigt und die Industrialisierung zentral steuert. Ob Japan, Taiwan, Südkorea oder China: Sie alle sind in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen und haben den Westen eingeholt, weil ihre Regierungen die enormen Anfangsinvestitionen finanziert und geplant haben. Es war der Staat, der die Elektrizitätswerke, Hochöfen und Autofabriken in Auftrag gegeben hat.
Allerdings wird es für den Globalen Süden zunehmend schwer, die Industriestaaten einzuholen. Die Nachzügler sind mit einem neuen Problem konfrontiert: Durch den technologischen Fortschritt müssen die Fabriken ständig größer werden, um noch rentabel zu arbeiten.
Das lässt sich etwa an der Automobilindustrie gut zeigen: Die Pkw-Produktion ist so teuer, dass sie sich nur lohnt, wenn sehr viele Wagen gleichzeitig hergestellt und auf einem riesigen Markt abgesetzt werden. Die Chinesen sind also klar im Vorteil, weil sie über eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen verfügen. Da ist es noch möglich, Zollschranken zu errichten, um die heimischen Betriebe gegen die ausländische Konkurrenz zu schützen.
Staaten verharren nicht in einer vorindustirellen Zeit
Kleinere Länder hingegen können sich nicht abschotten, weil ihre Märkte nicht groß genug sind, und sitzen damit gewissermaßen in der Falle: Sie sind auf den weltweiten Freihandel angewiesen, damit ihre Produkte die nötigen Abnehmer finden – aber genau dieser Freihandel begünstigt die etablierten Industrieländer, die technologisch überlegen sind und Konkurrenz nicht fürchten müssen.
Aus diesen Problemen folgt nicht, dass der Globale Süden in einer vorindustriellen Zeit verharren würde. Der Kapitalismus prägt die gesamte Welt. Fast überall gehen jetzt auch Mädchen zur Schule, fast alle Kinder sind gegen Polio oder Pocken geimpft, und mehr als 90 Prozent der Menschheit sind an eine Wasserversorgung angeschlossen. Auch besitzen die meisten Erdbewohner ein Handy und haben damit Zugang zum Wissen der gesamten Welt. Der US-amerikanische Fortschrittsoptimist Andrew McAfee schreibt begeistert: „Ein Massai-Kämpfer mitten in Kenia verfügt heute über besseren Mobilfunk als der US-Präsident vor 25 Jahren.“
Der Globale Süden kann also wohlhabender werden – aber es ist fast unmöglich, den Norden technologisch und ökonomisch einzuholen. Um auf Bangladesch zurückzukommen: Das dortige Pro-Kopf-Einkommen lag 2020 umgerechnet bei 5.307 US-Dollar. Die Deutschen kamen auf 54.076 US-Dollar, sind also zehnmal so wohlhabend.
Das doppelte Gesicht des Kapitalismus
Der Kapitalismus hat ein doppeltes Gesicht: Konsumgüter verbreiten sich weltweit; überall sind Autos, Handys oder Sneaker zu haben. Doch daraus folgt nicht, dass diese Güter auch überall produziert würden. Stattdessen beliefern wenige Länder die gesamte Erde. Wie es der Historiker Jürgen Osterhammel einmal ausdrückte: „Industrialisierung ist kein ‚flächendeckend‘ globaler Prozess in Analogie zur Verbreitung des Fernsehens.“
Europa und die USA können nichts dafür, dass sie sich früh industrialisiert haben und es den Nachzüglern nun schwerfällt, technisch aufzuholen. Trotzdem ist der reiche Norden nicht gänzlich unschuldig daran, dass der Globale Süden arm bleibt, denn es gäbe durchaus Strategien, um den Entwicklungsländern beizustehen. Zwei Sofortmaßnahmen wären besonders wichtig.
Erstens: Es muss einen weltweiten Mindestlohn für Exportprodukte geben. Bisher werden die Beschäftigten im Globalen Süden gnadenlos ausgebeutet, sodass in Deutschland T-Shirts schon für 2,70 Euro zu haben sind – wobei auch ein Preis von mindestens 10 Euro die Bundesbürger nicht überfordern würde. Ein globaler Mindestlohn müsste tatsächlich für alle Länder einheitlich gelten, damit Bangladesch nicht gegen Kambodscha oder Laos ausgespielt werden kann.
Zweitens: Steueroasen müssen ausgetrocknet werden. Für die Mächtigen des Südens ist es bis heute möglich, ihr Land auszuplündern und das geraubte Geld im Norden zu verstecken. Ob Malta, Zypern, die Schweiz oder Großbritannien: Reiche Länder bieten ihre Dienste an, damit Potentaten ihre Untertanen bestehlen können. Hinzu kommt, dass die internationalen Unternehmen im Globalen Süden hohe Umsätze machen, aber die Gewinne nach Hause transferieren und nicht vor Ort versteuern. Auf diese Art finanziert der arme Süden den reichen Norden mit, obwohl es umgekehrt sein müsste. Zwar fließen jährlich etwa 150 bis 200 Milliarden US-Dollar an Entwicklungshilfe, aber weit mehr Geld strömt aus den armen Ländern zurück in die wohlhabenden Staaten, die Steuerflucht und Steuergestaltung erlauben.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
















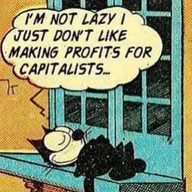

meistkommentiert
Missbräuchliche Geschlechtsangleichung
Reine Provokation
Elon Musk und die Start-up-Szene
Idol oder Igitt?
Waffenstillstand im Gazastreifen
Verhärtete Fronten
Fragen und Antworten zum Gaza-Abkommen
Droht jetzt der Frieden?
Ökonom zu Habecks Sozialabgaben-Vorstoß
„Die Idee scheint mir ziemlich unausgegoren“
Streit über Ukraine-Hilfen
3 Milliarden Euro gesucht