Kolumne Macht: Rassistisch, scheinheilig, Palmer
Wieder einmal äußert sich der Grünen-Politiker Boris Palmer rassistisch. Unsere Autorin verletzt das. Deshalb will sie dieses Mal nicht schweigen.

A n den regelmäßigen Boris-Palmer-Festivals habe ich mich bislang nur selten beteiligt. Zu kindlich wirkt das Streben des Oberbürgermeisters von Tübingen nach Aufmerksamkeit. Eigentlich sollte man ihm nicht den Gefallen tun, das zu bedienen. Aber dieses Mal hat er gewonnen, jedenfalls was mich betrifft. Ich bin zu wütend – nein, das stimmt nicht: Allzu verletzt bin ich, um zu schweigen.
Boris Palmer hat sich in die lange Reihe all derer gestellt, die – offen oder versteckt – versuchen, meine Tochter aus ihrer Heimat auszugrenzen und als „Minderheit“ zu definieren, seit sie vor 31 Jahren in Köln geboren wurde. Nora hat einen kenianischen Vater, folglich eine dunklere Hautfarbe als Herr Palmer.
Sie ist allerdings so deutsch wie er und hat einst in der Schule sogar den Dichter Ludwig Uhland durchgenommen, der in Tübingen geboren und gestorben ist. Ob Palmer das ihr gegenüber milder stimmen würde? Keine Ahnung. Was ich hingegen weiß: Ich bin diese Ausgrenzung unendlich Leid. Und sie hört nicht auf. Sie hört einfach nicht auf.
In einem Facebook-Post vor einigen Tagen hatte Palmer gefragt, was für eine Gesellschaft mit Fotos auf der Internetseite der Deutschen Bahn eigentlich abgebildet werden solle, die mehrheitlich Menschen mit Migrationshintergrund zeigten. Als die von ihm erwartete – und wohl erwünschte – Kritik über ihn hereinbrach, behauptete er, es sei diskriminierend, wenn Personengruppen wie beispielsweise alte, weiße Männer auf einer solchen Fotostrecke nicht gezeigt würden.
Scheinheilig und verlogen
Das ist scheinheilig und verlogen. Herr Palmer ist zu intelligent, um nicht zu wissen, wie Werbung funktioniert. Aber ich will mal so tun, als hielte ich ihn wirklich für so dumm, wie er sich stellt, und es ihm leicht verständlich erklären. Werbung will Aufmerksamkeit erregen, überraschen, manchmal belustigen, manchmal provozieren, manchmal sogar verstören. Werbung bildet nicht die Realität ab. Wer glaubt, dass sie das täte, muss ein niedliches Bild von den Regeln des Kapitalismus haben.
Übrigens eint alle von der DB abgebildeten Personen, so weit wir wissen, eines: Sie sind fabelhaft in diese Gesellschaft integriert. Ist es nicht genau das, was diejenigen immer fordern, die behaupten, Angst vor „Überfremdung“ zu haben? Das nützt Leuten gar nichts, die anders aussehen als die meisten hierzulande. Fremd bleibt fremd.
Ein Wort wie „Überfremdung“ würde Herr Palmer übrigens nie in den Mund nehmen. Er ist Profi. Deshalb formuliert er so, dass er genau richtig verstanden wird – von Freund und Feind – , ihm aber mit noch so genauer Sprachanalyse nichts nachgewiesen werden kann. Seine Posts sind demagogische Meisterwerke.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.
Jetzt behauptet er, wenig erstaunlich, er sei „falsch verstanden“ worden. Wie fast alle Rassisten, immerzu. Die Hautfarbe habe außerdem gar nicht er als wesentliches Merkmal eingeführt, das sei von anderen gekommen. An welches Kriterium hatte Boris Palmer denn gedacht, um Menschen „mit Migrationshintergrund“ zu erkennen? (Übrigens ist „Migrationshintergrund“ gar nicht so leicht zu definieren. Aber ich möchte es für den Oberbürgermeister auch nicht zu kompliziert machen. Also lasse ich das mal so stehen.)
Meine Tochter arbeitet seit einigen Jahren in London. Bis vor drei Tagen hatte sie noch nie von Boris Palmer gehört. Die vermutlich ultimative Kränkung für jemanden wie ihn, da dürfte auch kein Uhland helfen.
Eine SWR-Korrespondentin findet die ganze Aufregung übertrieben und empfiehlt: „Macht Euch mal locker, Leute!“ Sagt sich leicht. Ich werde mich nicht locker machen in dieser Frage. Und bin jedem und jeder persönlich dankbar, die das auch nicht tut.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










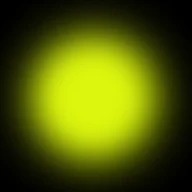






meistkommentiert
Hybride Kriegsführung
Angriff auf die Lebensadern
Kinderbetreuung in der DDR
„Alle haben funktioniert“
BSW in Koalitionen
Bald an der Macht – aber mit Risiko
Dieter Bohlen als CDU-Berater
Cheri, Cheri Friedrich
Niederlage für Baschar al-Assad
Zusammenbruch in Aleppo
Sport in Zeiten des Nahost-Kriegs
Die unheimliche Reise eines Basketballklubs