Zur gegenwärtigen Schwäche der Linken: Marx war gestern
In der Krise mobilisiert die Rechte die Unzufriedenen im Land. Sie hat die soziale Frage gekapert. Dabei hat sie überhaupt keine Antwort. Ein Essay.

D ie soziale Frage ist zurück. Nicht als abstrakte Debatte, sondern ganz real. Die einen stellen den Joghurt bei Aldi nach dem Blick auf das Preisschild wieder ins Kühlregal, andere verzichten auf den Schwimmbadbesuch mit der Familie oder den Jahresurlaub. Millionen Menschen sind arm, und die Abstiegsangst reicht bis hinein in die Mittelschicht aus Doppelverdienerhaushalten.
Empfohlener externer Inhalt
Doch die Krise trifft nicht alle gleich. Unternehmen machen Extraprofite, DAX-Vorstände streichen Rekordlöhne ein. Die Klassenfrage ist zurück.
Die Erkenntnis ist nicht neu. In der globalen Banken- und Wirtschaftskrise ab 2007/08 gehörte es bis ins konservative Establishment fast schon zum Allgemeingut, Karl Marx zu rehabilitieren, „Das Kapital“ fand reißend Absatz, und der FAZ- Feuilletonchef Frank Schirrmacher bekannte: „Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat.“
Genutzt hat es freilich wenig: Die Krisenkosten zahlten wie immer im Kapitalismus die Armen, und als makaberer Höhepunkt gründete sich als Folge der Eurokrise ab 2010 die Alternative für Deutschland.
Wenig sozial klingender Slogan
Im Jahr 2022 hat noch niemand in der öffentlichen Debatte Marx ausgegraben, im Gegenteil: die Rechte ist dabei, Angst und Wut der Menschen zumindest in Ostdeutschland erfolgreich zu kapern. An diesem Samstag startet die AfD ihre „Sozialkampagne“ unter dem wenig sozial klingenden Slogan „Unser Land zuerst“ mit einer Demonstration in Berlin.
Schon in den vergangenen Wochen haben rechte Netzwerke im Zusammenspiel mit der AfD jeden Montag Zehntausende im Osten auf die Straßen mobilisiert: Zuletzt, am Tag der deutschen Einheit, waren es mehr als 100.000 in 235 Städten. Die Rechtsex-tremismusexpertin der Linken im sächsischen Landtag sprach bereits von einer „faschistischen Massenbewegung“.
Viele Teilnehmer:innen treibt zwar die Angst vor dem sozialen Abstieg, doch thematisch stehen die Kritik am Establishment, an der Coronapolitik, an den Medien, an USA und Nato sowie die Zuwendung zu Russland im Vordergrund. Von linken Akteuren erhoffen sich die Demonstrierenden, die durchaus auch aus bürgerlichen Kreisen stammen, keine Antworten.
Dabei schien es doch Gesetz: Wo Klassengegensätze so offen wie jetzt zutage treten, wo es soziale Absicherung und Teilhabe zu erstreiten gilt, ist die Linke tonangebend. Das war schon immer ihre historische Mission, doch heute hechelt sie hinterher. Zwar schießt nahezu täglich ein neues linkes Sozialbündnis aus dem Boden, doch die Massen der Betroffenen erreicht die Linke nicht: Nicht in den großen, liberal oder links tickenden Städten, nicht im Westen; schon gar nicht aber kriegt sie ein Bein da auf den Boden, wo die Rechten besonders stark sind: in der ostdeutschen Provinz.
Spezifisch ostdeutscher Trotz
Der AfD ist es in den Jahren ihres Bestehens gelungen, beträchtliche Teile der Arbeiterklasse an sich zu binden. Bei der vergangenen Bundestagswahl wählten sie insgesamt 10,3 Prozent, aber 21 Prozent der Arbeiter:innen – nur 5 Prozent von diesen stimmten für die Linke. Im Osten hat sich die AfD als Volkspartei etabliert, und es gelingt ihr, einen spezifisch ostdeutschen Trotz gegen die sich rasant verändernde Welt zu bestärken.
Mit einer sozialen Agenda hat das wenig zu tun. In der Partei und ihrer Programmatik sind marktradikale Lösungen tonangebend. Der besonders im Osten verankerte rechtsextreme Flügel um den Thüringer Partei- und Fraktionschef Björn Höcke spielt sich zwar mitunter als soziales Gewissen der Partei auf, tickt aber vor allem nationalistisch.
So sagte Höcke schon 2016 bei einer Demonstration in Schweinfurt: „Die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten, unten nach oben, jung nach alt oder alt nach jung. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen.“ Die Antwort der Rechten auf soziale Krisen ist, die unteren Klassen gegeneinander auszuspielen, anhand von Herkunft, Pass und auch von Leistungsprinzipien.
Dass viele Menschen diese Spaltungsversuche nicht zurückweisen, liegt auch daran, dass die AfD und ihre Verbündeten erfolgreich die Systemfrage besetzt haben. Die Unzufriedenen sehen in ihnen das Vehikel für ihre Ängste und Wut, für ihre Gegnerschaft zu einem System, das keinen ausreichenden Schutz verspricht.
Die Rechte setzt aufs Identitätsgefühl
Schlussendlich ist es dann egal, ob sich soziale Ängste aus dem Zuzug von Flüchtlingen, Corona oder jetzt Inflation und Energiepreiskrise speisen. Die Rechte ist immer da, um diese Ängste abzugreifen, setzt erfolgreich auf das Identitätsgefühl eines unverstandenen und wirtschaftlich immer noch abgehängten Ostens und verstärkt den latent vorhandenen Rassismus und Sozialchauvinismus in der Bevölkerung.
Konkrete Forderungen, die die Lebenssituation der Menschen verbessern würden, sucht man auf den rechten Demonstrationen vergebens. Dabei befürworten drei Viertel der Deutschen, dass der Staat für eine Verringerung der Unterschiede zwischen Arm und Reich sorgt, genauso viele halten eine Vermögenssteuer für gut oder sehr gut, wie aus einer jüngst veröffentlichten Umfrage der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht.
Von der organisierten Rechten sind solche Vorschläge nicht zu hören, im Gegenteil: Die AfD setzt laut ihrem Programm auf Eigentum und Eigenverantwortlichkeit, Deregulierung, verbindliche Höchststeuern und die Schuldenbremse.
Doch die Netzwerke aus den Anti-Flüchtlingsprotesten von 2015 und jenen gegen die Coronamaßnahmen tragen auch die aktuellen Straßenproteste. Schon ein Aufruf gegen „die da oben“ in rechten und verschwörungsideologischen Telegramgruppen – es gibt allein 20 mit über 100.000 Mitgliedern, dagegen keine einzige linke in dieser Größenordnung – reicht aus, um die Menschen zu Protesten zu motivieren. Das gilt zumindest für den Osten und dort vor allem für die Klein- und Mittelstädte, wo Prekarität und Abstiegsängste weiter verbreitet, Löhne und Vermögen deutlich geringer sind als im Westen – und die demokratische Kultur schwächer ausgeprägt.
Direkten Kontakt verloren
Die Linke dagegen hat den direkten Kontakt zu jenem Teil der Bevölkerung, der sich selbst als „normal“ definiert, also als nicht privilegiert, überwiegend verloren. Die letzten linken Sozialproteste, gerade auch in eben jenen ostdeutschen Regionen, fanden 2004 als Montagsdemonstrationen gegen den Sozialabbau der Hartz-Gesetze statt.
Auch damals schon versuchten Rechte, letztlich aber eher erfolglos, diese Proteste für sich zu kapern. Doch seitdem hat sich die Linke als Ganzes sowohl von dem Thema als auch von dieser Klientel entfernt, ja tritt jenen, die nicht all ihre Glaubenssätze teilen, nicht selten mit Verachtung entgegen.
Man muss kein Sahra Wagenknecht-Fan sein, um zu konstatieren, dass weite Teile der Arbeiter:innenschaft die gesellschaftliche Linke vor allem über Themen wahrnehmen, die sie nicht als ihre dringendsten Sorgen begreifen. Anders als Wagenknecht, die ihrerseits aufs Ausspielen setzt, wäre es aber die Aufgabe der Linken, die Klassenfrage mit allen weiteren Ausgrenzungsfragen zu verbinden.
Bei einigen der außerparlamentarischen Linken, die sich nun zumindest in den größeren Städten zu neuen Sozialbündnissen zusammenfinden, kann man fragen, wieso sie sich erst jetzt der Verteilungsgerechtigkeit widmen. Auch die vergangenen 20 Jahre ging es in Deutschland nicht gerecht zu, lebten Millionen Menschen und fast jedes vierte Kind in Armut, war die Unfähigkeit des kapitalistischen Systems, Grundbedürfnisse der Menschen dauerhaft zu befriedigen, offensichtlich. Zu selten gelang es linken Initiativen wie etwa der Berliner Mietenbewegung, konkrete soziale Themen massentauglich zu formulieren.
Die Klassenfrage
Die Klassenfrage ist als eines von vielen linken Themen kaum wahrnehmbar gewesen, soziale Forderungen waren etwa bei der Klimabewegung zu oft nur Anhängsel. Stattdessen lässt sich die gesellschaftliche Linke durch von rechter Seite angefeuerte kulturelle Debatten treiben. Weit verbreitet und von rechts geschürt ist dabei die Wahrnehmung, dass linke Kämpfe um Identität und Anerkennung nicht das System infrage stellen, sondern vom Establishment integriert werden und dessen Macht festigen.
Angesichts dieser höchst brenzligen Situation wird sich die Linke einer Selbstkritik stellen müssen. Dann bietet sich immerhin die Chance, aus den Fehlern zu lernen. Die soziale Frage muss im Verbund mit der ökologischen ins Zentrum rücken – ohne dass dies eine Abwertung von feministischen oder antirassistischen Perspektiven bedeutet. Es braucht die gemeinsame Perspektive der Nicht-Privilegierten, eine Perspektive, die in der Forderung nach Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums ihren zentralen Ausdruck findet.
Vielleicht ist es noch nicht zu spät, die soziale und die Klassenfrage so zu besetzen, dass sich die rechte Hegemonie auf den Straßen nicht verfestigt. Schließlich braucht es darauf echte Antworten.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










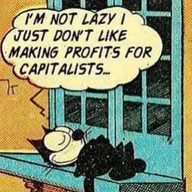



meistkommentiert
Konsequenzen der Messerattacke
Weder „Remigration“ noch Bleiberecht für alle
AfD-Wahlkampfauftakt in Halle
Bier, Bratwurst, Rassismus
Proteste gegen Rechtsextremismus
Etwa 100.000 Menschen für Vielfalt auf der Straße
5 Jahre Coronavirus
Was von der Pandemie übrig blieb
Christian Drosten
„Je mehr Zeit vergeht, desto skeptischer werde ich“
Brandmauer in sächsischen Kommunen
In Sachsen bröckelt’s