Ökonom über ungerechtes Rentensystem: „Es geht um Umverteilung“
Weil Beamte länger leben, sollen sie auch länger arbeiten: Die Forderung des Ökonomen Matthias Günther polarisiert. Hier erklärt er seinen Vorstoß.
taz: Herr Günther, hatten Sie in den letzten Tagen viele Beschwerde-Mails von Beamten im Postfach?
Matthias Günther: Ich habe reichlich Mails bekommen und man kann klar erkennen, welche von Beamten stammen und welche von Nicht-Beamten.
taz: Ihr Vorschlag polarisiert also. In einer Untersuchung, die seit dem Wochenende durch die Medien geht, fordern Sie: „Beamte sollen 5,5 Jahre länger arbeiten als Arbeiter“.
Günther: Das war durchaus provokativ gemeint. Mit einer starken Differenzierung kriegen Sie keine Öffentlichkeit.
Matthias Günther ist Diplomökonom und Geschäftsführer des Pestel Instituts, das in mehreren Fachbereichen Analysen und andere Dienstleistungen für Kommunen, Unternehmen und Verbände anbietet.
taz: Erläutern Sie mal: Was steckt hinter der Forderung?
Günther: Das ist relativ simpel. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat die durchschnittliche Lebenserwartung je nach Stellung im Beruf errechnet und demnach leben Beamte eben fünfeinhalb Jahre länger als Arbeiter. Wir können nicht darüber diskutieren, dass die Menschen mehr arbeiten sollen, weil die allgemeine Lebenserwartung steigt, aber solche Faktoren nicht berücksichtigen.
taz: Folgt man Ihrer Argumentation, müssten Angestellte am Schreibtisch auch länger arbeiten als Arbeiter auf dem Bau. Sie leben nämlich ebenfalls länger.
Günther: Im Kern geht es mir tatsächlich nicht um Beamte, sondern ganz allgemein um die Lebenserwartung in verschiedenen Einkommensgruppen. Dass es dazwischen einen Zusammenhang gibt, ist seit Jahrzehnten bekannt. Geringverdiener leben im Schnitt kürzer, Gutverdiener länger. Gerade in der gesetzlichen Rente, in der über alle Rentenkommissionen hinweg am Äquivalenzprinzip festgehalten wurde, führt das zu einer Gerechtigkeitslücke.
taz: Das Äquivalenzprinzip besagt: Wer mehr in die Rentenversicherung einbezahlt hat, bekommt auch eine entsprechend höhere Rente. Was ist da nicht gerecht?
Günther: Auf den ersten Blick erscheint das Prinzip vielleicht gerecht. Aber wer eine niedrige Rente bezieht, kriegt sie im Schnitt auch noch deutlich kürzer als diejenigen mit einer hohen Rente. Innerhalb des normalen gesetzlichen Rentensystems wäre es daher schon immer angebracht gewesen, die unteren Renten anzuheben und die oberen ein Stück weit zu kappen. So hätte man am Ende gerechteres System.
taz: Damit sind wir aber weg von den Beamten und ihren Pensionen. Sie haben ja mit der Rentenversicherung nichts zu tun.
Günther: Am Ende landen wir beim Vorschlag des DIW, einen Boomer-Soli einzuführen. Er würde alle Arten von Alterseinkünften einbeziehen, also das gesamte Einkommen erfassen – nach dem sich am Ende ja die Lebenserwartung richtet.
taz: Der Vorschlag aus dem Juli besagt, über einem bestimmten Freibetrag eine Abgabe von zehn Prozent zu erheben. Mit den Einnahmen sollen niedrige Renten angehoben werden.
Günther: Es geht um Umverteilung. Ich stimme ja durchaus der Wirtschaftsweisen Frau Grimm zu, dass wir uns die bisherigen Systeme so nicht mehr leisten können. Aber dann zu sagen, dass einfach alle pauschal zehn Prozent weniger kriegen, funktioniert nicht. Wir haben nämlich eine Menge Leute, denen können Sie nichts mehr wegnehmen.
taz: Die Bundesregierung will nächstes Jahr die nächste Rentenkommission über Reformen beraten lassen. Für wie realistisch halten Sie es, dass das Äquivalenzprinzip beerdigt wird?
Günther: Ich hoffe zumindest, dass es so kommt. In allen anderen Sozialversicherungssystemen – bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung – haben wir eine Umverteilung drin. Das akzeptiert jeder. Komischerweise hält man nur bei der Rente an dem Ding fest, obwohl es ausgerechnet da nicht mal gerecht ist.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen













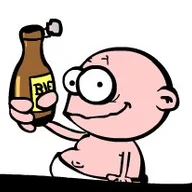


meistkommentiert