Rechtsextremismus-Studie : Die Mitte wankt
Die neuen Zahlen zu rechtsextremen Einstellungen sind alarmierend. Der Kurs der Union erscheint vor diesem Hintergrund noch fataler.

E s gerät nicht etwas ins Rutschen in dieser Gesellschaft – wir sind längst mittendrin. Die von Rechtsextremen durchsetzte AfD segelt von Umfragehoch zu Umfragehoch. Die CDU scheut sich zumindest in Thüringen nicht, ihre Vorhaben mit den Stimmen von rechts außen gegen die Landesregierung durchzubringen. Bei Protesten gegen die Bundesregierung stehen Bürgerliche mit Rechtsextremen auf der Straße. Das Vertrauen in die Parteipolitik und die Demokratie erodiert, politisch motivierte Gewalt liegt auf einem Allzeithoch.
Untermauert wird das nun mit Zahlen der neuen Mitte-Studie der Universität Bielefeld im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. 8 Prozent der Befragten zeigen darin ein manifestes rechtsextremes Weltbild – in den Vorjahren waren es 2 bis 3 Prozent. 34 Prozent glauben, Geflüchtete kämen nur nach Deutschland, um das Sozialsystem auszunutzen. Ein Fünftel wähnt sich „mehr in einer Diktatur als Demokratie“.
Und 13 Prozent finden es berechtigt, dass Wut gegen Politiker*innen in Gewalt umschlägt. Jeder dieser Befunde ist alarmierend. Und er lässt sich auch nicht, wie in den Vorjahren, mit Methodenkritik wegwischen. Rechtsextrem ist laut Studie, wer für einen Führer plädiert oder zwischen „wertvollem“ und „unwertem“ Leben unterscheidet – völlig zutreffend. Es ließe sich diskutieren, ob Populist ist, wer findet, dass Parteien „alles zerreden“. In einem Cluster mit Aussagen wie jenen, dass nicht allen gleiche Rechte gewährt werden könnten, ist aber auch das schlüssig.
Die Zahlen zeigen, wie anschlussfähig die Rhetorik der Ressentimenttreiber inzwischen ist. Es ist nicht so, dass „die Mitte“ bisher davor gefeit gewesen wäre. Inzwischen nun aber sind die Ressentiments offen aussprechbar. Es reicht nicht, dafür die Dauerkrisen anzuführen, die derzeit diese Gesellschaft fordern – die Pandemie, der Krieg, die Klimakrise. Nichts davon muss zwangsläufig in den Rechtsextremismus führen.
Ansprechbar für rechte Rhetorik
Der Befund, dass Zeiten der Unsicherheit eine Sehnsucht nach Sicherheit und einfachen Antworten befördert, ist schnell gemacht. Aber nur ein Drittel der Befragten erklärt, selbst von Krisen betroffen zu sein. Und eine Mehrheit zeigte nach Kriegsausbruch, teils bis heute, Hilfsbereitschaft, nicht Ausgrenzung. Offensichtlich aber ist: Ein wachsender Anteil anderer ist ansprechbar für rechtsextreme Agitatoren, die sich durch diese Krisen beflügelt sehen. Und es ist mehr als beunruhigend, dass unter jüngeren Befragten sogar 12 Prozent ein rechtsextremes Weltbild aufweisen.
Gerade weil die Mitte wankt, ist es fatal, dass Demokraten wie die Union Positionen von ganz rechts außen übernehmen oder hier gar Kooperationen eingehen – und Ressentiments so weiter normalisieren. Auch und gerade dort muss die Grenze zum Rechtsextremismus klar sein. Auf der anderen Seite zeigen die Befunde, wie abwegig es ist, wenn über Kürzungen in der politischen Bildung oder im Sozialbereich diskutiert wird. Genau das Gegenteil ist nötig. Es braucht gerade alles und alle, um die Demokratie zu stärken.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







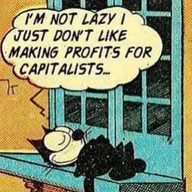
meistkommentiert
Blockade in Gaza
Bittere Hungersnot mit Ansage
AfD gesichert rechtsextrem
Drei Wörter: AfD, Verbot, jetzt
Gesichert rechtsextreme Partei
Rufe nach einem AfD-Verbot werden lauter
Aufrüstung
Wir sind wieder wehrtüchtig – aber wofür eigentlich?
Verfassungsschutz
AfD ist gesichert rechtsextremistisch
Wunschkabinett der Union
Das bisschen Lobbyismus