
Pazifismus und der Ukraine-Krieg: Mein Krieg mit der Waffe
Unser Autor brach den Wehrdienst ab. Der Ukraine-Krieg stellt seinen Pazifismus jetzt infrage. Kann man als Verweigerer für Waffenlieferungen sein?
W ir hatten uns im Wald eingebuddelt, die Gesichter mit oliver, schwarzer und brauner Schminke getarnt, auf die Stahlhelme Grasbüschel gesteckt. Unsere mit Platzpatronen geladenen Gewehre vom Typ G3 stützten wir auf Erdwälle am Rand unserer Schützengräben. Wir warteten auf den „Feind“. Soldaten einer anderen Gruppe meiner Bundeswehreinheit spielten ihn. Plötzlich rannten sie auf unsere Stellungen zu. Meine Kameraden zielten auf die Angreifer und drückten ab. Ich nicht.
Ich konnte nicht. Denn mich quälte die Frage: Was mache ich hier eigentlich? Ich musste mir eingestehen: Töten spielen, Töten üben. Das war äußerst unangenehm. Ich als fehlbarer Mensch darf nicht entscheiden, ob es richtig ist, jemandem das Leben zu nehmen, außer in einer eindeutigen, individuellen Notwehrsituation, grübelte ich. Wie konnte ich also eine derart gravierende, absolut unwiderrufliche Entscheidung treffen?
Am Ende verschenkte ich meine Patronen. Denn für mich wurde spätestens bei dieser Übung 1994 in einem Wald bei Koblenz klar, was es wirklich heißt, Soldat zu sein: andere Menschen im Krieg zu töten. Diese Tatsache hatte ich bis dahin konsequent heruntergespielt oder ausgeblendet. Weil sie meine damaligen politischen Überzeugungen gestört hätte, weil der Wehrdienst für mich beruflich attraktiv war. Und weil ich einfach nicht genug nachgedacht hatte.
Kein Heuchler sein
Kurz nach der Übung stellte ich einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung nach Artikel 4 des Grundgesetzes: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.“ Und leistete daraufhin Zivildienst – wie nach Angaben des Bundesfamilienministeriums rund 2,7 Millionen andere junge Männer von 1961 bis 2011, bevor die Wehrpflicht ausgesetzt wurde.
Doch der Krieg in der Ukraine stellt die pazifistische Grundhaltung vieler ehemaliger, oftmals aus dem linken Milieu stammender Zivildienstleistender infrage: Kann ich als Kriegsdienstverweigerer Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützen, ohne ein Heuchler oder Opportunist zu sein? Und die Aufrüstung der Bundeswehr? War es am Ende sogar falsch, den Wehrdienst zu verweigern?
Seit dem Ukrainekrieg wollen aber auch vermehrt SoldatInnen aus dem Dienst entlassen werden. Von Januar bis Anfang Juni hat das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben nach eigenen Angaben 533 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung erhalten. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. 528 sind demnach aktive SoldatInnen oder ReservistInnen, 5 ungediente AntragstellerInnen. Die VerweigerInnen begründeten ihre Anträge häufig damit, „dass sie mit einer kriegerischen Auseinandersetzung nicht gerechnet hätten“, sagt ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums.
Aktuell ist die Frage nach der Kriegsdienstverweigerung auch deshalb, weil der Ukrainekonflikt eine neue Debatte darüber ausgelöst hat, ob Deutschland wieder die Wehrpflicht einführen sollte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat kürzlich einen Pflichtdienst für Frauen und Männer bei der Armee oder in sozialen Einrichtungen vorgeschlagen. Die Frage „Könnte ich als SoldatIn töten?“ müssen sich also möglicherweise bald wieder viel mehr Menschen stellen als bisher.
Ich traf die Entscheidung, zum Bund zu gehen, Mitte der 1990er Jahre. Ich war damals 20 Jahre alt, machte gerade Abitur an einem Gymnasium nordwestlich von Hamburg und träumte davon, Journalist bei einer großen Zeitung zu werden, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und um mich politisch zu engagieren. Denn ich war schon mit 14 Jahren in die Jugendorganisation der CDU, die Junge Union (JU), eingetreten. Damals interessierte mich vor allem Schulpolitik, und da vertraten meine Eltern eine konservative Linie.
Um die 1990er Jahre herum ging es in Schleswig-Holstein oft darum, ob das dreigliedrige Schulsystem mit dem Gymnasium an der Spitze besser sei oder die Gesamtschule. Als Gymnasiast war ich wie die JU für Ersteres, das sollte sich erst später ändern. Aber in der JU ging es natürlich nicht nur um Schulpolitik. Sie vertrat eine militärfreundliche Haltung. Kaum jemand dort leistete Zivildienst. Unser Kreisvorsitzender war sogar Offizier bei der Luftwaffe. Als JU-Mitglied hätte ich mich für unglaubwürdig gehalten, wenn ich bei der Einberufung zur Bundeswehr gekniffen hätte.
Der Wehrdienst versprach dann auch noch beruflich interessant zu werden. Denn mir wurde in Aussicht gestellt, nach den drei Monaten Grundausbildung in einer Pressestelle oder Redaktion der Bundeswehr zu arbeiten. Das hätte mir geholfen, meinen Berufswunsch „Journalist“ zu verwirklichen. Damals wollte ich ja nicht zur taz, sondern eher zur FAZ.
Freunde, die den Kriegsdienst verweigerten, argumentierten fast immer mit praktischen Überlegungen. Viele hatten einfach keine Lust auf den Bund. Für mich waren das aber keine zulässigen Argumente, denn das waren ja keine Gewissensgründe, die laut Gesetz für die Verweigerung nötig waren.
Leichte Zweifel kamen mir erst, als ich den Einberufungsbescheid erhalten hatte. Ich organisierte eine Abifete mit mehreren Schulen. Da lernte ich auch Leute von der Gesamtschule bei uns im Ort kennen, die tatsächlich aus Gewissensgründen den Kriegsdienst ablehnten. Der Frage nach dem Töten wich ich in der Diskussion mit den Gesamtschülern aus. Ich verdrängte das, es hätte mein Weltbild zu stark durcheinandergebracht, ich glaubte eh nicht an den Ernstfall, und die Jobaussichten beim Bund waren verlockend.
Ich ließ mich also einziehen und fuhr im Juli 1994 mit der Bahn nach Rheinland-Pfalz, in eine Kaserne in Lahnstein. Sie bestand aus mehreren massiven Gebäuden aus der Nazizeit. Hier war das Pionierbataillon stationiert, das nun auch meines sein sollte. Die erste Woche war harmlos. Wir bekamen unsere Uniformen, wir lernten „Achtung!“ rufen und strammstehen, wenn ein Vorgesetzter unsere Stube betrat.
Ich wurde nicht schikaniert, weder von Unteroffizieren noch von Rekruten. Eine der ersten Regeln, die uns beigebracht wurde, war: Wenn ein Befehl gegen die Menschenwürde verstößt (das Töten im Krieg fiel nicht darunter), dürfen wir ihn nicht befolgen. In meinem Zug waren fast nur Abiturienten, die Unteroffiziere waren oft Studenten. Der Umgang war gut, das Essen lecker, der tägliche Sport machte Spaß. Aber schon ab der zweiten Woche konnte ich die Frage, ob ich im Krieg töten könnte, nicht mehr verdrängen.

Wir begannen zu lernen, wie man einen Menschen tötet. Wir neuen Rekruten saßen auf harten, blauen Stühlen in einem engen Schulungsraum mit stickiger Luft. Unser Zugführer erklärte uns, wie Weichkerngeschosse wirken: Sie hätten den „Vorteil“, sagte der Oberleutnant, dass sie den menschlichen Körper, in den sie eindringen, nicht nur durchlöchern, sondern weit aufreißen und so oft tödlich verletzten.
Entsetzt fragte ich: „Wozu ist das gut? Geht es uns nicht bloß darum, den Angreifer kampfunfähig zu machen?“ Ja, das sei im Prinzip richtig, antwortete der Offizier. Aber wer garantiere, dass der verletzte Gegner nach ein, zwei Monaten Behandlung nicht wieder auf uns schießt? Deshalb müsse er getötet werden.
Ich weiß nicht, warum uns das erzählt wurde. Denn später erfuhr ich, dass solche Geschosse nach der Haager Landkriegsordnung verboten sind. Auch hat sie die Bundeswehr laut Verteidigungsministerium nie benutzt. Ich weiß aber, dass mir spätestens da bewusst wurde, worauf ich mich eingelassen hatte.
Als ich später mein über ein Meter langes, mehr als vier Kilogramm schweres G3-Gewehr in den Händen hielt, das kühle Metall fühlte, die sieben Zentimeter langen Patronen ins Magazin drückte, da rückte der Gedanke noch näher: Welches Leid könnte, müsste ich mit diesem tödlichen Gerät anrichten?
Ich diskutierte solche Fragen auch mit meinen Kameraden. Lohnt es sich, Leben zu riskieren, um zum Beispiel die Freiheit zu verteidigen? Ist das Leben oder die Freiheit das höhere Gut?, fragte ich meinen Gruppenführer, einen Fahnenjunker mit sehr jungenhaftem Gesicht. „Natürlich ist das Leben wichtiger“, sagte er. Aber wo die Freiheit gefährdet sei, sei auch fast immer das Leben in Gefahr. Ein Kamerad sagte mir, er würde sein Leben für die Freiheit opfern. Nie könnte er in einer Diktatur leben. Lieber würde er den Feind töten und dabei selber sterben.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk, im praktischen Wochenendabo und rund um die Uhr bei Facebook und Twitter.
Ich habe darüber viel nachgedacht, bis ich zu dem Schluss kam: Für mich steht das Leben an oberster Stelle. Zu oft zogen Soldaten mit der Absicht, ihrer Meinung nach hehre Werte zu verteidigen, in den Krieg – und stellten am Ende fest, dass sie sich irrten.
Quälend wurden diese Gedanken, als wir das erste Mal mit scharfer Munition schießen mussten. Ich bekam Angst bei dem Gedanken, welch tödliche Macht ich mit diesen Patronen hatte. Während wir vor dem Schießstand warteten, stellte ich mir vor, wie eines dieser Metallgeschosse einem anderen Menschen den Kopf zerreißt.
Im Schießstand schossen wir allerdings nur auf Zielscheiben oder Pappkameraden, also auf leblose Gegenstände. Doch dann kam die Übung im Wald, bei der wir zwar nur mit Platzpatronen, aber doch auf echte Menschen „schießen“ sollten. Kurz danach fuhr ich zu einem ehrenamtlichen Berater der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) in der Nähe von Lahnstein. Er informierte mich darüber, wie ich aus dem Wehrdienst heraus verweigern konnte.
Wenig später lief ich ins Büro meiner Kaserne und sagte einem Vorgesetzten: „Ich muss einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellen.“ Er antwortete: „Schade, aus Ihnen wäre ein guter Soldat geworden“, aber dann stellte er mich vom Dienst an der Waffe frei. Ich nahm noch an den meisten Programmpunkten teil, aber eben ohne Gewehr, und nach einigen Tagen durfte ich nach Hause fahren, um mir eine Zivildienststelle zu suchen.
Doch ich musste dafür kämpfen, dass meine Kriegsdienstverweigerung auch anerkannt wird. 1994 wurden die meisten Anträge von Wehrpflichtigen, die nicht zum Bund wollten, nach Aktenlage positiv beschieden. Aber weil ich schon beim Bund war, musste ich meine Entscheidung nicht nur schriftlich, sondern auch in einem verhörähnlichen Termin vor einem Ausschuss im Kreiswehrersatzamt rechtfertigen.
David Scheuing, Pazifist und Friedensforscher
Ein Oberregierungsrat und zwei weitere Männer wollten – die schwarz-rot-goldene Fahne im Rücken – noch einmal genau wissen, weshalb ich verweigern wollte. Es war allgemein bekannt, dass diese Ausschüsse die Antragsteller oft mit folgendem Szenario konfrontierten: „Sie und Ihre Freundin werden von einem bewaffneten Verbrecher angegriffen.Zufällig haben Sie eine Pistole dabei und können Ihr eigenes Leben und das Ihrer Freundin nur retten, indem Sie den Angreifer töten – was tun Sie?“
Ich weiß nicht mehr, ob die Prüfer auch mich mit dieser hypothetischen Gefahrensituation prüften. Aber ich hatte schon in meiner schriftlichen Begründung geschrieben, dass ich uns wahrscheinlich verteidigen würde. Doch das würde mich in eine tiefe Gewissensnot stürzen und meine Persönlichkeit beschädigen. „Ich will aber auf keinen Fall die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in eine solche Situation zu geraten, indem ich Soldat bleibe“, argumentierte ich.
Diese Gewissensprüfungen waren hochumstritten, auch weil die Ausschüsse zuweilen völlig unrealistische Szenarien abfragten und junge, unerfahrene Menschen unter Druck setzten. Für mich hingegen war das Verfahren hilfreich: Es zwang mich, meine Entscheidung wirklich zu durchdenken. Am Ende war ich überzeugter als vorher. Nach drei Monaten bei der Bundeswehr wechselte ich in den Zivildienst und arbeitete zwölf Monate als Hausmeister und Hilfsbetreuer in Wohngruppen für psychisch kranke Menschen.
Nebenbei beriet ich ehrenamtlich Männer, die den Kriegsdienst verweigern wollten. Vor allem die schwierigen Fälle, die zu einer Anhörung mussten, weil sie wie ich bereits Soldat waren oder wegen fahrlässiger Tötung bei einem Verkehrsunfall verurteilt worden waren. Letzteren Antragstellern wurde pauschal unterstellt, sie könnten in Wirklichkeit doch damit klarkommen, im Krieg zu töten, weil sie ja schon einen Menschen auf dem Gewissen hätten. Ich half diesen Männern, weil auch mir die Beratung sehr geholfen hatte.
Jetzt befasste ich mich fast jede Woche mit Begründungen von Wehrdienstverweigerern. Ich las Ratgeber von linken Organisationen wie der DFG-VK. All das trug erheblich dazu bei, dass ich aus der JU austrat. Aus Anlass der Kriegsdienstverweigerung änderte ich am Ende zusehends meine gesamte politische Haltung. Der Zivildienst brachte mich in Kontakt mit einem linken Milieu, mit dem ich vorher kaum zu tun gehabt hatte.
Nun schloss ich das Soldatenhandwerk nicht nur für mich persönlich aus. Ich lehnte auch die Bundeswehr insgesamt ab. Das Drängen der Bundeswehr nach immer mehr Auslandseinsätzen, die nichts mehr mit Landesverteidigung zu tun hatten, bestätigte mich darin. Und erst recht die Analyse um die Jahrtausendwende, dass niemand Deutschland angreifen würde – nicht einmal Russland.
Doch diese pazifistischen Überzeugungen wackeln gewaltig. Seit dem 24. Februar, als Russland die Ukraine überfiel. Seit der Kriegsdienstverweigerer Olaf Scholz als Bundeskanzler im Reichstag von einer Zeitenwende sprach und ankündigte, die Bundeswehr für 100 Milliarden Euro aufzurüsten. Und seit selbst Ex-Zivildienstleistende wie der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, den ich für besonders reflektiert und integer halte, Waffenlieferungen an die Ukraine nicht nur befürworten, sondern aktiv betreiben.
Jetzt auf einmal militärische Lösungen zu propagieren, da sträubt sich bei mir alles. Aber ich habe auch die Bilder von den Leichen in Butscha gesehen, die eiskalten Lügen des russischen Präsidenten Wladimir Putin gehört und gelesen, dass der Mann durch Eroberungen wieder ein russisches Imperium errichten wolle.
Ich fühle mich hin und her gerissen zwischen einem konsequenten Pazifismus und den Bitten der Ukraine um militärische Hilfe gegen den Angriff aus Russland. Dieser Krieg geht mir besonders unter die Haut, weil er so eindeutig ungerechtfertigt von einem Aggressor begonnen worden ist. Auf dem Spiel stehen Werte, die mir wichtig sind: Menschenrechte, Demokratie, Freiheit. Auch ich sehe die Gefahr, dass Putins Truppen in der Ukraine nicht Halt machen werden, wenn sie dort nicht gestoppt werden.
Das ist ein Dilemma, aus dem ich allein keinen Ausweg finde. Deshalb suche ich mir Rat. Vor allem bei Kriegsdienstverweigerern, die sich intensiv mit dem Ukrainekonflikt befassen. Aber auch bei Philosophen, die sich mit dem Gewissen auskennen.
David Scheuing hat wie ich nach dem Ende des Kalten Kriegs verweigert. Heute ist der 32-Jährige Vorsitzender einer Stiftung der DFG-VK. Diese älteste Organisation der deutschen Friedensbewegung hat mir in Sachen Krieg und Frieden Orientierung gegeben. Scheuing hat Friedens- und Konfliktforschung studiert. Er sagt mir schon am Telefon, dass er bis heute zu seiner Verweigerung stehe – und zu seinem Pazifismus. Das ist auch meine Haltung, mit der ich diese Suche nach Antworten beginne, und deshalb fahre ich zuerst zu Scheuing.
Ich bin nicht der einzige
Er wohnt im Dorf Klennow im niedersächsischen Wendland. Auf dem Weg dorthin sehe ich im Bahnhof Stendal einen Güterzug voll geladen mit Bundeswehrpanzern, der Richtung Osten rollt. Aber das wirkt weit weg in Scheuings idyllischem Garten, in dem man fast nur Vögel zwitschern hört. Scheuing sieht sehr sanft aus mit seiner weichen Mütze, die mit einem Sonnenblumenmotiv bedruckt ist, mit dem zartrosafarbenen Hoodie und dem T-Shirt, auf dem „If WAR IS the answer, the question must be FUCKING STUPID“ steht.
Wir duzen uns gleich, Scheuing tickt halt so ähnlich wie ich. Er ist taz-Abonnent. Auch Scheuing hat in seiner Verweigerung geschrieben, dass er niemanden töten könne. „Ich stehe bis heute dazu“, sagt er. Für ihn wäre es inkonsequent, jemand anderem Waffen zu geben, damit der dann töten kann. Deshalb lehnt er solche Lieferungen an die Ukraine ab. Diesen Gedanken hatte ich auch schon – schön, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt.
„Ich will die Waffenproduktion an sich verhindern“, fährt Scheuing fort. „Wenn ich Gewaltmittel habe, fällt mir die Gewaltanwendung auch leichter und die Hemmschwelle sinkt.“ Er sagt auch: „Die Zurverfügungstellung von Gewaltmitteln hat in keinem Konflikt zur Verbesserung der Lage geführt.“ Die Energie, die jetzt für Waffenlieferungen eingesetzt werde, „könnte/müsste eigentlich auch in andere Maßnahmen, Mittel, Möglichkeiten, diplomatischer oder anderweitig friedenspolitischer Natur fließen“.
Jürgen Trittin, Außenpolitischer Sprecher der Grünen
Er ist sogar dafür, die Bundeswehr aufzulösen. Er glaubt nicht daran, dass Putin Deutschland angreifen wolle. Dessen „Nationalimperialismus“ drehe sich „primär um seine Fantasie von drei russischen Völkern“. Ich verstehe Scheuing so: Putin will Russlands Herrschaft auf die Gebiete ausdehnen, in denen diese Völker leben – weiter wird er nicht gehen.
Scheuing ist sehr eloquent. Seine Sätze sind lang und verschachtelt. Doch dann frage ich ihn, ob wir nicht moralisch verpflichtet seien, den UkrainerInnen auch durch Waffenlieferungen zu helfen, weil sonst Russland ein repressives Besatzungsregime errichte, Menschen töte und foltere. So wie in dem Kiewer Vorort Butscha – „wie kannst du das verantworten?“ Diese Frage tut mir selber weh, ich ringe eigentlich ständig um eine Antwort. Auch Scheuing tut sich schwer damit.
„Mmh, ja …“, sagt er erst, er stockt und guckt auf den Boden. Schließlich antwortet er: „Deswegen bin ich Bestandteil einer Gruppe, die gerade sehr akute Vorbereitungen für das Etablieren von sozialer Verteidigung als Handlungsalternative vorantreiben will.“ Damit meint er: Zivilisten stellen sich Panzern entgegen, demonstrieren, boykottieren Anweisungen von Besatzern, zahlen keine Steuern an sie und so weiter. „Genau. Ja. Und dann siehst du Butscha, Irpin, Mariupol“, fährt Scheuing zögerlich fort.
Dort haben russische Truppen ZivilistInnen massakriert. Zeigt diese rohe Gewalt nicht, dass sozialer Widerstand lebensgefährlich ist und in diesem Krieg kaum funktionieren könnte? Scheuing zögert lange, aber am Ende sieht er sich durch diese Taten bestätigt in seiner Überzeugung, „dass eine prinzipielle Gewaltlosigkeit notwendig ist“.
Scheuing räumt aber auch ein, dass die Lage für ihn gerade nicht einfach ist. Dass Russland seinen Status als Atommacht benutzt, um Druck in diesem Krieg auszuüben, all das „führt zu einem Wutanfall“, sagt der sonst so besonnene Pazifist. Ja, fahre ich fort, und man muss auch sehen, dass Putin sich einfach nicht an Recht und Gesetz hält, dass er offenbar nur die Sprache der Gewalt versteht.
„Dann rette ich mich manchmal in meine Daten“, sagt Scheuing. Das sind Analysen bewaffneter Kämpfe, die nicht auf dem Schlachtfeld beendet wurden. „Der Krieg endet am Verhandlungstisch“, sagt der Pazifist.
Stimmt, denke ich. Doch vorher ist auf dem Schlachtfeld bestimmt worden, wie stark die Verhandlungspositionen der verschiedenen Parteien sind. Einer wie Putin verhandelt ja nur, wenn er durch Gewalt so viel erreicht hat wie möglich.
Auf solche Einwände hat Scheuing kaum praktikable Antworten. Seine Lösungsvorschläge zu sozialer Verteidigung klingen in der Theorie gut, aber mir fällt es schwer zu glauben, dass sie in der Praxis funktionieren. Nach dem Gespräch mit Scheuing bin ich orientierungsloser als vorher.
Vielleicht muss ich jetzt einen Menschen fragen, der mehr Verantwortung hat, einen Praktiker der Macht: zum Beispiel Jürgen Trittin. Der 67-Jährige ist außenpolitischer Sprecher der Regierungspartei Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. Er hat 1973 den Kriegsdienst verweigert, hat erst Waffenlieferungen an die Ukraine abgelehnt, verteidigt diese Unterstützung für das Land aber seit dem russischen Einmarsch im Februar.
Trittin hat zwischen zwei Sitzungen im Reichstag Zeit für ein Telefonat mit mir. Er sagt: „Es gibt einen Unterschied zwischen dem individuellen Verhalten, ob man selbst an einem Krieg beteiligt ist, und der Frage, was eine Gesellschaft und ein Staat tut.“ Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung sei eben ein individuelles Grundrecht. Für Trittin wäre es also in Ordnung, zu sagen: Ich selbst kann nicht zur Waffe greifen, aber ich gebe sie anderen, damit sie für unsere Sache töten.
Wer so denkt, hat für sich das akute Problem gelöst: So lassen sich Waffen liefern, mit denen der russische Angriff auf die Ukraine gestoppt werden könnte. Aber ich finde es inkonsequent, sein Gewissen sozusagen an der Garderobe abzugeben, wenn man politische Entscheidungen fällt. Das überzeugt mich nicht.
Ein Vorbild?
Also, neuer Versuch: Trittins Parteifreund Tobias Lindner fällt mir auf, weil der 40-Jährige seit Dezember Staatsminister im Auswärtigen Amt ist, 2001 Zivildienst leistete, 2019 aber seine Verweigerung widerrufen hat.
Warum?
Wäre das ein Vorbild für mich?
Ich treffe Lindner im Auswärtigen Amt, wo alles noch wichtiger wirkt als in vielen anderen Bundesministerien: die langen, hohen Flure, weinrote Teppiche, getäfelte Wände. Der Staatsminister sitzt auf einer schweren, schwarzen Ledercouch, trägt einen dunklen, sehr formell wirkenden Dreiteiler mit Schlips und lächelt viel. Seine Kriegsdienstverweigerung habe er vor einer Wehrübung für Bundestagsabgeordnete zurückgezogen, erzählt Lindner. Fünf Tage trug der Verteidigungspolitiker Uniform, gehorchte Befehlen, schoss. „Rein nach der rechtlichen Definition bin ich jetzt sogar Reservist“, sagt Lindner.
Zu der Wehrübung wollte er nach eigenen Worten, weil er jahrelang als Haushalts- und Verteidigungsexperte seiner Fraktion Politik für die Bundeswehr mitgestaltet hatte. „Natürlich wollte ich diese Bundeswehr auch von innen sehen.“ Vor der Wehrübung habe er noch mal sein Gewissen geprüft, sagt Lindner. „Spätestens 2019 bin ich zu dem Ergebnis gekommen: Genau, ich würde mich auch mit einer Waffe in der Hand verteidigen.“ Deshalb schrieb er der zuständigen Behörde, dass ihn „Gewissensgründe nicht mehr daran hindern, den Kriegsdienst mit der Waffe zu leisten“.
Das hatte keine großen praktischen Folgen für ihn, denn die Wehrpflicht war ja damals schon ausgesetzt. Für opportunistisch hält er sich dennoch nicht. „Im Verteidigungsfall hätte ich vorher nicht zur Bundeswehr eingezogen werden können. Jetzt schon“, sagt er. Lindner erklärt mir seinen Sinneswandel so: Zur Zeit seiner Verweigerung im Jahr 2000 habe eine „westdeutsche und westeuropäische Wohlfühlatmosphäre“ geherrscht, in der niemand an Krieg hierzulande gedacht habe. Das habe sich zum Beispiel mit den Anschlägen vom 11. September 2001 geändert.
Waffenlieferungen verlängern Kriege nicht
„Und natürlich hat sich mein Bild über die Bundeswehr quasi durch den Verteidigungsausschuss geändert und gewandelt – zum Positiven hin.“
Muss ich meine Verweigerung auch zurückziehen, wenn ich für Waffenlieferungen an die Ukraine bin?
„Nein, das müssen Sie nicht“, antwortet Lindner mir. „Das würde nur gelten, wenn Sie aus Ihrer Verweigerung schlussfolgern, dass kein Mensch auf dieser Welt in keiner Situation Gewalt gebrauchen darf.“
So habe er nie gedacht, sagt der Staatsminister. Denn sonst hätte er ja nicht Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags sein oder an Budgets für die Bundeswehr mitarbeiten können.
Lindner kontert auch ein wichtiges Argument des Pazifisten Scheuing. Dass Waffenlieferungen Kriege nur verlängern und nicht nachhaltig lösen würden, hält er für „historisch widerlegt“. „Im Zweiten Weltkrieg lieferten die Vereinigten Staaten den Westeuropäern massiv Waffen. Natürlich war das mitunter kriegsentscheidend neben dem Kriegseintritt der USA.“
Und was hält er von der Aussage, dass Putin Deutschland gar nicht angreifen will?
Er wisse nicht, woher der Pazifist seine Erkenntnisse über Putins Psyche hat, sagt Lindner dazu. Und es gehe auch nicht nur um Putin. „Ich halte Streitkräfte vor, damit mich niemand angreift. Damit erhöhe ich die Kosten eines möglichen Feindes, mich anzugreifen.“
Als Lindner Scheuings Argumente auseinandernimmt, fühle ich auch zentrale Teile meiner politischen Persönlichkeit infrage gestellt.
Das schmerzt. Umso mehr, als dass ich langsam nicht mehr weiß, was man Lindner entgegenhalten soll: Dass ein Sieg in der Ukraine Putin ermuntern würde, weitere Länder anzugreifen, ist sehr wahrscheinlich. Zivilen Widerstand würde dieser ehemalige KGB-Offizier wohl mit Morden, Folter und Deportationen nach sowjetischem Vorbild brechen. Putin lässt sich wohl nur durch militärische Gewalt oder die Drohung mit ihr stoppen.
Bilder tauchen wieder auf
Es tut weh, mir nach Jahrzehnten, in denen ich mich als Pazifist definiert habe, einzugestehen: Wahrscheinlich muss Deutschland wirklich das ukrainische Militär mit allen nötigen Waffen ausstatten – bezahlt auch mit meinen Steuern. Wahrscheinlich brauchen wir die Bundeswehr und müssen sie besser ausrüsten. Ob dafür wirklich 100 Milliarden Euro nötig sind, ist eine andere Frage.
Da tauchen wieder die Bilder von der Kriegsübung in dem Wald bei Koblenz in meinem Kopf auf. Die Schulung über besonders tödliche Munition. Das G3. Die Gewissensprüfung im Ausschuss für Kriegsdienstverweigerung.
Dass Töten eine unwiderrufliche Entscheidung ist und ich ein fehlbarer Mensch – daran hat sich nichts geändert. Deshalb könnte ich es immer noch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, jemanden zu töten.
Aber viele Menschen können das. In der Ukraine gibt es zwar nur ein sehr eingeschränktes Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Doch offenbar kämpfen viele ukrainische Soldaten aus Überzeugung. Ihr Kampf ist auch aus meiner Sicht gerecht, und er könnte weitere Kriege verhindern.
Diese Abwägung zwingt mich dazu, von meiner radikalpazifistischen Haltung Abstriche zu machen und zu dem erschreckenden Fazit zu kommen: Waffen für die Ukraine, aber nicht für mich.
Gut leben kann ich mit dieser Haltung nicht. Weder Trittin noch Lindner konnten meine Einwände entkräften, dass so eine Position inkonsequent, ja heuchlerisch sei. Deshalb telefoniere ich am Ende noch mit der Philosophin und Autorin Ina Schmidt. Sie hat schon an anderer Stelle schlaue Sachen über das Gewissen gesagt. Schmidt findet es „überaus problematisch“, wenn etwa Politiker bei ihren Entscheidungen nicht auch ihrem individuellen Gewissen folgen, erläutert sie mir.
„Und trotzdem erfordert es die derzeitige Lage, sich hin und wieder aus guten Gründen einer anderen Meinung anzuschließen“, da es „eine objektive Notwendigkeit sein kann, schlicht weil Menschen sterben und wir nicht tatenlos zuschauen können“, sagt sie. Auch das sei eine Gewissensentscheidung, „die den kurzfristigen Kompromiss einschließt, ohne dass deswegen der Zweck alle Mittel heiligen darf“.
Das ahnte ich schon. Aber nachdem Schmidt mir das so klar gesagt hat, kann ich meinen Kompromiss in Sachen Ukraine etwas besser akzeptieren: Ja, das ist nicht hundertprozentig konsequent – aber in dieser schwierigen Lage notwendig.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










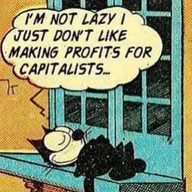



meistkommentiert
Nato-Gipfel
Europäischer Kniefall vor Trump
Geheimdienst-Gremium ohne Linke und AfD
Heidi Reichinnek fällt durch
Wirtschaftsministerin gegen Klimaziele
Reiche opfert uns den Reichen
Psychisch kranke Flüchtende
Konsequente Hilfeverweigerung
Spahns Maskenaffäre
Erfolgreich versenkt
Grenzen der DNA-Analyse
Mehr Informationen oder mehr Rassismus?