Marsch der Abtreibungsgegner*innen: „Pro Life? Am Arsch“
Tausende demonstrieren in Berlin und Köln gegen das Abtreibungsrecht, darunter auch Rechte. Queerfeminist*innen stellen sich dagegen.

Zum 19. Mal gehen unter dem Slogan „Marsch für das Leben“ Menschen gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche auf die Straße – erstmals zeitgleich zur Berliner Demo auch in Köln. Eine „Verdopplung“ seiner größten Veranstaltung hatte der Bundesverband Lebensrecht (BvL) sich von diesem zweiten Standort erhofft. So ganz hat das zwar nicht geklappt, aber es gehen doch deutlich mehr Menschen gegen körperliche Selbstbestimmung auf die Straße als noch im vergangenen Jahr. Damals waren es rund 3.500, die in Berlin demonstrierten. Diesmal zählte die taz knapp 3.000 Menschen in Berlin und etwa 2.000 in Köln.
Christ*innen neben Rechten
Am Kölner Heumarkt stehen zwei junge Frauen am Stand des BVL. Sie erzählen von Schwangerschaftskonfliktberatungen, in denen Frauen Abtreibungen als einzige Option nahegelegt werde. Ob es solche Einseitigkeit auch von der anderen Seite gebe? „Ja, bestimmt“. Abtreibungen seien aber eben auch keine normale Option, in Extremfällen sei sie aber vertretbar, beispielsweise wenn das Leben der Mutter gefährdet sei.
Die Teilnehmer*innen sind in großer Mehrheit aus einer christlichen Motivation hier. Junge Menschen mit kleinen Kreuzen an Halsketten und Vertreter*innen der Boomer-Generation in Hemd oder Bluse dominieren das Bild. Die „Katholischen Tempelritter Deutschland“ fallen mit ihren weißen Kutten mit aufgestickten roten Kreuzen deutlich auf. In deren Broschüre ist zu lesen, dass „völlige Hingabe an das Vaterland und den Glaube“ zu den Anforderungen an Mitglieder zählen. Ein halbes Dutzend schwarz gekleideter Menschen schwenkt schwarz-rot-goldene Flaggen. Sie stellen sich als Tanzgruppe „Glory fight“ vor. Deutschsein ist für sie „Ausdruck der Großartigkeit Gottes“.
Regelmäßig versammeln sich auf dem „Marsch für das Leben“ Abtreibungsgegner*innen, Christ*innen, Bischöfe, konservative Politiker*innen, aber auch Rechtsradikale. Was sie eint, sind ihre Positionen zu dem, was sie Lebensschutz nennen: unbedingten Schutz von Embryonen, gegen Schwangerschaftsabbruch, gegen Eizellspende und Leihmutterschaft, gegen Beihilfe zum Suizid und aktive Sterbehilfe.
Dass die Abtreibungsgegner*innen ausgerechnet nach Köln expandieren, ist kein Zufall. Dort haben sie Rückenwind durch das erzkonservative Bistum. Dessen Kardinal Rainer Maria Woelki schickte auch in diesem Jahr wieder ein Grußwort an den Marsch. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Erzbistum Köln hingegen hatte zum Boykott des Marschs aufgerufen: Es sei „nicht hinnehmbar, dass Christ*innen Seite an Seite mit Rechtsextremist*innen auf die Straße gehen oder gar zusammenarbeiten“.
Auf der Bühne am Heumarkt spricht Paul Cullen von der Initiative „Ärzte für das Leben“. Eine Interaktion zwischen Arzt und Patient dürfe niemals mit dem Tod des Patienten enden, so Cullen. Danach spricht Susanne Wenzel, Vorsitzende der „Christdemokraten für das Leben“. Die Gruppe steht den Unionsparteien nahe und hatte vorab einen Veranstaltungshinweis für den „Marsch für das Leben“ auf der Webseite der CDU platziert, was innerhalb des Kölner Ratsbündnisses, in dem neben der CDU auch die Grünen und Volt sitzen, für Verwerfungen gesorgt hatte.
Es gebe „zum ersten Mal eine Regierung in Berlin, die aktiv gegen das Leben vorgeht“, sagt Wenzel. Die Ampelkoalition lässt derzeit eine Expert*innenkommission prüfen, ob Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafrechts geregelt werden könnten – ein Albtraum für die Abtreibungsgegner*innen.
Abtreibung wird mit Holocaust gleichgesetzt
Von der Bühne direkt am Brandenburger Tor in Berlin tönt derweil seichte Popmusik: „Segnende Hände für die Stadt“, trällert die Band. Die Menschen in der ersten Reihe heben die Arme. Grüne und rote Luftballons steigen in die Luft. Es wirkt wie ein Familienfest – wäre da nicht die Insel aus Holzkreuzen direkt vor der Bühne, an die zwei Männer gerade noch weiße Rosen knoten. Ein „Gedenkfeld für die Kinder vor der Geburt“ sei das, sagt Alexandra Linder vom Bundesverband Lebensrecht. Es soll die weißen Holzkreuze ersetzen, mit denen die Abtreibungsgegner*innen in den vergangenen Jahren durch die Straßen gezogen sind.
Es seien „schwierige Zeiten“, sagt Linder: Die Abtreibungszahlen seien gestiegen und „niemanden interessiert das“. Vor ihr reihen sich die Schilder, die der BvL an die Teilnehmenden ausgegeben hat: „It’s a child, not a choice“, steht da, oder: „Töten ist keine ärztliche Kunst“. Andere halten Heiligenbilder in die Höhe. Wer Schwangerschaftsabbrüche als Teil der Gesundheitsversorgung bezeichne, vertrete eine „Ideologie, der die Menschen egal sind“ und sei „frauenfeindlich“, sagt Linder.
Im Publikum hält einer ein Schild hoch, das den Fachkräftemangel in Deutschland mit Schwangerschaftsabbrüchen in Verbindung bringt, während ein anderer ein T-Shirt trägt, dessen Aufschrift Abtreibungen mit dem Holocaust gleichsetzt. Ein Schild am Fahrrad eines Teilnehmers warnt vor der „Corona-Diktatur“. Auch AfD-Politiker*innen laufen mit beim Marsch, etwa der Europaabgeordnete Joachim Kuhs, Vorsitzender der Gruppe „Christen in der AfD“.
„Wir haben nicht in Gottes Schöpfung einzugreifen und Kinder im Mutterleib zu töten“, sagt ein junger Mann. In seiner Hand hält er ein BvL-Schild, auf dem ein Mann am Strand ein Baby in die Luft wirft. „Danke Papa“, steht darauf. Das sei für sei seinen Vater, sagt der 24-Jährige. „Es ist doch schön, zu wissen, dass Gott uns geschaffen hat und dass er einen Plan für uns hat“, sagt die junge Frau neben ihm.
Die 19-Jährige und ihr Freund sind aus Oberfranken mit einem Bus angereist, den die örtliche evangelische Gemeinde organisiert hat. Aus mehreren Orten gab es Anreisen nach Berlin oder Köln mit dem Bus, organisiert von Gemeinden, von Privatpersonen und von der CDU-nahen Gruppe „Christdemokraten für das Leben“. Auf der Bühne warnt ein Redner vor der Legalisierung aktiver Sterbehilfe, die er konsequent als „Euthanasie“ bezeichnet. „Wiederholt nicht die Geschichte“, warnt er.
Queerfeministischer Gegenwind in Berlin
Ungestört sind die Abtreibungsgegner*innen nicht. Schon am Vortag haben in Berlin Aktivist*innen Sprüche wie „Queer as fuck“ und „My Body My Choice“ auf die Straße entlang der Demoroute geschrieben. Slogans, die plötzlich auch inmitten der Menge vor der Bühne ertönen, während gleichzeitig bunte Farbwolken aufsteigen. Unter Geschubse der Teilnehmenden werden die feministischen Störer*innen von der Polizei aus der Menge geführt.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Brandenburger Tors wehen derweil mehrere Regenbogenflaggen. Mehrere hundert Feminist*innen haben sich hier versammelt. „jedes Jahr gehen wir auf die Straße – weil wir gezwungen sind, der anderen Seite nicht die Straße zu überlassen“, ruft eine Rednerin vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
Sie erinnert an zehntausende ungewollt Schwangere, die jedes Jahr infolge illegaler und unsicherer Abtreibungen sterben. An Millionen, die wegen Komplikationen im Krankenhaus behandelt werden müssen. „Pro Life? Am Arsch“, ruft sie denen zu, die Schwangerschaftsabbrüche in der Illegalität sehen wollen. „Wogegen sie wirklich sind? Gegen Menschenrechte!“ Rund 1.000 Menschen sind in Berlin für das Recht auf Selbstbestimmung auf der Straße. Neben dem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung hat auch das queerfeministische Bündnis „What the Fuck“ mobilisiert und mehrere Kundgebungen angemeldet.
Anders als in so manchem Vorjahr können die knapp 3.000 Abtreibungsgegner*innen ungehindert ihren Demozug antreten. Doch die drei Lautsprecherwagen, aus denen voll aufgedrehte Musik dröhnt, können die Rufe nicht übertönen, die ihnen immer wieder entgegenschlagen: „Haut ab“, „Blut an euren Händen“, „My body, my choice, raise your voice.“
Lebensschützer*innen in Köln trotz Polizei blockiert
In Köln unterlaufen die Gegendemonstrant*innen die Polizeikette, kaum, dass die Kundgebung beginnt. Sie drängen mit Trillerpfeifen und Trommeln bis an den Rand der Kundgebung vor. Die Worte von der Bühne sind auch direkt davor kaum zu verstehen. „Warum gibt es hier keine vernünftigen Lautsprecher?“, ärgert sich eine Person im Publikum. Der „Marsch für das Leben“ ist zwar leiser, von den Teilnehmer*innenzahlen ist er aber ebenbürtig. Etwa 2.000 Menschen stehen auf jeder Seite.
Als der Marsch loslaufen soll, ist die Route blockiert. Die Kölner Polizei leitet die Demo auf eine Nebenstraße um, die allerdings kurz darauf ebenfalls blockiert ist. Unter Einsatz von Schlagstöcken nehmen die Beamten den Blockierenden einige Banner ab, aber die Blockade bleibt.
Am frühen Nachmittag ist Luzie Stift von Pro Choice Köln mit dem bisherigen Verlauf zufrieden: Man habe sich dem Marsch wirkungsvoll entgegengestellt. Dieser sei ein Ausdruck des Antifeminismus, der ein zentrales Bindeglied zwischen christlichen Fundamentalist*innen, Konservativen und der extremen Rechten sei. Im Umfeld der Demonstration habe man einige bekannte Rechtsextremist*innen aus dem Rheinland gesichtet.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










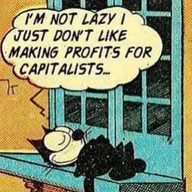



meistkommentiert
Merz’ Anbiederung an die AfD
Das war’s mit der Brandmauer
Rechtsdrift der Union
Merz auf dem Sprung über die Brandmauer
Christian Drosten
„Je mehr Zeit vergeht, desto skeptischer werde ich“
#MeToo nach Gelbhaar-Affäre
Glaubt den Frauen – immer noch
Grünes Desaster
Der Fall Gelbhaar und die Partei
+++ Nachrichten im Nahost-Konflikt +++
Menschen in Ramallah feiern Hamas nach Gefangenenaustausch