Kontroverse über Homöopathie: Das weiße Nichts
Für die Wirksamkeit von Globuli gibt es keine ernsthaften Belege. Warum kommt das bei den Anhänger*innen der Homöopathie nicht an?
Als Ulrike Fröhlich erfährt, wer da in Mainz sprechen soll, setzt sie einen Protestbrief an den Rektor der Universität auf. Fröhlich ist Vorsitzende der Hahnemann-Gesellschaft, einem Zusammenschluss homöopathischer Mediziner. Sie schickt ihren Brief an Zeitungen. Sie will, dass der Vortrag abgesagt wird. „Ich werde es nicht widerspruchslos hinnehmen“, schreibt Fröhlich, „dass unsere wissenschaftliche Kultur derart beschädigt wird“.
Die Referentin des Abends, Natalie Grams, ist eine Reizfigur für die Anhänger der Homöopathie. Sie gehörte selbst lange zu ihnen. Heute sieht sie die Homöopathie kritisch. Fröhlich nennt Grams in ihrem Brief eine „selbsternannte ‚Sachkundige‘“, durch deren „einseitigen Lobby-Vortrag“ Studierende „unsachgemäß informiert“ würden. Einen Tag vor dem Vortrag kündigt Ulrike Fröhlich an, die Uni Mainz zu besuchen. Sie habe etwa 35 Kollegen gebeten, ebenfalls zu kommen. Auch Patienten habe sie angeschrieben, sagt sie einem Fachportal für Apotheker.
Ein paar Stunden vor der Veranstaltung ist auf Twitter von einem Skandalvortrag die Rede. Ein Blogger, der mit Ulrike Fröhlichs Hahnemann-Gesellschaft gut vernetzt ist, ruft die Veranstalter dazu auf, dafür zu sorgen, dass es zu „keinen gewalttätigen Ausschreitungen“ gegen die Homöopathen komme. Ein paar Tage zuvor hatte er Kritik an der Homöopathie mit der Judenverfolgung im „Dritten Reich“ verglichen. Kurz vor dem Vortrag patrouillieren zwei Polizisten auf dem Flur des Philosophicums, einem Funktionsbau mit überfüllten schwarzen Brettern.
Homöopathie ist im Gesundheitssystem verankert
Warum ist die Stimmung nur so aufgeheizt, wenn es um die Homöopathie geht? Die Homöopathie ist eines der beliebtesten alternativen Therapieverfahren in Deutschland. Gut die Hälfte der Deutschen soll laut der Umfrage eines Herstellers bereits homöopathische Mittel genutzt haben. In jedem Bekanntenkreis findet sich jemand, der auf die kleinen Zuckerkügelchen schwört, die Globuli.
Und auf den ersten Blick wirkt das Ganze ja seriös. Die Homöopathie ist im Gesundheitssystem verankert. Homöopathische Mittel sind apothekenpflichtig, sie haben Beipackzettel über Risiken und Nebenwirkungen. Manche Krankenkassen zahlen für die Therapie. Und Ärztinnen wie Ulrike Fröhlich führen offiziell die Zusatzqualifikation als Homöopathin wie andere die als Proktologe. Wenn die Homöopathie ein Irrtum ist, warum sollte die Proktologie dann wahr sein?
Schaut man genauer hin, bekommt man schnell den Eindruck, in einer Trollfabrik gelandet zu sein. Es wird gekämpft und gehasst, oft persönlich, gern bizarr. Als das ZDF im Januar eine Dokumentation über die Heilmethode ausstrahlte, rief Ulrike Fröhlichs Hahnemann-Gesellschaft dazu auf, massenhaft bei dem Sender anzurufen – inklusive Argumentationsvorlage: „Der Hinweis auf die Wissenschaftlichkeit ist in diesem Zusammenhang nicht wichtig“, steht in der Rundmail. „Diese Aktion dient nicht der inhaltlichen Auseinandersetzung.“
„Glauben Sie etwa, dass wir alle dumm sind?“
In letzter Zeit ist viel vom Postfaktischen die Rede, davon, dass gefühlte Wahrheiten in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wichtiger werden als echte und die Debatten immer unversöhnlicher. Im Kampf um die Homöopathie lässt sich vieles davon beobachten.
Es sind noch gut sechs Stunden bis zu ihrem Vortrag im Mainzer Hörsaal P2. Natalie Grams ist noch in Heidelberg, sie schaut auf ihr Handy, auf die Twitter-Aufregung, die Proteste. Sie ist das gewohnt, im Netz wurde schon ihre Doktorarbeit durchleuchtet und spekuliert, dass Grams als verdeckte Lobbyistin der Pharmaindustrie arbeite. „Aber kalt lässt mich das überhaupt nicht“, sagt sie. Nach einem Vortrag in Linz habe sich einmal ein Arzt, ein stattlicher Mann, vor ihr aufgebaut und sie in bedrohlichem Ton gefragt: „Glauben Sie etwa, dass wir alle dumm sind?“

Grams steht in Heidelberg in ihrer ehemaligen Praxis, ein Eckhaus gegenüber einer Grundschule. Früher war hier ein Nähladen, Grams nahm einen Kredit auf, riss den Linoleumboden heraus und verlegte helles Laminat. Inzwischen arbeiten hier zwei Physiotherapeuten, sonst hat sich wenig geändert.
An den Wänden hängen die Bilder, die Grams angebracht hat, langformatige Fotos: eine Möwe, eine Rose, eine Schlossmauer – symbolisch für die tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ausgangsstoffe, die die Homöopathie klassischerweise verwendet. 500 homöopathische Mittel verwahrte sie in dem großen Medizinschrank im Sprechzimmer. Drei Jahre hat Grams hier als Privatärztin praktiziert. Bis ihr Zweifel kamen.
Zweifel einer Privatärztin
Die begannen, als sie ein Buch in den Händen hielt: „Die Homöopathie-Lüge“. Grams reagierte so wie die, die sich heute über ihre Vorträge und Bücher aufregen. Sie schrieb eine empörte Kundenrezension bei Amazon. Wer erlebt habe, wie die Homöopathie Leben verändere, schrieb sie, der könne unmöglich so ein Buch verfassen.
Unter dem Post entspann sich eine Diskussion, und Grams ließ sich darauf ein. Woher willst du wissen, dass es die Homöopathie war?, fragte jemand. Grams verstand die Frage nicht. Sie ging ihre Patientenakten durch, die vielen Erfolgsgeschichten, die sie darin zu finden meinte. Da war die Alkoholikerin, die fast jede Woche bei ihr in der Praxis saß, die irgendwann trocken wurde und wieder einen Job fand. Ist das nicht eindeutig?
Kann es nicht auch die Zuwendung gewesen sein?, hielt jemand dagegen. Das Gespräch? Oder der Verlauf der Zeit? Warum soll es ein Medikament gewesen sein, das so stark verdünnt ist, dass kein Wirkstoff mehr in ihm nachzuweisen ist? „Die haben immer weiter nachgefragt“, sagt Grams. „Und ich bekam sie einfach nicht überzeugt.“ Sie nahm sich vor, selbst ein Buch zu schreiben, das alle Zweifel ausräumen sollte. Die Homöopathie-Wahrheit.
Menschen glauben ihren Erinnerungen
Eines Tages saß eine Brustkrebspatientin auf der anderen Seite von Grams Schreibtisch, vor dem Bild mit der Schlossmauer. Die Frau hatte panische Angst vor einer Operation, sie bettelte um ein homöopathisches Mittel gegen den Tumor. Wie könnte ich das verantworten, in so einem gravierenden Fall, wenn ich nicht 100-prozentig sicher sein kann, dass die Homöopathie hilft?, dachte Grams. So erzählt sie es heute. Sie könne die Globuli ja ergänzend zur Operation nehmen, antwortete sie ihrer Patientin. Den Krebs wollte die Frau später von einem Wunderheiler behandeln lassen.
Grams las, eher zufällig, Bücher aus der Psychologie, die sich mit Denkfehlern beschäftigen. Zum Beispiel von Daniel Kahneman, einem Nobelpreisträger, der in unzähligen Experimenten zeigte, dass wir im Alltag laufend falsch wahrnehmen und urteilen. Kahneman schreibt, dass wir eher das für wahr halten, woran wir uns schnell erinnern, was in unserem Kopf ohne große Mühe verfügbar ist.
Unsere eigenen Erfahrungen, schreibt Kahneman, fühlen sich wahrer an als die anderer, von denen uns berichtet wird. Über Homöopathie schreibt Kahneman nicht ausdrücklich, aber man kann seine Überlegungen problemlos übertragen. Wenn wir am eigenen Leib zu erleben meinen, wie eine Medizin wirkt, überzeugt uns das eher als eine Studie.
Ein Arzt, der mit Homöopathie behandelt, erinnert sich leichter an die Patienten, die immer wieder in die Praxis kommen, die Zufriedenen. Die Unzufriedenen, die nach ein, zwei Besuchen wegbleiben, vergisst er. Der Erfolg fühlt sich wahrer an als der Misserfolg.
Fachjournale und Forschungsgesellschaften
Grams erzählt, dass einmal ein japanisches Paar zu ihr kam, das verzweifelt nach einem Mittel gegen die Neurodermitis ihres Säuglings suchte. Sie hatten schon mehrere Homöopathen konsultiert. Auf einem karierten DIN-A4-Blatt hatte der Vater in winziger Schrift in jeder Kästchenreihe notiert, mit welchen Globuli sie es versucht hatten. Alle vergebens.
Wenn die Homöopathie so wirksam ist, fragte sich Grams, wieso konnte keiner ihrer Kollegen helfen? Und wieso sollte sie es können? Beruhte ihr Glaube an die Homöopathie vielleicht auf den Denkfehlern, die Kahneman beschrieb? „Jeden Patienten, der wegbleibt, macht man sich zum Vorwurf“, sagt sie. „Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass ihnen die Homöopathie vielleicht einfach gar nicht geholfen hat.“
Die Homöopathie hat sich im Laufe der Zeit zu einem Gedankengebäude aufgetürmt, mit Fachjournalen, Forschungsgesellschaften und Tagungen, die über die Lehre wachen. Die Zufälle und Fehlschlüsse, mit denen sie begann, sind nur noch schwer zu erkennen.
„Hahnemanns Reiseapotheke“
Köthen in Sachsen-Anhalt. In der Wallstraße schließt Liane Just ein grün gestrichenes Haus auf, das heute ein kleines Museum ist. Sie will die Ärztinnen und Ärzte, die nach einem Homöopathie-Kongress noch Lust auf eine Stadtführung hatten, an den Ursprung ihrer Überzeugungen führen: dem Haus, in dem Samuel Hahnemann von 1821 bis 1835 lebte. Drei Kongress-tage liegen hinter den Ärzten, mit Referaten über die Tropfenverdunstungsmethode und die Polaritätsanalyse.
Just steigt über die rote Kordel, hinter der ein Schreibtisch, ein schwerer Sessel und andere Originalmöbel stehen. Sie nimmt einen Kasten aus poliertem Holz aus dem Bücherregal und öffnet ihn, darin stecken mehr als 900 Fläschchen mit Globuli, mit Korkdeckeln verschlossen. „Hahnemanns Reiseapotheke“, erklärt sie. „Noch im Original befüllt.“ Die Ärzte schießen Fotos.
Als Samuel Hahnemann vor 200 Jahren die Homöopathie erfand, war die Medizin in einem erbärmlichen Zustand. Die Ärzte griffen, der Tradition folgend, zu drastischen Kuren, verabreichten Brechmittel und zapften ihren Patientinnen Blut in großen Mengen ab, damit die Krankheiten abflössen. Wer überlebte, den hatte man wohl geheilt.
Hahnemann durchschaute bemerkenswert früh, dass sich seine Kollegen über ihre Erfolge täuschten. Zeitweise gab er seine Praxis auf, auch aus Skrupel. „Auf diese Art ein Mörder oder Verschlimmerer des Lebens meiner Menschenbrüder zu werden“, schrieb er 1808 in einem Brief, „war mir der fürchterlichste Gedanke“.
Die Geburtstunde der Homöopathie
Über Wasser hielt Hahnemann sich mit dem Übersetzen von medizinischer Literatur. Dabei stieß er um 1790 auf eine eigentümliche Erklärung für die Wirksamkeit der Chinarinde gegen Malaria. Die bittere Pflanze stärke den Magen, und der Zustand des Magens strahle auf den ganzen Körper aus. Reine Spekulation, wie so vieles damals. Hahnemann überzeugte es nicht. Also schluckte er selbst Chinarinde, täglich vier Quäntchen. Plötzlich fühlte er sich matt, das Herz raste, der Puls pochte – als habe er sich mit Malaria infiziert. Der Versuch gilt manchen als Geburtsstunde der Homöopathie und anderen als ihr erster Irrtum.
Chinarinde hilft zwar gegen die Krankheit, aber sie löst bei Gesunden keine Malaria-Symptome aus; vielleicht war Hahnemann bloß allergisch. Doch für ihn muss es eine Erleuchtung gewesen sein, so perfekt schien alles zusammenzupassen. Er formulierte den Grundgedanken seiner Lehre: Man müsse ein Leiden mit einem Mittel behandeln, das die Symptome normalerweise auslöst.
Das war ebenfalls spekulativ, und so richtig schien die Behandlung bei Hahnemanns Patienten nicht anzuschlagen. Also begann er mit der Dosis zu experimentieren und verringerte schließlich die Gaben – zunächst aus purer Vorsicht. Mit der Zeit meinte er aber festzustellen, dass die Mittel sogar umso besser wirkten, je stärker er sie verdünnte. Mitunter war der Wirkstoff in Hahnemanns Arzneien gar nicht mehr nachweisbar. Hahnemann theoretisierte später, dass er durch geistartige Kräfte wohl auf das Wasser übergegangen sein müsse.
Heilsam nur im Verhältnis
Gut möglich, dass die Homöopathie eine Schrulle der Medizingeschichte geblieben wäre – wäre nicht 1831 in Europa die Cholera ausgebrochen. Hahnemann verfasste vier Aufsätze über die Behandlung der Krankheit. Und seine Methode hatte Erfolg – scheinbar. Ein Arzt in Raab in Oberösterreich behandelte nach Hahnemanns Vorgaben 154 Patienten, 148 überlebten. Im örtlichen Krankenhaus starben von 284 Cholerakranken 122. Ein Homöopath aus Brünn in Mähren behandelte 631 Patienten, nur 31 verstarben. Bei einem Lemberger Homöopathen überstanden 26 von 27 Patienten die Krankheit.
Hahnemann, beflügelt von den Berichten, schrieb am 7. November 1831 in Köthen einen offenen Brief an den preußischen König. „Erkenne aus den fürchterlichen Sterbelisten, dass deine Ärzte vielleicht mancherlei können, nur heilen nicht.“ Der vermeintliche Erfolg der Homöopathie dürfte einen simplen Grund haben: Sie hatte die geschwächten Patienten schlicht vor den brutalen Behandlungsmethoden der anderen Ärzte bewahrt.
Heilsam erschien die Alternativmedizin nur, weil die Standardbehandlung mit Aderlass, Abführmitteln und Brechkur so gesundheitsschädlich war. So scharfsichtig Hahnemann die Irrtümer seiner Kollegen durchschaute, so blind blieb er bei seinen eigenen.
Dabei misstrauten schon Hahnemanns Zeitgenossen der neuen Lehre. Im Februar 1835 folgten 117 Interessierte in Nürnberg einem Zeitungsaufruf und versammelten sich zu einem Experiment im Gasthaus „Zum rothen Hahn“. Zwei Apothekergehilfen bereiteten Gläser vor. In die eine Hälfte gossen sie destilliertes Schneewasser, in die andere homöopathisch verdünnte Kochsalzlösung. Die Gläser wurden den Versuchsteilnehmern gereicht, niemand wusste, ob er das homöopathische Mittel oder Wasser trinkt.
Studien widerlegen Wirksamkeit
Gewöhnliches Kochsalz, hatte Hahnemann geschrieben, verwandle sich in der Homöopathie zu einer „heroischen und gewaltigen Arznei, die man nach dieser Zubereitung Kranken nur mit großer Behutsamkeit reichen darf“. Wäre das so, hätte in der Gruppe der Nürnberger Versuchsteilnehmer, die das verdünnte Salz schluckten, Spektakuläres passieren müssen, zumindest aber irgendwas, was sich in der anderen Gruppe nicht beobachten ließ.
Etwa einen Monat später kamen die Versuchsteilnehmer wieder ins Gasthaus. Ein Mann, der, wie sich herausstellte, das homöopathische Mittel geschluckt hatte, berichtet von einem „Kollern im Unterleibe“ eine Stunde nach der Einnahme. Ein anderer, der allerdings das Schneewasser getrunken hatte, meinte, eine „ungewöhnliche Regung des Geschlechtstriebes“ wahrgenommen zu haben. 42 der 55 Teilnehmer merkten dagegen: nichts. Egal, was sie eingenommen hatten.
Seither wurden nach diesem Muster viele Studien gemacht: Patientinnen werden per Zufall in zwei Gruppen geteilt, die eine bekommt ein Scheinpräparat, die andere die Arznei. Weder die Versuchsteilnehmer noch diejenigen, die das Mittel aushändigen, wissen, wer was schluckt. So versucht die Wissenschaft alles zu vermeiden, was das Ergebnis in eine bestimmte Richtung lenken könnte.
Globuli wirken nicht besser als ein Placebo
Medikamente müssen normalerweise diesen Test bestehen, um zugelassen zu werden. Die Homöopathie muss das nicht, das Arzneimittelrecht in Deutschland befreit sie von der Pflicht, ihre Wirksamkeit nachzuweisen. Und überprüft man sie in solchen aufwendigen Versuchen, kommt in der Regel wie schon 1835 in Nürnberg heraus: Es gibt keinen nennenswerten Unterschied zwischen beiden Gruppen, Globuli wirken nicht besser als ein Placebo.
Nicole Sagorski sagt, die Homöopathie habe sie fast umgebracht. Die 42-Jährige sitzt in einem Café in Velen, einer Kleinstadt im Münsterland. Es begann mit Regelblutungen, die nicht mehr aufhören wollten. Sagorski, damals Mitte 30 und Rettungsassistentin im Schichtdienst, behalf sich mit Binden, zwei übereinander.
Die Gynäkologin reagierte eigenartig schroff, als Sagorski nach drei Monaten schließlich im Behandlungsstuhl saß. Sie solle sich sofort wieder anziehen, es sei doch ekelig, blutend zur Untersuchung zu kommen. Die Ärztin sprach, so berichtet es Sagorski, von einer stressbedingten Zyklusstörung und schrieb ein Mittel auf, Agnus Castus D2. „Ohne mich überhaupt untersucht zu haben.“
Der Krebs hatte schon gestreut
Von der Apothekerin hörte Sagorski damals zum ersten Mal das Wort Globuli. Eine sanfte Medizin, erklärte die, ohne Nebenwirkungen. Wichtig sei nur, die Kügelchen immer in ungerader Anzahl zu nehmen. Zwei Monate lang schluckte Sagorski fünf Globuli, jeweils morgens, mittags und abends vor dem Essen. Ohne Besserung. Als sie wieder bei ihrer Gynäkologin war, erklärte die, dass das Präparat ja nur unterstützend wirken könne. Ihren stressigen Lebenswandel müsse sie schon selbst ändern.
Sagorski versuchte, den Stress zu bekämpfen, den sie gar nicht empfand. Sie ging länger mit dem Hund spazieren, eine Stunde statt 20 Minuten, die Waldroute statt die durch den Park. Sie sagte ihrem Badminton-Trainer, sie würde in nächster Zeit erst einmal nicht mehr kommen, um weniger Termindruck zu haben. „Ich habe mich wirklich an jeden Strohhalm geklammert.“ Die Blutung blieb.
Schließlich machte Sagorski einen Termin bei einem anderen Frauenarzt aus. Der stellte endlich die richtige Diagnose: Gebärmutterhalskrebs. Im Frühstadium ist die Krankheit gut behandelbar, aber nun, nach fast einem Jahr, hatte der Krebs gestreut, der Arzt riet zu einer Gebärmutterentfernung. Sagorski sagt, sie hätte gerne Kinder bekommen. „Das werfe ich der Ärztin heute noch vor.“ Die Homöopathie hat keine schlimme Behandlung verhindert wie bei den Patienten im 19. Jahrhundert. Aber Sagorksi hätte wegen ihr die bessere des 21. Jahrhunderts beinah verpasst.
Mehr als nur eine Kritik
Eine Studie der Universität Yale aus dem Jahr 2017 zeigt, wie lebensbedrohlich es werden kann, sich in schweren Fällen auf eine Therapie zu verlassen, die auf Illusionen beruht. Ein Team um den Radiologen Skyler Johnson verglich 281 Krebspatienten, die sich nach Methoden der Alternativmedizin wie der Homöopathie behandeln ließen, mit 560 Kranken, die eine konventionelle Therapie bekamen.
Ein Viertel der Krebspatienten mit konventioneller Therapie war nach sieben Jahren verstorben. Von den Patienten, die auf die Alternativmedizin setzten, war die Hälfte tot. Und die, die überlebten? Man kann es sich gut vorstellen: Wahrscheinlich schwärmen sie nun umso begeisterter von der Alternativmedizin, mit der sie die Krankheit gegen jeden Rat der Schulmedizin überstanden zu haben glauben.
Es sind noch viereinhalb Stunden bis zum Auftritt in Mainz. Irgendwie, sagt Natalie Grams, kann sie die Wut verstehen, die ihr Vortrag auslöst. Wer die Homöopathie kritisiert, kritisiert nicht nur ein Verfahren. Er greift die Identität derer an, die an sie glauben. Sie kennt das Gefühl. „Ich dachte ja auch, ich mache meine Praxis bis ich 90 bin“, sagt sie. „Das war mein Leben.“ Und plötzlich war da der Verdacht, ihren Patienten oft gar nicht geholfen, ihnen vielleicht sogar geschadet zu haben.
„Als hätte mir jemand die Drogen genommen“
Natalie Grams rettete sich vor den Zweifeln in die Babypause. Eine Weile überlegte sie, mit einer Art ehrlichen Homöopathie zurückzukehren, mit dem Eingeständnis, dass die Kügelchen nicht wirken, allenfalls als Placebo. Dass es nur das Gespräch ist, das den Patienten gut tut. Aber Gesprächstherapien gibt es schon. Warum sollte sie so etwas unter dem Titel Homöopathie anbieten? Grams sagt, sie sei wie durch einen kalten Entzug gegangen. „Als hätte mir plötzlich jemand die Drogen weggenommen. Ich musste neu denken lernen.“
Die Kommentare, die sie bei Amazon verfasst hatte, löschte sie. Das eigene Buch, mit dem sie alle Kritik ausräumen wollte, wurde ein kritisches. Kurz bevor der Verlag es in den Druck gab, änderte Grams den Klappentext. „Die Ärztin Dr. med. Natalie Grams, Jahrgang 1978, führt eine erfolgreiche homöopathische Privatpraxis in Heidelberg“ – sollte da stehen. Sie rief den Lektor an, gab die letzte Änderung durch: Es sollte „führte“ heißen.
Am 7. Mai 2015 schickte Grams eine Rundmail an ihre Patienten: „Ich habe meine Praxis aufgegeben, da mich die Arbeit an meinem Buch davon überzeugt hat, dass ich die Homöopathie leider, leider nicht länger guten Gewissens als Arzneitherapie anwenden kann.“ Einige fragten, ob Grams einen anderen Homöopathen empfehlen könne. Manche wechselten von da an die Straßenseite, wenn sie Grams in der Stadt sahen.
Verdünnung macht nicht stärker
Hörsaal P2, elf Sitzreihen, 128 ausklappbare Bänke, belegt bis auf den letzten Platz. Ulrike Fröhlich, die Homöopathin, die den Protestbrief geschrieben hat, sitzt in der viertletzten Reihe am Rand. Sie winkt anderen zu, demonstrativ, ruft ein Hallo durch den Raum. Eine Frau in der Reihe vor ihr dreht sich zu Fröhlich um. „So voll“, sagt sie, „woran das wohl liegt?“ Konspiratives Lächeln.
Unten vor der Tafel erklärt Natalie Grams, dass sie mit ihrem Vortrag hoffe, in einen Dialog zu kommen. Sie sagt, dass man sich nicht auf den persönlichen Eindruck als Arzt oder Patientin verlassen dürfe. Dass man sich, so klug und gebildet man auch sei, ständig täusche. Dass man die Wissenschaft brauche, um nicht in die Falle zu tappen. „Wir sind in vieler Weise beeinflussbar.“
Oben in der viertletzten Bank macht Ulrike Fröhlich Fotos von den Folien, die Grams mit dem Beamer an die Wand wirft. „Gott, ist das falsch“, sagt sie. Grams sagt, dass Verdünnung Medikamente nicht stärker machen kann. „Was nicht da ist, kann nicht wirken.“ Ein Zwischenruf: „Schon mal verlassen worden?“ Schweigen. Dann Grölen. Einen Augenblick lang sieht es aus, als ringe Grams vor dem vollen Hörsaal um Fassung. Die ersten klatschen. „Wenn ich jetzt ja sage“, antwortet Grams, „ist die Homöopathie dann wirksam?“
Schlagabtausch im Hörsaal
Es meldet sich eine Patientin. „Ich meine, meine chronischen Leiden losgeworden zu sein und bin damit glücklich“, sagt sie. „Und ich habe meiner Versichertengemeinschaft damit zigtausend Euro erspart, weil ich seit 15 Jahren diesen Weg konsequent gehe.“ Grams sagt, das möge in diesem Fall stimmen, es gebe aber eine große Studie der Techniker Krankenkasse, die besagt, dass Patienten, die sich homöopathisch behandeln lassen, höhere Kosten verursachen. „Der Kostenfaktor macht bei mir wirklich einen erheblichen Unterschied“, sagt die Frau.
„Es gibt Daten“, sagt Grams, jetzt etwas energischer. „Da können Sie nicht einfach Ihre Geschichte daneben stellen.“ „Aber meine ist genauso“, ruft einer in der Reihe dahinter. „Dann sind es zwei Geschichten, die gegen eine Studie mit 45.000 Patienten stehen.“ Eine Rheumapatientin nimmt das Mikrofon, schwärmt von der Alternativmedizin.
„Es hat mir geholfen, egal ob es jetzt Einbildung war oder nicht.“ Grams versucht es freundlich: „Sie wissen, dass eigentlich mein ganzer Vortrag davon gehandelt hat, dass die einzelne Erfahrung für Sie persönlich unendlich wertvoll ist, aber nicht geeignet ist zur Beurteilung der Wirksamkeit eines Präparates.“ „So wie die Einzelerfahrung einer Ärztin, die die Homöopathie meidet“, ruft ein Mann.
Vorwurf der fehlenden Erfahrungen
Ulrike Fröhlich bekommt das Mikrofon. „Frau Dr. Grams“, sagt sie, sie betont den Titel, „ich habe mich erkundigt, wo Sie Ihre Homöopathie-Ausbildung gemacht haben. Von 2009 bis 2011 waren Sie als Praktikantin und dann als Assistentin unter Aufsicht eines erfahrenen homöopathischen Kollegen in der Nähe von Heidelberg aktiv. In dieser Zeit hatten Sie Ihr kleines Kind zu betreuen und konnten zwei bis maximal vier Stunden in der Praxis zubringen.“ Manche werden unruhig.
„Und was hat das mit der Homöopathie zu tun?“, fragt Grams. „Sie haben keine klinische Erfahrung“, sagt Fröhlich. „Natalie Grams“, sagt sie laut und deutlich, wie ein vernichtendes Urteil, „ist eine homöopathische Anfängerin“.
Später, vor dem Hörsaal, umringt von ihren Mitstreitern, sagt Fröhlich, wenn man sie fragt, man könne in der Homöopathie vielleicht nach fünf Jahren mitreden, nach 15 sei man wirklich erfahren. Wenn ein Homöopath dann Zweifel äußere, würde sie sich die selbstverständlich offen anhören. Dass die Zweifel spät kamen, aber früh genug, sagt Natalie Grams, das sei ihr Glück gewesen. Hätte sie noch 15 Jahre weitergemacht, sie hätte einen Vortrag wie diesen heute Abend wohl nie gehalten.
Bernd Kramer, 35, ist freier Journalist. Diese Recherche war für ihn eine der ungewöhnlicheren. Eine Homöopathie-Website warnte vor ihm und ließ über ihn als „Anti-Homöopathie-Pinocchio des Monats“ abstimmen. Gewählt wurde statt ihm aber Natalie Grams.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen








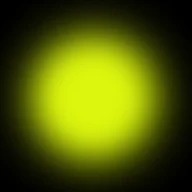














meistkommentiert
Nach Russland-„Manifest“
Ralf Stegner soll Parlamentarisches Kontrollgremium verlassen
Selbstfahrende Fahrzeuge von Tesla
Ein Weg weg vom Privatauto
Rechtsextreme Medien
Doch kein „Compact“-Verbot
Nachrichten im Nahost-Krieg
Waffenruhe wieder vorbei
Volksentscheide in Berlin
Den Willen der Mehrheit kann man nicht ignorieren
Studie zu Bürgergeldempfängern
Leben in ständiger Unsicherheit