Erinnerungskultur: Nakba und deutsche (Un-)Schuld
Die Erinnerungskultur muss sich für palästinensische Erzählungen öffnen. Was 1948 im Nahen Osten geschah, verlangt mehr als einseitige Empathie.

E s ist ein Erfordernis deutscher Geschichte, im Land der Schoah über den israelisch-palästinensischen Konflikt im Nahen Osten mit Bedacht und Achtsamkeit zu sprechen. Was wären Kriterien dafür? Zum Beispiel Genauigkeit, historische Redlichkeit und selbstkritische Betrachtung des Eigenen. Die Realität sieht allerdings anders aus.
Mittlerweile zieht ein beachtlicher Teil des etablierten Deutschland einen Bannkreis um alles, worin der Begriff „Palästina“ vorkommt: Vorsicht, Antisemitismus, besser nicht nähern! So wird die Erinnerung an das Großverbrechen unserer Vorfahren zu einer Waffe, die sich ausgerechnet gegen jene richtet, die von Mitschuld daran anders, als viele deutschen Familien, völlig frei sind: Mal trifft es Juden/Jüdinnen mit missliebigen Ansichten zu Israel, vor allem aber trifft es die Palästinenser und Palästinenserinnen.
200.000 von ihnen leben in Deutschland, mehr als irgendwo sonst in Europa. Sie haben ein Recht darauf, ihre Sicht der Geschichte zu erzählen, und zwar als Teil einer neu verstandenen Erinnerungskultur, die Konflikte nicht scheut und gerade dadurch dichotome, einander ausschließende Narrative überwinden könnte.
Beginnen wir mit dem Jahr 1948. Für Israel die siegreiche Gründung des neuen Staates, für Palästinenser der traumatische Verlust von Heimat, Kultur, Existenz – die Nakba, arabisch für Katastrophe. Ohne Vertreibungen wäre ein mehrheitlich jüdischer Staat nicht möglich gewesen, und Vertreibung verlangte Gewalt; dazu zählten auch Massaker an Zivilisten. Das verübte Unrecht wurde rasch aus dem Bewusstsein verdrängt: Israel sah sich als Nation der Opfer; jeder Dritte im neuen Staat war Holocaust-Überlebender.
Nakba als Tabu
Ohne jeden Zweifel ist der Völkermord an den Juden von einer völlig anderen Dimension und einem anderen Charakter als die Nakba. Aber die Nakba hält als Entrechtung an, und viele Palästinenser sehen sich nun seit über siebzig Jahren gezwungen, den Preis für ein europäisches Verbrechen zu zahlen.
Lange hatten die zwei diametralen Sichtweisen des Jahres 1948 nur gemeinsam, den Schmerz der jeweils anderen Seite geringzuschätzen oder zu leugnen. In Israel war der Begriff Nakba ein Tabu; das beginnt zu bröckeln. Bücher behandeln neue Sichtweisen von israelischen wie arabischen Intellektuellen; vorsichtshalber werden sie nicht ins Deutsche übersetzt.
Erzählt eure Geschichte! Zu dieser Einladung an die hiesigen Palästinenser konnte sich die Erinnerungskultur bisher nicht durchringen. Lieber wird für die israelische Staatsgründung ein Passepartout benutzt, in dem allein die Schoah Platz hat. Die Nakba gilt als historischer Kollateralschaden, außerhalb unserer Zuständigkeit, jenseits unserer Empathie. Logisch ist das nicht: Gerade wenn der Holocaust als eine alle anderen Faktoren überschattende Ursache der Staatsgründung betrachtet wird, wäre die Nakba auch Teil unserer Geschichte, Teil einer gemeinsamen Geschichte.
Palästinensiche Stummheit
Stattdessen wird von hiesigen Palästinensern verlangt, sich in das deutsche Passepartout einzufügen und ihr eigenes Leid als unvermeidbare Folge des größeren Leids anderer zu betrachten. Das kann nicht gelingen. Es führt nur dazu, dass sich die einen schreiend, auch mit unappetitlichen Schreien, artikulieren, während viele andere, die Etablierten der Community, lieber schweigen, um den eigenen Ruf oder die berufliche Zukunft nicht zu gefährden.
Es gebe eine palästinensische Stummheit, schreibt der Philosoph Raef Zreik, die daraus resultiere, dass „es unmöglich ist, eine Version der Ereignisse zu entwickeln, die der herrschenden Grammatik entspricht“. Vielleicht sollten wir dann die Grammatik überprüfen?
Als Nachfahren der Täter im Holocaust tragen wir keine direkte Schuld daran, dass mehr als 500 palästinensische Dörfer unbewohnbar gemacht wurden. Aber wir sind durch die Last des europäischen Antisemitismus in diesen Vorgang verstrickt. Diese Verstrickung verneinen kann eigentlich nur, wer der Ansicht ist, die Schoah habe mit dem Bedürfnis nach einem ethnonationalen jüdischen Staat nichts zu tun gehabt; das wäre eine unhistorische Position. Durch den Völkermord bekam das Projekt Israel für viele Juden und Jüdinnen im Hinblick auf Schutz und Identifikation eine Bedeutung, die der Zionismus zuvor nicht hatte generieren können.
Nakba als Teil deutscher Geschichte
Ich plädiere deshalb dafür, dass wir die Nakba in einem erweiterten Sinne als Teil deutscher Geschichte begreifen und ihrer Erzählung Raum in der Erinnerungskultur geben. Dafür muss man sich keineswegs darüber einig sein, inwiefern die Staatsgründung Israels auch ein Akt von Siedlerkolonialismus war. Man muss sich gleichfalls nicht einig sein über Begrifflichkeiten für heutiges Besatzungsunrecht.
Sondern es geht in einem ersten Schritt zunächst darum, sich einer krassen Asymmetrie bewusst zu werden: Trotz Jahrzehnten des Täterschutzes lebt das Post-NS-Deutschland heute auf der Sonnenseite der Geschichte; die Frontstellung des Kalten Kriegs schützte die Bundesrepublik vor Reparationen und Rache, vor allen tiefgreifenden Konsequenzen eines Menschheitsverbrechens. Unterdessen stehen die Palästinenser als Opfer der Geschichte weiter mit leeren Händen da.
Privilegierung verpflichtet ebenso wie Verstrickung. Umso beschämender, dass jüngst in Berlin sämtliche Veranstaltungen zum Jahrestag der Nakba vorab verboten wurden – es gelte Antisemitismus vorzubeugen. Obwohl rechtsstaatlich dubios, regte sich daran kaum Kritik.
Die linke Palästina-Solidarität früherer Zeiten hat ihrerseits eine Geschichte von Empathiespaltung, von mangelnder Sensibilität für jüdische Befürchtungen und Traumata. Heute ist die Zeit, andere Arten von Allianzen zu bilden und herauszufinden, was eine multiperspektivische Betrachtung in diesem Fall tatsächlich sein könnte. Dass dies leicht ist, hat niemand behauptet.
Unser Mittel gegen Antifeminismus
Wir machen linken Journalismus aus Überzeugung: kritisch, unabhängig und frei zugänglich für alle. Es gibt keinen Bezahlzwang, keine Paywall. Das geht nur, weil sich viele freiwillig beteiligen und unsere Arbeit unterstützen. Auch im Digitalen muss Journalismus, der für mehr Gleichberechtigung eintritt, finanziert werden. Unsere Leser:innen wissen: Journalismus entsteht nicht aus dem Nichts. Damit wir auch morgen noch unsere Arbeit machen können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Schon über 48.000 Menschen machen mit und finanzieren damit die taz im Netz - kostenlos für alle. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5 Euro sind Sie dabei. Jetzt unterstützen










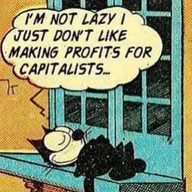



meistkommentiert