Finanzierung von Hochwasserschäden: Mehr tun als Händeschütteln
Olaf Scholz reist durch die Flutgebiete und zeigt sich betroffen. Aber seine Regierung blockiert die einzige Maßnahme, die den Menschen wirklich hilft.

S chon das vierte Mal in diesem Jahr stand Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in einem von Wassermassen verwüsteten Gebiet, um den Menschen dort beizustehen. Es ist zu fürchten, dass das nicht der letzte derartige Termin für ihn gewesen ist. Die Klimakrise tritt immer drastischer in Erscheinung, die Folgen werden immer heftiger.
Scholz sollte mehr tun, als in Katastrophengebieten Hände zu schütteln, finanzielle Hilfen in Aussicht zu stellen und allgemein die Solidarität der Bürger:innen zu beschwören: Er muss endlich dafür sorgen, dass auch seine Minister:innen für Verkehr und Bauen ernsthafte Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele ergreifen, wie es der zuständige Expert:innenrat der Bundesregierung fordert. Und nicht nur das. Der Kanzler muss sicherstellen, dass Bürger:innen vor existenzbedrohenden finanziellen Folgen extremer Wetterereignisse geschützt werden. Dafür gibt es ein einfaches, rasch einführbares Instrument: eine verpflichtende Versicherung für Klimaschäden an Gebäuden.
Anpassungen an den Klimawandel, etwa durch Umbauten und Überflutungsschutz, sind unumgänglich. Aber das reicht nicht. Die Politik sollte klären, wer für die gewaltigen Schäden aufkommt, die durch extreme Wetterlagen entstehen. Dass der Staat zumindest nach großflächigen Überflutungen Hilfen in Aussicht stellt, löst das Problem nicht. Staatliche Gelder zu bekommen ist für Geschädigte kompliziert, darauf verlassen können sich Bürger:innen nicht. Bei einer Versicherung haben sie dagegen einen Anspruch auf Entschädigung.
Es braucht eine solidarische Finanzierung
Aber nur etwa die Hälfte der privaten Hauseigentümer:innen hat eine Versicherung gegen Überschwemmung und andere sogenannte Elementargefahren. Etliche können sich nicht versichern, denn gerade in Gefahrengebieten sind die Policen sehr teuer, nur lückenhaft oder gar nicht zu haben. Verbraucherschützer:innen und die Ministerpräsident:innen der Länder drängen die Bundesregierung seit Jahren, eine verpflichtende Elementarschutzversicherung einzuführen.
Ja, auch die, die glauben, sie bräuchten so etwas nicht, müssten mitbezahlen. So könnte die Versicherung aber für alle bezahlbar werden. Und: Vor Klimaschäden ist niemand sicher. Extremwetter kann jede:n treffen und – ohne finanzielle Vorsorge – ruinieren.
Dass es bis heute keine Pflichtversicherung gegen Überflutung gibt, haben die FDP und ihr Justizminister Marco Buschmann zu verantworten. Die Freidemokrat:innen blockieren die Einführung und damit den Schutz von Millionen Menschen vor einem existenziellen Risiko. Solange Kanzler Scholz das zulässt, wirken seine Solidaritätsappelle in Katastrophengebieten hohl.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen












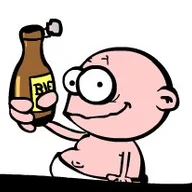






meistkommentiert
Negative Preise durch Solaranlagen
Strom im Mai häufig wertlos
Selenski zu Besuch in Berlin
Militarisiertes Denken
Waffenlieferung an Israel
Macht sich Deutschland mitschuldig?
Klima-Urteil des OLG Hamm
RWE ist weltweit mitverantwortlich
Militärhistoriker über Kriegstüchtigkeit
„Wir brauchen als Republik einen demokratischen Krieger“
US-Handelspolitik unter Donald Trump
Gericht stoppt Trumps Zollpolitik