Kommentar Kopftuchverbot an Schulen: Schafft das Neutralitätsgesetz ab
Eine Lehrerin mit Kopftuch darf an einer Berliner Grundschule nicht unterrichten. Das zu Grunde gelegte Gesetz ist nicht so neutral wie gedacht.
U nd wieder ein Kopftuchurteil. Steigt noch jemand durch? Das Land Berlin zum Beispiel hat ein Neutralitätsgesetz für den öffentlichen Dienst. Keine religiöse Kleidung. Klingt konsequent. Das fand der Richter im nun gesprochenen Urteil auch: Eine Lehrerin mit Kopftuch hat keinen Anspruch darauf, an einer Berliner Grundschule unterrichten zu dürfen. Doch so eindeutig ist es nicht. Das letzte Urteil dieser Art ging für die Lehrerin mit Kopftuch aus.
Das scheinbar so neutrale Neutralitätsgesetz hat nämlich einen dicken Haken: Es gibt Religionen mit Bekleidungsregeln und welche ohne. Zufälligerweise ist das Christentum eine Religion ohne Kleidervorschriften. Das Judentum und der Islam kennen sie aber schon und besonders orthodoxen Vertreter*innen ist es eben auch sehr wichtig, sie einzuhalten. Eine Kippa oder ein Kopftuch kann man nicht mal eben abnehmen wie ein Kettchen mit einem Kreuz daran. Deshalb diskriminiert das Neutralitätsgesetz zwei Minderheitenreligionen in Deutschland.
Der Berliner Senat hat deshalb eine Hintertür offen gelassen: Religiöse Kleidung darf an Oberstufenzentren und Berufsschulen doch getragen werden. Das allerdings ist nun vollends schräg. Entweder das Land möchte neutral sein oder nicht. Halbneutral – das geht nicht.
Berlin sollte das Neutralitätsgesetz abschaffen. Es diskriminiert und kann deshalb nicht funktionieren. Man sollte sich stattdessen fragen, was man eigentlich erreichen will. Kinder sollen so frei wie möglich aufwachsen, das steckt hinter der Angst vor religiöser Beeinflussung. Das ist ein gutes Ziel. Wie wäre es damit: Kinder sollten im Unterricht so viel wie möglich über die Problematik Kopftuch sprechen, damit sie handlungs- und konfliktfähig werden. Zum Beispiel im Ethikunterricht. Praxisnah – und auch an Grundschulen. Von qualifizierten Lehrkräften unterrichtet. In einem Unterricht, der nicht ausfällt, sondern stattfindet. All das kann Berlin im Moment nicht gewährleisten. Stattdessen erleben wir eine weitere fruchtlose Debatte, warten ein weiteres Mal auf irgendeine komplexe Entscheidung aus Karlsruhe oder vom EuGH. Es ist vertane Zeit. Sie kann um einiges sinnvoller genutzt werden.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen



















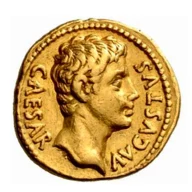

meistkommentiert
Rassismusvorwürfe in Hamburger Kirche
Sinti-Gemeinde vor die Tür gesetzt
Parteitag der Linkspartei
Nach dem Wunder
US-Migrationspolitik
Trump-Regierung will Gerichte umgehen
Wohlstand erzeugt Erderhitzung
Je reicher, desto klimaschädlicher
Petersburger Dialog im Geheimen
Stegner verteidigt Gesprächskontakte nach Russland
Friedrich Merz' Start ins Kanzleramt
Die Stress-Koalition