Syrer*innen in Deutschland: Kein Grund zu gehen
Politiker*innen überbieten sich im Wahlkampf mit Ideen, wie man syrische Geflüchtete zur Rückkehr bewegt. Viele der Angesprochenen verletzt das.

Von
Bisher fehlt es den Forderungen an Substanz. Lediglich Faeser, die noch zuständige Ministerin, hat Details genannt. Kern ihrer Pläne ist, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die Fälle aller Syrer*innen mit Schutzstatus außerplanmäßig überprüft. Normalerweise wird nur einmalig nach drei Jahren sondiert, ob ein Prüfverfahren nötig ist. Dazu kommt es aber nur sehr selten, die allermeisten Geflüchtete behalten ihren Schutzstatus und ihr Aufenthaltsrecht.
Weil sich die Situation in Syrien so dramatisch geändert hat, geht Faeser nun aber wohl davon aus, dass das Bamf vielen den Schutz entzieht. Diese Menschen sollen abgeschoben werden, wenn sie aus keinem anderen Grund eine Aufenthaltserlaubnis haben, etwa weil sie arbeiten.
Ob das wirklich so kommt, bleibt abzuwarten, im Moment ist die Lage in Syrien unübersichtlich. Außerdem würde die individuelle Prüfung so vieler Schutzansprüche das Bamf wohl stark überlasten. Menschenrechtsorganisationen fürchten deshalb, dass die nächste Bundesregierung auf eine pauschale Lösung für alle Syrer setzen könnte, bei der der Einzelfall nicht mehr geprüft wird.
„Viele fühlen sich nicht mehr sicher und willkommen“
Potenziell betroffen wären von den Überprüfungen, die Faeser plant, etwa 600.000 Personen. So viele Syrer*innen haben derzeit einen befristeten Aufenthaltstitel, der auf einem Schutzstatus beruht. Salah Alnachawati gehörte noch bis vor einem Jahr zu dieser Gruppe. Doch seit Ende 2023 hat er eine unbefristete Niederlassungserlaubnis, die ihn wohl vor der Abschiebung schützen würde. Der Politikwissenschaftler arbeitet als Fraktionsassistent bei Volt und der Lokalpartei Gigg in der Gießener Stadtverordnetenversammlung. Gegenüber der taz spricht er von „Besorgnis“ bei vielen Syrer*innen in Deutschland. „Viele fühlen sich nicht mehr sicher und willkommen.“
Die Forderungen deutscher Politiker*innen nennt er „widersprüchlich und realitätsfern“. Die Aussagen „verletzen uns emotional auf eine Weise, die kaum zu beschreiben ist. Das gelte ganz besonders „in einer Phase, in der wir uns bemühen, der deutschen Gesellschaft das entgegenzubringen, was sie uns an Unterstützung und Möglichkeiten geboten hat“. Von der nächsten Bundesregierung erhofft er sich, dass sie sich der „Auswirkungen populistischer Rhetorik“ bewusst ist.
Viele andere Syrer*innen haben inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft und sind deswegen nicht von der Abschiebung bedroht.
Unter diesen mehr als 200.000 Menschen sind viele, die 2015 und 2016 hierhergeflohen sind und erst vor Kurzem eingebürgert wurden. So wie Rana. Sie wohnt in Süddeutschland, wo sie BWL studiert. Die Rückkehrforderungen deutscher Politiker*innen findet sie „einfach nur schlimm“. Seit dem Sturz des Assad-Regimes werde sie immer wieder gefragt, wann sie zurückkehren werde. „Niemand hat gefragt, ob wir uns freuen, allen geht es nur darum, wann wir gehen“, sagt sie. „Dabei spielt die Politik schon eine Rolle.“
Sorgen vor nächster Bundestagswahl
Dass sie von den Plänen von Merz, Faeser und Habeck als deutsche Staatsbürgerin nicht betroffen wäre, ändert für sie nichts daran. Implizit seien alle Syrer*innen gemeint. Sie selbst will höchstens für Urlaube in das Land zurückkehren, in dem ihre Familie lebt, sie geboren wurde und aufgewachsen ist – sobald die Sicherheitslage das zulässt. „Deutschland ist auch mein Heimatland, ich bin Teil der Gesellschaft, hier arbeite und lebe ich“, sagt sie. „Wieso sollte ich gehen?“
Auch die Forderung, dass Syrer*innen, die nicht arbeiten, gehen sollten, findet Rana falsch. „Es gibt oft gute Gründe dafür, dass Menschen nicht arbeiten können, zum Beispiel bürokratische Hürden und Krankheiten.“ Sie schiebt hinterher: „Das Grundgesetz betont die Würde des Menschen. Ich bin mir nicht sicher, ob in Syrien gerade ein würdevolles Leben möglich ist.“
Damit Geflüchtete frei über ihre Rückkehr entscheiden können, sei es wichtig, dass die Bundesregierung eine Möglichkeit für sie schaffe, zunächst für einen kurzen Besuch nach Syrien zurückzukehren, ohne dass sie ihren Schutzstatus verlieren. Innenministerin Faeser hatte zuletzt angekündigt, eine solche Regelung beschließen zu wollen, allerdings begrenzt auf eine einzige Reise.
Für welche Partei sie bei der Bundestagswahl stimmen wird, weiß Rana noch nicht. „Merz und Scholz kommen gar nicht infrage.“ Das liege aber nicht nur daran, wie sich die beiden zuletzt zu Syrer*innen und Geflüchteten allgemein geäußert haben. „Merz ist frauenfeindlich und Scholz war als Kanzler nicht besonders erfolgreich.“ Sie mache sich Sorgen um die Wirtschaft und das Gesundheitssystem. Außerdem brauche es dringend eine andere Mieten- und Wohnungspolitik.
Neben den Geflüchteten gibt es auch noch Syrer*innen in Deutschland, die als Fachkräfte gekommen sind. Auch sie wären von Faesers Plänen nicht betroffen. Moritz etwa arbeitet in einer ostdeutschen Stadt als Arzt. Eigentlich heißt er anders, den Spitznamen haben seine Kollegen für ihn ausgesucht. „Ich weiß auch nicht, warum“, lacht er. Seit 2018 ist er in Deutschland, im Herbst hat er zusammen mit seiner Frau die Einbürgerung beantragt. Weil die aber noch aussteht, dürfen die beiden noch nicht wählen.
Moritz, syrischer Arzt in Ostdeutschland
Zu den Rückkehrforderungen deutscher Politiker*innen sagt Moritz: „Statt über echte Probleme zu sprechen, lenken sie ab, indem sie über die Syrer reden.“ Es sei falsch, nach Syrien abzuschieben. „Der Diktator ist weg, aber das Leben dort ist immer noch sehr schwierig. Das kann man nicht wegzaubern.“ Zu gehen sei für ihn selbst keine Option. „Wir fühlen uns wohl hier, die Leute sind nett, wir haben viele Freunde.“ Außerdem biete ihm die Arbeit in Deutschland gute Möglichkeiten zur Weiterbildung.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






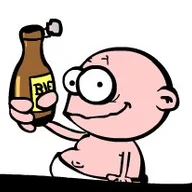


meistkommentiert
Bundeshaushalt
Aberwitzige Anbiederung an Trump
Söder bei Reichelt-Portal „Nius“
Keine Plattform für Söder
Rutte dankt Trump
Die Nato ist im A… von …
Soziale Kürzungen
Druck auf Arme steigt
„Compact“-Urteil
Die Unberechenbarkeit von Verboten
Iran-Briefing verschoben
Zweifel an Ausschaltung des iranischen Atomprogramms