Kommentar Kopftuchverbot in Kitas: Ein Zeichen gegen das Mittelalter
Das Kopftuch hat in unseren Kitas und Schulen rein gar nichts zu suchen. Es degradiert auch sehr junge Frauen bereits zu Sexualobjekten.
D er Hidschab, den muslimische Frauen angeblich aus religiösen Gründen tragen müssen, war bis zur islamischen Revolution in Iran auch in islamischen Gesellschaften kein Muss. Ganz im Gegenteil hatten sich zwischen Atlantik und Indischem Ozean in der Mitte des 20. Jahrhunderts zahlreiche Frauen von diesem tradierten Bekleidungsstück emanzipiert. Aus guten Gründen, denn selbst im Koran gibt es kein explizites Kopftuchgebot. Dort wird nur erwartet, das Haupt gegenüber Allah bedeckt zu halten – was sehr unterschiedlich interpretiert werden kann.
Heute wird der Kopftuchzwang von islamischen Geistlichen meist damit begründet, dass Frauen ihre Reize gegenüber Männern verhüllen sollen, weil die sonst ihrer Hormone nicht Herr werden. Doch eine falsch verstandene Männlichkeit kann und darf nicht missbraucht werden, um Frauen ihrer Selbstbestimmung zu berauben. Genau das aber geschieht, wenn schon 6-Jährige verhüllt werden.
Der Hidschab ist ein politisch gesetztes Symbol gegen die Werte der europäischen Zivilisation. Er ist das offen getragene Bekenntnis: Mit westlichen Werten und Emanzipation wollen wir nichts zu tun haben! So wird er zum Instrument einer archaischen Männerwelt, die den angeblichen Hedonismus westlicher Zivilisation verabscheut.
Das Kopftuch unterwirft Kinder einem Zwang, gegen den sie sich nicht wehren können. Es degradiert auch bereits sehr junge Frauen zu Sexualobjekten. Insofern geht es beim Kopftuchverbot in Grundschulen, wie es die Regierung in Österreich plant, nicht nur darum, jungen Menschen eine selbstbewusste Entscheidung über sich selbst zu ermöglichen – es setzt auch ein deutliches Zeichen gegen im Mittelalter verharrende Kräfte des Islam.
Deshalb: In unseren Schulen hat das Kopftuch nichts zu suchen! Es konterkariert den Kampf, den Generationen von Frauen um ihre Selbstbestimmung geführt haben, und öffnet die Tür zur Unterdrückung jener jungen Frauen, die trotz ihres islamischen Glaubens ihr Leben selbstbestimmt nach europäischen Werten leben wollen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen












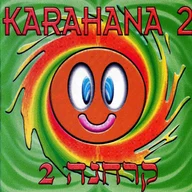





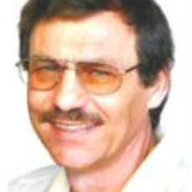


meistkommentiert