Essay über moralische Bequemlichkeit: Auf der richtigen Seite der Geschichte wird es voll
Geschichte ist Chaos, das wir im Nachhinein versuchen, mit Sinn zu füllen. Über Fortschrittsglauben und die Angst vor Sinnlosigkeit.

K ürzlich sprach ich mit einem Kollegen, den ich vor einigen Jahren in einem anderen beruflichen Zusammenhang kennengelernt hatte. Irgendwann sagte er zu mir, jetzt würde man ja endlich auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Dann sagte er etwas anderes, aber darum geht es jetzt nicht.
Die richtige Seite der Geschichte also. Wusste ich gar nicht, dass ich auf der gerade stehe. Ich wusste aber auch nicht, dass die Geschichte überhaupt eine richtige und eine falsche Seite hat. Und dann dachte ich, dass ich diesen Begriff von der „richtigen Seite der Geschichte“ in den vergangenen Monaten auch vielleicht drei-, viermal zu oft gehört hatte und es immer merkwürdig klang. Aber jetzt wurde ich da ja plötzlich selbst verortet, ohne meinen Willen, deshalb wollte ich herausfinden, was es eigentlich mit der richtigen Seite der Geschichte auf sich hat und ob ich da überhaupt stehen will.
In jedem Fall ist es auf der richtigen Seite seit einiger Zeit ziemlich voll: Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping erkannte im Frühjahr seine Verbündeten auf der richtigen Seite der Geschichte; Spaniens Premierminister Pedro Sánchez nannte den Wunsch nach diesem Ort als Grund dafür, dass er ein Waffenembargo gegen Israel forderte; der Philosoph Jan Skudlarek stellte 2023 fest: „Robert Habeck stand auf der richtigen Seite der Geschichte.“
Anfang 2025, es war Wahlkampf, rief Christian Lindner in Freiburg einigen Demonstranten, die seine Rede störten, zu: „Ihr steht auf der falschen Seite der Geschichte.“ Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass Lindner auf der richtigen Seite steht. 2023 erkannte die „Zeit“, dass Joe Biden auf der richtigen Seite der Geschichte stand, wo übrigens seit 2016 auch Angela Merkel steht, jedenfalls wenn es nach Barack Obama geht.
Alle wollen da hin
Zwei Jahre später gesellte sich auch Belgien dazu, ja, ganz Belgien, denn der damalige belgische Ministerpräsident Charles Michel stellte das für sein Land beim UN-Sondergipfel für den Migrationspakt fest. Ach, und natürlich steht auch die SPD auf der richtigen Seite der Geschichte, jedenfalls versicherte das 2021 Olaf Scholz dem verdutzten Armin Laschet. Und heute möchte ja auch gerne jeder Deutsche endlich mal auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, deshalb ist man gegen Trump, trennt den Müll, kennt seine Privilegien, hört Podcasts über mentale Gesundheit, kauft Bücher in der kleinen, netten Buchhandlung ums Eck, hasst RB Leipzig, kennt den Unterschied zwischen „toxisch“ und „problematisch“ und findet das neue Taylor-Swift-Album unterkomplex.
Das Dumme ist nur, dass die Geschichte ja voll ist mit Menschen, die sich schon mal auf der richtigen Seite sahen und dann durch die Geschichte selbst eines Besseren belehrt wurden: Im 11. Jahrhundert zogen Kreuzritter los in der Annahme, sie kämpften im Auftrag Gottes und seien das Werkzeug der Geschichte; im 16. Jahrhundert hielten spanische Konquistadoren die Christianisierung Lateinamerikas für Zivilisation, nicht für Eroberung; im 19. Jahrhundert glaubten Kolonialmächte, sie trügen „Fortschritt und Licht“ in die Welt – und exportierten Gewalt, Rassismus und Ausbeutung; im 20. Jahrhundert waren Bolschewiki, Faschisten und Neoliberale auf ihre je eigene Weise überzeugt, Geschichte zu vollstrecken. Es scheint fast so, dass die richtige Seite der Geschichte fast immer die falsche ist – nur eben später.
Trotzdem wollen da alle hin – nur warum? Vielleicht weil sie glauben, dass „die Geschichte“ einem Zweck folgt, dass sie Sinn ergibt und dass am Ende der Geschichte die, die auf der guten Seite standen, belohnt werden und die, die auf der falschen Seite standen, bestraft. Ist allerdings im Prinzip ein alter Hut, mit dem schon Augustinus im 4. und 5. Jahrhundert hausieren ging.
Für ihn war Geschichte vor allem Heilsgeschichte, Ausdruck einer göttlichen Vorsehung. Hegel säkularisierte diesen Gedanken 1.400 Jahre später: Geschichte war für ihn nicht bloß eine Abfolge von Ereignissen, sondern ein prozesshafter Ausdruck des Weltgeistes, der sich in der Zeit entfaltet – jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Das würde bedeuten, dass Geschichte nach vorne geht, dass sie Vernunft besitzt, dass sie Sinn ergibt.
Marx, der Hegel unfallfrei lesen konnte, stellte diesen Gedanken vom Kopf auf die Füße. Anstelle des „Geistes“ setzte er den ökonomischen Unterbau: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.“ Für Marx ist der Lauf der Geschichte gesetzmäßig, das Ziel – die klassenlose Gesellschaft – vorgezeichnet. Aus Theologie wird Ökonomie, aus idealistischer Dialektik materialistische. Von dieser fixen Idee scheinen sich einige Linke bis heute nicht erholt zu haben, da kamen selbst Walter Benjamin und Michel Foucault nicht gegen an.
Benjamin wendet sich explizit gegen den Fortschrittsglauben von Hegel und Marx. In seiner berühmten „These IX“ über den Begriff der Geschichte beschreibt er den Engel der Geschichte, der rückwärts in die Zukunft stürzt: „Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft.“
Geschichte hat keinen Sinn und keinen Plan. Und Foucault zerschlägt die klassische Geschichtsvorstellung als kontinuierlichen Prozess oder Fortschritt. Geschichte ist für ihn kein Strom, sondern ein Netz aus Diskursen, Machtverhältnissen und Brüchen. Es gibt kein Ziel, keinen Fortschritt, keine Moral – nur Macht und Diskurs. Spätestens da hätte man sich darauf einigen können, dass Geschichte keinen Sinn hat. Blöd halt nur, dass der Mensch ohne Sinn nicht leben will.
Der Glauben an den Sinn der Geschichte hat den Glauben an Gott abgelöst. Daraus entsteht die Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet. Aber so funktioniert Geschichte nicht. Geschichte ist Chaos, das wir im Nachhinein versuchen, mit Sinn zu füllen. Und die „richtige Seite“ klingt zwar nach moralischer Gewissheit, ist aber philosophisch hohl, denn sie setzt ja voraus, dass die Geschichte nur zwei Seiten habe – und dass diese Seiten moralisch bestimmbar seien.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Aber Geschichte urteilt nicht – Menschen urteilen. Die Metapher von der „richtigen Seite“ ist also ein rhetorischer Trick, der Moral in Notwendigkeit verwandelt. Der Trick ersetzt Argument durch Heilsglaube. Wer sich auf die „richtige Seite“ stellt, beansprucht implizit die Zukunft für sich und seinesgleichen. Dadurch wird aber jede politische Auseinandersetzung in ein Geschichtsdogma verwandelt. Schon komisch, dass ausgerechnet Linke an dieser säkularisierten Form des Heilsplans festhalten. Aus dem „Reich Gottes“ wurde die „klassenlose Gesellschaft“, aus Erlösung Fortschritt. Geschichte, so der Irrglaube, sei immer Fortschritt, und im Moment besteht dieser Fortschritt unter anderem aus Diversität, Klimagerechtigkeit, Antifaschismus.
Dieses magische Denken bietet Orientierung, Sicherheit – und Kontrolle. Es gibt ja überall, links, rechts, mitten in der Mitte, diese autoritäre Sehnsucht, alles kontrollieren zu wollen: das ZDF, Instagram, Chefgehälter, Begehren, Pronomen, Kitaerzieher … Wer also glaubt, die Geschichte, auf deren richtiger Seite man ja bombenfest steht, würde einen Sinn ergeben, der will das Unkontrollierbare zähmen.
Aber Geschichte ist unübersichtlich und grausam. Das ist allerdings für viele nur schwer zu ertragen, deshalb sucht man nach Mustern, Zielen, Gesetzen, denn die Vorstellung eines Plans – völlig wurscht, ob göttlich, dialektisch oder moralisch – beruhigt ungemein, vor allem das eigene Gewissen.
Doch der Glaube an den Sinn der Geschichte ist nicht emanzipatorisch, sondern ein Versuch, Angst und Ohnmacht zu kontrollieren. Er produziert Gewissheit – und damit Autorität. Und hier verläuft die eigentliche Bruchlinie: Wer behauptet, den Sinn der Geschichte zu kennen, leitet daraus politische Notwendigkeit ab. Und dadurch entsteht die Legitimation, zu steuern, zu disziplinieren, zu sanktionieren. Dabei sollten man doch genau dieser Gewissheit misstrauen, denn die Berufung auf den Sinn der Geschichte ist selbst eine Form von Herrschaft. Emanzipation müsste aber eigentlich bedeuten, ohne eine solche Gewissheit zu handeln.
Vielleicht werde ich meinen Kollegen mal auf der richtigen Seite der Geschichte besuchen. Aber ich bleibe nicht lange. Es gibt dort ja nichts zu tun.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
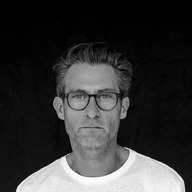















meistkommentiert