Erhöhung des Verteidigungsetats: Kurzschlüssiger Aufrüstungskurs
Die europäischen Demokratien werden nicht nur von außen, sondern auch massiv von innen bedroht. Dagegen helfen immer höhere Militärausgaben nicht.

D er Haushalt für 2026, den der Bundestag am Freitag beschließen will, ist einer der Superlative: Seit Gründung der Bundesrepublik hat dieses Land noch nie so viel Geld für sein Militär bereitgestellt. Und es soll noch viel mehr werden. Die 108 Milliarden im kommenden Jahr sollen bis 2029 auf mehr als 150 Milliarden Euro ansteigen. Die schwarz-rote Koalition scheint fest entschlossen, die Ankündigung von Kanzler Friedrich Merz, die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas zu machen, in die Tat umzusetzen.
Wer sich die Debatte dazu am Mittwoch im Bundestag angeschaut hat, konnte schon überrascht sein, wie selbstverständlich geworden ist, was angesichts der deutschen Geschichte alles andere als selbstverständlich sein sollte. Bis auf die Linke waren sich alle Fraktionen einig, dass für die Aufrüstung des deutschen Militärs kein Preis zu hoch ist. So verpuffte auch der berechtigte Hinweis des Linken-Haushälters Dietmar Bartsch auf die weitaus geringeren Verteidigungsausgaben der europäischen Atommächte Frankreich und Großbritannien.
Frankreich will im kommenden Jahr seine Militärausgaben auf etwas mehr als 57 Milliarden Euro steigern, Großbritannien auf rund 71 Milliarden Euro. Schon das ist sehr viel, aber weitaus weniger als Deutschland plant – obwohl die nukleare Bewaffnung mit hohen Kosten verbunden ist. Den Preis dafür muss jedoch in allen drei Ländern die jeweilige Bevölkerung tragen.

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
Damit aber destabilisieren die exorbitanten Ausgaben für das Militär den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dabei haben jetzt bereits sowohl in Frankreich und Großbritannien als auch in Deutschland extrem rechte Parteien bedrohliche Zustimmungsraten. Bezahlen müssen das zudem übrigens auch notleidende Menschen in ärmeren Regionen auf unserem Globus, denen die humanitäre Hilfe gekürzt wird. Das befeuert die Krisen auf der Welt.
Der russische Überfall auf die Ukraine 2022 hat zu Recht für einen Schock in Europa gesorgt. Aber in der angstgetriebenen und teilweise irrationalen Debatte über das ohne Zweifel aggressive Agieren Putins geht ein zentraler Aspekt offenkundig unter: Die Demokratien in Europa sind nicht nur von außen, sondern auch von innen bedroht, und das sogar massiv.
Die europäischen Nato-Staaten haben schon jetzt das militärische Potenzial, um selbst ohne die USA ausreichend abschreckungsfähig gegenüber Russland zu sein. Aber was schützt sie vor den rechten antidemokratischen Kremlfreunden im Inneren? Die immer aberwitzigere Steigerung der Militärausgaben sicher nicht.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen









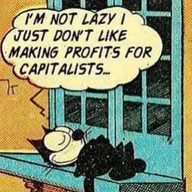




meistkommentiert