Das Deutschlandticket ist nicht sozial: Deutschlandticket muss sterben, damit wir leben können
Die staatlich geförderte Fahrkarte ist ein Geschenk an die eher gut verdienenden Pendler:innen. Wirklich sozial wäre ein Modell mit gestaffelten Preisen.
W arum manche das Deutschland-Ticket immer noch als Erfolg ansehen, Stichwort „Revolution für die Mobilität“, bleibt schleierhaft, denn es war von Anfang an nur ein Komfortprogramm für die Mittelschicht und gehört deshalb abgeschafft.
Das Deutschlandticket wird 2026 teurer – schon wieder. Dabei sollte der Preis eigentlich bis 2029 stabil bleiben. Doch am Donnerstag haben die Verkehrsminister:innen darauf geeinigt, dass das Ticket ab Januar 63 Euro im Monat kosten soll, statt bisher 58 Euro. Ist das noch sozial? Nein, meint Matthias Kalle und fordert, das Ticket abzuschaffen. Tobias Schulze hält knallhart dagegen. Sein Contra lesen sie hier.
Man muss sich mal ehrlich machen: Ein Fixpreis von zunächst 49 Euro, jetzt 58 Euro und ab Januar 63 Euro mag für die breite Mehrheit der Beschäftigten verkraftbar sein – für Menschen mit sehr geringem Einkommen bedeutet er eine kaum zu überwindende Belastung. Wer Bürgergeld bezieht, hat im Regelsatz aktuell 563 Euro im Monat. Davon sind für den gesamten Bereich Verkehr knapp 9 Prozent vorgesehen – also rund 50,50 Euro.
Mit 49 Euro lag das Ticket anfangs exakt an dieser Grenze. Mit 58 Euro überschreitet es sie bereits. Bei 63 Euro klafft die Lücke noch deutlicher. Rechnet man es durch, müsste der Regelsatz auf 575,50 Euro steigen, damit damit die vorgesehene Verkehrspauschale das Ticket tatsächlich abdeckt. Das wären 12,50 Euro mehr als heute. Solange dieser Schritt nicht gemacht wird, zwingt das Deutschland-Ticket Bedürftige dazu, anderswo zu sparen: an der Ernährung, an Kleidung oder an Kultur.
Das eigentliche Paradox liegt darin, wer von diesem milliardenschweren Projekt am stärksten profitiert. Am meisten sparen jene, die ohnehin vergleichsweise gut verdienen: Pendlerinnen, die zuvor mehrere Hundert Euro für Monatskarten im Regionalverkehr gezahlt haben. Für sie ist das Deutschland-Ticket ein Geschenk. Arbeitslose, Rentner mit Grundsicherung oder Geflüchtete konnten sich das Ticket schon für 49 Euro kaum leisten, geschweige denn jetzt.
Gut, sagen die Verteidiger des Deutschland-Tickets, muss es halt günstiger werden. Aber das ist doch nicht der Punkt. In seiner jetzigen Form wird das Ticket jedes Jahr mit Milliarden aus den öffentlichen Haushalten gestützt – also auch mit den Steuern jener, die sich das Ticket selbst gar nicht so einfach leisten können. Das Ergebnis ist also eine Subvention für die Mitte und nicht für die, die es am dringendsten bräuchten.
Natürlich gibt es Sozialtickets. In Berlin etwa zahlen Berechtigte 19 Euro, allerdings nur für die Tarifzonen AB. Wer nach Brandenburg hinausfahren will, muss draufzahlen. Andere Städte und Bundesländer haben ebenfalls Vergünstigungen, aber sie sind regional sehr unterschiedlich, oft an bürokratische Nachweise gebunden und keineswegs flächendeckend.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Damit werden Bedürftige erneut in die Rolle gedrängt, Anträge zu stellen und Bescheide vorzulegen, während die Mittelschicht ihr Deutschland-Ticket bequem per App bucht. Wenn das Solidarität sein soll, dann kann man es gleich lassen.
Wer wirklich solidarisch gestalten will, muss ein nach Einkommen gestaffeltes Modell auf den Weg bringen: ein Ticket für 10 oder 20 Euro für Bedürftige, ein regulärer Preis für durchschnittlich Verdienende und ein höherer Beitrag für die, die gut verdienen. So kann das Deutschland-Ticket weg, denn es bringt die Solidargemeinschaft nirgendwohin.
Das sehen Sie ganz anders? Tobias Schulze auch. Hier lesen Sie sein Contra.
Anmerkung der Redaktion: Unser Autor hat sich leider verrechnet: In einer früheren Version des Textes heißt es, der Regelsatz müsse auf 703 Euro steigen, um die Kosten zu decken. Das wäre zwar wünschenswert, ist aber falsch.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
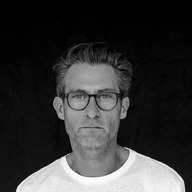













meistkommentiert