Soziologe über Radikalismus der AfD: „Es hat sich etwas verschoben“
Wilhelm Heitmeyer hat sich jahrzehntelang mit autoritären Einstellungen und Rechtsextremismus beschäftigt. Wie erklärt er Deutschlands Rechtsruck?

taz: Herr Heitmeyer, viele haben die rechtsradikale AfD lange als Problem des Ostens gesehen. Jetzt hat sie auch in den westdeutschen Flächenländern Bayern und Hessen mit 15 und 18 Prozent ihre bisher höchsten Ergebnisse eingefahren. Was ist da los?
Wilhelm Heitmeyer: Man muss beginnen bei der Charakterisierung der AfD. Landläufig ist immer noch verharmlosend von Rechtspopulismus die Rede, manchmal auch „in Teilen rechtsextremistisch“. Ich frage dann immer, aber was ist dann mit den anderen Teilen? Inzwischen schreckt auch die Einordnung als rechtsextremistisch die Sympathisanten und Wähler nicht mehr ab. Das war anders zu Zeiten der NPD und Republikaner. Und Rechtspopulismus ist ohnehin eine kriterienlose, leere Hülle, in die man alles reinschütten kann. Der Begriff zielt ja lediglich auf Erregungszustände ab, die AfD geht aber weit darüber hinaus. Sie ist viel gefährlicher, weil sie für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen attraktiv ist.
Wie charakterisieren Sie denn die AfD?
Es ist autoritärer Nationalradikalismus. Daraus erklärt sich der derzeitige Höhenflug. Die AfD propagiert ein autoritäres Gesellschaftsmodell mit traditionellen Lebensweisen – gegen pluralistische Kultur und für ethnische Homogenität. Das Nationalistische ist die Überlegenheitsvorstellung von deutscher Kultur. Wirtschaftspolitisch wird „Deutschland zuerst“ gefordert. Dann gibt es noch die ethnisch nationale Identitätspolitik mit Deutschsein als Identitätsanker und die Neudeutung deutscher Vergangenheit. Die Radikalität besteht vor allem in der Kommunikation und Mobilisierung mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gegen bestimmte markierte Bevölkerungsgruppen. Diese Bestandteile sind attraktiv, daran muss man Wahlergebnisse interpretieren.
Was ist aus Ihrer Sicht in Hessen und Bayern passiert?
Hier ist deutlich geworden: Die AfD ist gesamtdeutsch. Es gab in Bayern einen deutlichen Rechtsruck. Markus Söder hat im Wahlkampf mit ausgrenzender Identitätspolitik gespielt, als er sagte: Die Grünen haben kein Bayern-Gen. Ebenso Hubert Aiwanger mit seinen Parolen davon, dass die normalen Leute sich die Demokratie zurückholen sollen. Das ist original AfD-Sprech. Und die spielt ohnehin mit ihren Kernthemen Migration und Kriminalität. In Bayern haben mehr als zwei Drittel diese drei Parteien gewählt – den größten Zuwachs aber hatte die AfD. Die Milieus dieser Parteien liegen ziemlich eng beieinander.
Was ist das Auffällige an diesen Milieus?
Beachten muss man vor allem das, was ich rohe Bürgerlichkeit nenne. Das Milieu leidet kaum unter sozialer Not, macht sich aber Statussorgen und hat Irritationen. Es hat eine glatte Fassade, aber dahinter existiert ein Jargon der Verachtung, gerade gegenüber den von der AfD negativ markierten sozialen Gruppen. Das spielt der AfD in die Karten. Was mir Sorgen macht: Dieses Milieu ist in beträchtlichem Maße in Westdeutschland vorhanden und für die AfD noch immer nicht ausgereizt.
Was auffällt: Die AfD ist auf dem Land stark und in der Stadt schwach. Warum?
Das ist eine Parallele zu Ostdeutschland, das ja eine besondere sozialgeografische Struktur hat. Wir haben in unseren Untersuchungen zwischen 2002 und 2012 immer wieder festgestellt: Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist in Kleinstädten immer höher als in größeren Städten. In dörflichen und kleinstädtischen Gebieten ist die soziale und kulturelle Homogenität groß, ebenso gibt es eine stärker ausgeprägte Konformität, die wiederum mit den Charakteristika des Autoritären korrespondiert: die nationalistische Überlegenheitsattitüde äußert sich dann in Radikalität gegenüber zugewanderten Gruppen mit anderen kulturellen Hintergründen. In diesen Sozialformationen ist die AfD erfolgreich. Und: Die etablierten Parteien haben die ländlichen Gebiete in ihrer Bedeutung unterschätzt und vernachlässigt.
Ebenso haben jetzt im Westen wie auch zuletzt in Sachsen-Anhalt vermehrt jüngere Menschen die AfD gewählt. Was hat sich da verschoben?
Bei den Jüngeren kam der AfD sicher ihr riesiger Vorsprung bei den sozialen Medien zugute. Die AfD agitiert viel auf Tiktok – und ist hier vor allem für junge Männer attraktiv. Man denke etwa an Maximilian Krah, der in Tiktok-Videos sagt: „Echte Männer sind rechts.“ Gerade die Jüngeren halten sich immer länger auf digitalen Plattformen auf – dort gibt es Kommunikations- und Mobilisierungslücken bei den etablierten Parteien.
Viele Politologen sagen, dass die AfD-Wählerschaft einen harten rechtsextremen Kern hat und einen Anteil, der die Ampel abstrafen wollte, sogenannte Protestwähler. Wie sehen Sie das?
Der Begriff Protestwähler oder Protestpartei ist eine Selbstberuhigungsformel. Darin steckt: Wenn wir uns nur Mühe geben und vielleicht die Renten erhöhen, kommen die alle zurück. Das ist eine Fehleinschätzung. Die autoritären Einstellungsmuster, von denen die AfD profitiert, hat es schon lange vor ihrer Parteigründung gegeben. Diese Personengruppen waren häufig wahlpolitisch vagabundierend, wählten mal SPD, CDU oder wanderten ab in die wutgetränkte Apathie der Nichtwählerschaft. Erst 2015, als eine größere Anzahl von Geflüchteten nach Deutschland kam und die AfD dagegen mobilisierte, hatte diese Wählergruppe eine fixe Anschlussstelle. Seitdem hat die AfD eine stabile Wählerschaft.
Aber erklärt das diejenigen, die in Hessen direkt von den Grünen oder von der SPD zur AfD gewandert sind?
Ja, es hat sich etwas verschoben. Aber man muss beim Höhenflug der AfD wesentliche Komponenten zusammenbinden. In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich der Neoliberalismus entsichert, zugleich wurde der Sozialstaat demontiert, jetzt erleben wir multiple Krisen. Es gibt langfristige Erklärungen und kurzfristige Trigger, die auch Grünen-Wähler und Sympathisanten verschreckt haben: zum Beispiel das Heizungsgesetz. Das eigene Haus wird auf einmal zum Schrecken und zur Bedrohung, weil man nicht weiß, wie man das finanzieren soll.
Aber waren dann die Landtagswahlen in Bayern und Hessen doch eine Protestwahl?
Protest allein reicht nicht als Erklärung. Der größere Kontext sind die letzten beiden Jahrzehnte mit zahlreichen Krisen. Wir hatten nach 9/11 eine islamistisch-kulturelle Krise, 2005/06 gab es eine Hartz-IV-Krise, 2008/09 eine Finanz- und Wirtschaftskrise, 2015/16 gab es viele Geflüchtete und sozialkulturelle Verunsicherung. Und dann kam 2019 die Coronakrise. Während die anderen sektorale Krisen waren, war die Pandemie eine systemische Krise. Sie wirkt bis heute nach, wodurch wir jetzt multiple Krisen haben – denn gleichzeitig rückt die Klimakrise uns direkt auf die Pelle und auch die Ukrainekrise ist nah.
Was macht das mit uns?
Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass die politischen Routinen der Problembekämpfung nicht mehr funktionieren – schon gar nicht kostenlos und schnell. Vor allem können die eingelebten Zustände vor der Krise nicht wiederhergestellt werden. Daraus entstehen wahrgenommene oder erfahrene Kontrollverluste über die Zukunft. Teile der Bevölkerung haben das Gefühl, dass man die eigene Zukunft und den eigenen Status nicht beeinflussen kann. Viele fürchten Wohlstandsverluste und die Selbstwirksamkeit nimmt ab. Hier setzt die AfD an mit ihrer Parole der Wiederherstellung von Kontrolle. 2017 hat Alexander Gauland schon gesagt: „Wir holen uns unser Land zurück.“ Die AfD will die Zahl der Geflüchteten und die Kriminalität kontrollieren. Das sind Ansatzpunkte, die auch bei Grünen-Wählern ziehen. Die sind ja auch nicht alle ideologisch gefestigt. Die Bindungswirkung der Parteien nimmt ab.
Inwiefern spielen Desinformation und Verschwörungsideologien eine Rolle?
Personen mit erfahrenen und wahrgenommenen Kontrollverlusten sind besonders anfällig für Verschwörungsideologien. Die AfD ist völlig bedenkenlos mit der Ausbeutung solcher Erzählungen, gepaart mit einer Emotionalisierung sozialer Probleme als Kontrollverluste, kombiniert mit der Opferrolle.
Was sind aus Ihrer Sicht Gegenstrategien?
Das ist eine schwierige Frage. 2001 habe ich in „Schattenseiten der Globalisierung“ die These vertreten, dass sich sukzessiv eine Demokratieentleerung auftut. Wir konnten in einer Langzeituntersuchung zeigen, dass der politische Apparat funktioniert, aber Vertrauen erodiert. Diese Entwicklung hat sich immer weiter vollzogen.
Was war ihr Schluss daraus?
Die Politik muss Vertrauen zurückgewinnen. Sie muss Repräsentationslücken schließen, die es zweifellos besonders im Osten gibt. Menschen müssen sich gesehen fühlen. Wer nicht wahrgenommen wird, ist ein Nichts. Da hat die AfD mit ihrer Strategie in vielen Gebieten ganz eindeutig vieles erreicht nach dem Motto: „Wir machen euch wieder sichtbar“. Die anderen Parteien haben die ländlichen Gebiete vernachlässigt, diese Repräsentationslücken rächen sich jetzt.
Warum gibt es derzeit keine Gegenbewegungen?
Soziale Bewegungen scheinen wie gelähmt. Ich habe den Eindruck, dass dies daran liegt, dass es derzeit nicht gelingt, eine zuversichtliche Vision zu formulieren, die mobilisierend wirkt. Die AfD hingegen hat eine motivierende autoritäre Vision gegen die offene Gesellschaft und liberale Demokratie, von der sich relevante Teile der Bevölkerung angesprochen fühlen.
Wie kann es gelingen diesen Anteil wieder zu verkleinern?
Es braucht unter anderem eine ganz schnelle Aufholjagd der anderen Parteien in den digitalen Medien, bei Tiktok und Co. – gerade um auch bei Jüngeren durchzudringen. Ebenso muss man die Auseinandersetzung suchen: Überall in Medien und Politik müssen die Konsequenzen der politischen Parolen der AfD aufgezeigt werden. Einige der politischen Forderungen wären ja selbst gegen die AfD-Wähler in ihren sozialen Lagen gerichtet. Der Erfolg bei Aufklärung kann aber dauern, weil zahlreiche Milieus in digitalen Medien gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Wir haben keine Öffentlichkeit im Singular mehr, die alle inkludiert, sondern nur eine im Plural. Und zu guter Letzt ist es ganz wichtig, die Zivilgesellschaft zu mobilisieren.
Was heißt das für Sie konkret?
Die Zivilgesellschaft scheint mir zu wenig konfliktfähig zu sein. Es fehlt meiner Ansicht nach an Auseinandersetzungen in nahen sozialen Bezugsgruppen. Was passiert in der Verwandtschaft, im Sportverein, auf der Arbeit, in der Kirchengemeinde oder mit den Freunden beim Kochen? Die politische Wirksamkeit in den nahen sozialen Bezugsgruppen ist hochgradig unterschätzt.
Also Mund aufmachen am Stammtisch, wenn jemand mit rassistischen Argumentationen um die Ecke kommt?
Ja, wenn man dann nicht gleich reagiert, verfestigt sich das Klima und die Position der AfD normalisiert sich. Denn genau darum geht es der AfD. Das sagen ja auch die Eliten der Partei ganz offen: Wir wollen in gesellschaftliche Institutionen eindringen, in nahen Bezugsgruppen unsere Positionen normalisieren. Was zu einem bestimmten Zeitpunkt als normal gilt, kann man nicht mehr problematisieren. Das Schwierige ist: In Bezugsgruppen ist man in der Regel allein und muss unter Umständen harte soziale Kosten tragen und wird möglicherweise aus Bezugsgruppen ausgeschlossen, je nachdem, wie weit die Normalisierung fortgeschritten ist. Das ist mein Plädoyer: Sich über die eigene Konfliktfähigkeit Gedanken zu machen. In den nahen sozialen Bezugsgruppen zeigt sich erst, ob wir in der Lage sind, für eine humane Gesellschaft einzutreten.
Wo stehen Sie in der Verbotsdiskussion?
Das ist der völlig falsche Weg: Ein Verbotsantrag würde Jahre bis zur Befassung dauern und in der Zwischenzeit zu großen und erheblichen Solidarisierungseffekten führen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










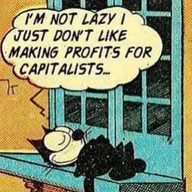
meistkommentiert
Baerbock zur UN-Generalversammlung
Undiplomatische Kritik an Nominierung für UN-Spitzenjob
Repression an der Columbia University
Es wird ein Exempel statuiert
Vertrauen in die Politik
Kontrolle ist besser
Erfolg der Grundgesetzänderung
Ein wahres Husarenstück
Schauspielerin Rachel Zegler
Rassismus gegen Schneewittchen
Neue Bomben auf Gaza
Israel tötet Hamas-Minister und Zivilisten