Niedergang der Linkspartei: Nur ein historischer Irrtum?
Sahra Wagenknecht gilt als Totengräberin der Linkspartei. Dabei ist das Ende der Partei eine nahezu zwangsläufige Entwicklung.

D ie Linkspartei kämpft um ihr Überleben. Die Ergebnisse der Europawahl und der Kommunalwahlen waren desaströs – und nur wer an Wunder glaubt, wird davon ausgehen, dass die Partei in den nächsten Bundestag kommt. Selbst der Behelfsweg über drei Direktmandate, wenn wie zu erwarten die Fünfprozenthürde gerissen wird, ist utopisch: Die Konkurrenz durch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist in den ehemaligen linken Wahlkreis-Hochburgen zu groß. Und außer in Thüringen mit dem Zugpferd Bodo Ramelow dürfte der Wiedereinzug in die ostdeutschen Parlamente äußerst schwierig werden.
Die dominierende Erzählung des Niedergangs geht so: Die dämonische Sahra Wagenknecht hat die Linkspartei durch ihre Abspaltung kaputt gemacht. Aber das ist eine zu einfache und zu bequeme Erklärung. Abspaltungen funktionieren nur, wenn die Abtrünnige auf einer sozialen Basis in der Partei fußen kann, wenn sie weiß, dass sie Gefolgsleute hat. Abspaltungen sind ein Symptom, nicht die Ursache dafür, dass etwas schiefläuft.
Man kann die Geschichte der Linkspartei im Rückblick auch ganz anders deuten: nicht als gleichsam natürliche Erfolgsgeschichte, die erst durch innere Richtungskämpfe zerstört wurde. Sondern vielmehr als Schimäre, die jetzt auf dem Boden der Realität gelandet ist. Die Linkspartei, früher PDS, konnte ihr Überleben nach 1990 nur durch eine Kette von glücklichen Fügungen sichern, die jetzt gerissen ist. Ohne diese wäre sie sehr wahrscheinlich schon längst Vergangenheit.
Glücksmoment Nummer 1: Es war ironischerweise die Ost-SPD mit ihrer Aufnahmesperre für ehemalige SED-Mitglieder in den Umbruchjahren 1989/90, die der SED/PDS das Überleben sicherte. Hunderttausende ehemalige SED-Mitglieder suchten nach 1989 eine neue politische Heimat, die die SPD verschloss. So sicherte sich die PDS Unterstützer und Trotzwähler und konnte ihre Funktion als Kümmererpartei aufbauen für alle jene, die „der Westen“ nicht gewollt hat.
Glücksfall Nummer 2: Das Ausnahmetalent Gregor Gysi war die zentrale Integrationsfigur der Partei und mit seiner gewitzten Art das sympathische Gesicht nach außen (nach innen konnte er durchaus hart durchgreifen) und machte die PDS jenseits der Kernklientel attraktiv. Gysi ist politisch gesehen Vergangenheit und steht als Zugpferd nicht mehr zur Verfügung.
Drittens war es wieder die SPD, die der PDS in aussichtsloser Lage das Überleben sicherte. 2002 flog die PDS aus dem Bundestag; die alten Richtungskämpfe brachen wieder auf. Die SPD tat mit der Agenda 2010 der PDS einen großen Gefallen: Die Hartz-IV-Proteste mündeten in die Gründung der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG). Mit der Fusion zur Linkspartei sicherte sich die PDS die dringend nötige Frischblutzufuhr, gerade in Westdeutschland. Nun, in Zeiten von Arbeitskräftemangel und Bürgergeld, funktioniert die Anti-Hartz-IV-Front nicht mehr.
Heute ist die Linkspartei ein unüberschaubares Konglomerat von Arbeitskreisen, Initiativen und Plattformen. Da gibt es jene, die mit geradezu masochistischer Hingabe der alten linken Frage nachgehen, ob der Kapitalismus nun überwunden oder sozial korrigiert werden soll. Gleichzeitig will die Partei in den Bundesländern regieren und tut es teilweise auch noch; man ist – im radikal linken Sprech – Systempartei. Ein Widerspruch.
Das Werkeln am 130 Jahre alten Richtungsstreit des Sozialismus, den andere sozialistische Parteien in Westeuropa viel pragmatischer gelöst haben (das mit der Überwindung wird dort einfach auf Wiedervorlage gelegt, während man im Jetzt die konkreten Lebensverhältnisse der Unterprivilegierten verbessern will), hat dazu geführt, dass sich der Parteiapparat immer mehr von Teilen der eigenen Basis entfremdet hat. Oder anders gesagt: Basis und Parteiapparat passen nicht mehr zusammen.
Bürgerlich im Ex-SED-Milieu
Natürlich gibt es an der Basis noch überzeugte Marxisten, aber ein großer Teil der – ehemaligen – ostdeutschen Anhängerschaft denkt kulturell eher konservativ: Einst Marxisten, haben viele nach 1990 etwa eine kleine Firma gegründet oder sind als Angestellte in die Privatwirtschaft gegangen, auch weil für SED-Mitglieder die Karrierewege im öffentlichen Dienst zunächst verschlossen blieben.
Sie erkennen sich in Sahra Wagenknecht mit ihren Häutungen wieder. Früher orthodoxe Marxistin, ist sie seit einigen Jahren erklärter Fan von Ludwig Erhard. Sie appelliert an das spezifisch ostdeutsche Milieu, das in der Privatwirtschaft unterwegs ist, sich unter Mühen ein bisschen Wohlstand erarbeitet hat und in dem „bürgerliche“ Regeln wie Fleiß, Arbeit, Ordnung und Respekt vor dem Eigentum zählen. Auch die Migrationsskepsis ist nicht eine demagogische Erfindung von Wagenknecht, sondern repräsentiert eine weit verbreitete Haltung in diesem Milieu.
Apparatepartei alten Typs
Lebensweltlich teilen diese ehemaligen Wähler, die jetzt zum BSW übergelaufen sind, nichts mit den „woken“ AktivistInnen der Großstädte, die die Parteiführung gewinnen wollte. Aber auch für die „woken“ AktivistInnen ist die Linkspartei nur sehr bedingt attraktiv. Sie ist immer noch eine Apparatepartei alten Typs, in der Vorstandsbeschlüsse den Rang von heiligen Schriften haben (und trotzdem von den vielen Zirkeln in der Partei je nach Lage torpediert werden) und Parteitage in alter kommunistischer Tradition doch tatsächlich durchnummeriert werden („2. Tagung des 8. Parteitags“), was für die Refugee-Aktivistin aus Berlin-Friedrichshain eher abschreckend sein dürfte.
Kulturell passt da nichts zusammen. Es gibt keine Klammer, keine gemeinsame Erzählung, die das alles zusammenhält. Das Erstaunliche ist nicht, dass die Linkspartei nun ums Überleben kämpft. Das Erstaunliche ist, dass dieses inkonsistente Konstrukt so lange durchgehalten hat. Manchmal ist es besser, wenn alte dysfunktionale Formen verschwinden und sich die Ideale dahinter neue Strukturen suchen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen












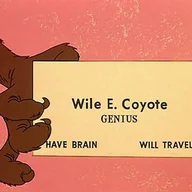

meistkommentiert
Repression an der Columbia University
Es wird ein Exempel statuiert
Baerbock zur UN-Generalversammlung
Undiplomatische Kritik an Nominierung für UN-Spitzenjob
Vertrauen in die Politik
Kontrolle ist besser
Erfolg der Grundgesetzänderung
Ein wahres Husarenstück
Schauspielerin Rachel Zegler
Rassismus gegen Schneewittchen
Neue Bomben auf Gaza
Israel tötet Hamas-Minister und Zivilisten