Kommentar Racial Profiling auf Twitter: Die Sprache der Kölpos
Die Kölner Polizei bezeichnet Männer, die mutmaßlich aus Nordafrika kommen, als „Nafris“. Das klingt nicht nur rassistisch – das ist es auch.

D ie Kölner Polizei twitterte kurz vor Silvester: „Am HBF werden derzeit mehrere Hundert Nafris überprüft“. Prompt hatte die deutsche Twittercommunity ihr erstes Trending Hashtag des Jahres 2017, nämlich #RacialProfiling. Denn bisher war „Nafri“ eine interne Bezeichnung der Kölner Polizei für „Nordafrikanische Intensiv-“ oder „Straftäter“. So definierte es am Montag auch die Deutsche Bundespolizeigewerkschaft (DPolG).
Schon an der Frage, ob der auf Straftäter abzielende Begriff „Nafri“ inhärent rassistisch ist, kann man sich ausgiebig abarbeiten: Ist es für eine bestimmte „Intensivtat“ charakteristisch, dass sie von „Nordafrikanern“ begangen wird? Gibt es im Vokabular der deutschen Polizei auch „Weuris“ oder „Namris“ – „westeuropäische“ oder „nordamerikanische Intensivtäter“? Oder ist diese Bezeichnung eine Stigmatisierung, die nur mutmaßlich aus Nordafrika stammenden Menschen zugemutet wird?
Die Empörung in den Sozialen Medien kann die Kölner Polizei nicht nachvollziehen. Denn „Nafri“ bezeichne nicht etwa nur Straftäter, sondern ganz generell auch „Menschen eines bestimmten Phänotyps“. Diese nachträgliche Erklärung macht den Tweet sogar noch schlimmer. Denn damit gesteht die Polizei ganz eindeutig ein, dass ihr Verdacht auf der – vermuteten – ethnischen Abstammung beruht.
Bei den 650 kontrollierten Männern sei eine „Grundaggressivität“ festgestellt worden, sagte Polizeipräsident Mathies. Mit Straftaten sei zu rechnen gewesen. Nun hat die Polizei jedes Recht, sich auffällig verhaltende Menschen zu kontrollieren. Dies hat sie jedoch gar nicht getan, wenn man ihre eigenen Angaben ernst nimmt – sonst hätte in dem Tweet statt „Nafris“ stehen müssen: „Am HBF werden derzeit mehrere Hundert sich aggressiv verhaltende Männer überprüft“.
Polizeipräsident Mathies räumte am Montag ein, diese „interne Bezeichnung“ sei „sehr unglücklich verwendet hier in der Situation“. Doch alle nachträglichen Erklärungen helfen nichts: Das Tweet der Kölner Polizei lässt sich nur rassistisch nennen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen












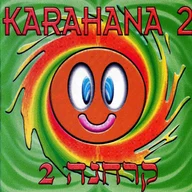


meistkommentiert