Debatte Revolution und Individualismus: Die kommenden Aufstände
Das herrschende System scheint vielen nicht einmal in kühnen Fantasien überwindbar. Revolten der Zukunft werden flüchtig sein – wie Feuerwerke.
D as doppelte Erinnerungsjahr an die Novemberrevolution 1918/globale Revolte 1968 ist ohne besondere Vorkommnisse verstrichen. Auf Symposien wurde ordentlich argumentiert. Es gab keine erregten Debatten, keinen aufrüttelnden Streit, keine überraschenden Volten.
Woher diese auffällige Affektlosigkeit? Das ist kein Ausdruck von Geschichtsvergessenheit. History sells, wie „Berlin Babylon“, Christopher Clarkes „Die Schlafwandler“ oder Florian Illies’ „1913“ zeigen. Die achselzuckende Routine bei 1918/68 erklärt sich nicht aus Amnesie oder Verdrängung unliebsamer Erkenntnisse, sondern aus verdunkelter Zukunftserwartung. Revolte und Aufstand erscheinen als Begriffe ohne Zukunft.
Sie sind bestenfalls museal, schlimmstenfalls erinnern sie an die Kraftmeierei von Gauland, der das System stürzen will. Die Technik der Provokation, des subversiven Spiels mit der eigenen Underdog-Position, die die 68er erfanden, nutzen heute Rechtsradikale. „1968 – Ils commémorent, on recommence!“ / „Sie gedenken, wir fangen wieder an“ stand an den Wänden französischer Universitäten zu lesen. Jungen deutschen Linksradikalen kam noch nicht mal in den Sinn, den etablierten 68ern ihre alte Melodie vorzupfeifen.
Für Skepsis gegenüber Revolutionen gibt es viele gute Gründe. Allzu oft wurden fundamentale demokratische Prinzipien verletzt. Von 1789 über 1917 bis zur chinesischen Revolution war Terror kennzeichnend für die rabiaten Versuche, Gleichheit durchzusetzen. Neuere schwungvolle, enthusiastische Bewegungen wie die Chavistas in Venezuela oder die Sandinisten in Nicaragua haben sich in grässliche Autokratien verwandelt, die nur dem Machterhalt dienen.
Schon den Gegner zu identifizieren, ist heute schwer
Zudem haben hypermoderne arbeitsteilige Gesellschaften Dutzende Subsysteme mit autonomen Regelwerken und kein zentrales Steuerungszentrum mehr, keine Machtzitadelle, die erobert werden könnte wie früher das Telegraphenamt oder der Königspalast. Wie kompliziert schon die Identifikation des Gegners sein kann, zeigte die Blockupy-Bewegung, die 2015 in Frankfurt die EZB belagerte – obwohl deren Niedrigzinspolitik nicht Ursache der Finanzkrise war, sondern nur der Griff zur Notbremse.
Das offenbarte ein komplexes, ja unlösbares Problem. Der globale Kapitalismus ist in dem politischen Raum, in dem soziale Bewegungen agieren, nicht dingfest zu machen. „Wenn ein großer Teil der physischen Arbeit in der ehemaligen Dritten Welt verrichtet und der Reichtum in Steuerparadiesen angehäuft wird“ (Thomas Steinfeld), dann sind auch unsere nationalstaatlich geprägten Vorstellungen von Revolution hoffnungslos überholt.
Der globale Kapitalismus ist wandlungsfähig, effektiv, ein Netzwerk ohne Zentrale. Er schafft extremen Reichtum und extreme Armut. Dass wir dieses faszinierende und destruktive System nicht einmal in kühnen Fantasien für überwindbar halten, siedelt nah am intellektuellen Bankrott. Für eine Gesellschaft, die sich aufgeklärt wähnt, ist es mehr als bedenklich, wenn sie jede Art von revolutionärem Umschwung für ausgeschlossen und undenkbar hält. Wenn Zukunft nur als in die Ewigkeit verlängertes Heute vorstellbar ist, kommt das der Definition der Hölle ziemlich nah – ein Ort ohne Alternative und besseres Morgen.
Nun gibt es immer wieder aufflackernde Revolten, zumindest jenseits deutscher Grenzen. Der Bogen der Aufstände in den letzten Jahren reicht von der weltweiten Occupy-Bewegung bis zu der halb vergessenen, dramatisch gescheiterten Arabellion, vom Widerstand gegen die EU-Politik in Griechenland bis zu Anti-Trump-Protesten in den USA oder den Demonstrationen gegen Orbán.
Bei aller Unterschiedlichkeit der nationalen Texturen sind Muster erkennbar, die Schlagkraft und Grenzen der Bewegungen markieren. Der Protest geht nicht von den Abgehängten aus, von dem oft migrantischen Dienstbotenproletariat, das Pakete austrägt, im Supermarkt Regale einräumt oder bei Amazon jobbt. Diese Klientel ist zwar enttäuscht und wütend. Aber weil sie im Job und erst recht, wenn sie arbeitslos ist, auch extrem vereinzelt ist, fehlt jener kollektive soziale Sinn, ohne den sich Bewegungen nicht bilden.
Die Kerngruppe des Protests ist jung, meist gut ausgebildet, allerdings mit abgedunkeltem Zukunftsprospekt. Es ist die Generation, die könnte, aber nicht kann, die viel, in den USA und Großbritannien auch viel Geld, in Bildung investiert hat und nun frustriert feststellt, dass sie in Praktikaschleifen hängt, Schulden angehäuft hat und sich auch in fünf Jahren keine Wohnung in einer Metropole wird leisten können. Und die zornig ist, dass Staaten Steuermilliarden in die Finanzsysteme pumpen, in denen Banker in ihrem Alter und ähnlich ausgebildet Millionen scheffeln.
Auffällig ist zudem eine Flüchtigkeit, die das übliche Maß an Unverbindlichkeit sozialer Bewegungen sprengt. Wenn man sich auf Programme einigt, lesen die sich vage, oder man beschränkt sich gleich auf ein paar übersichtliche Forderungen. Hierarchien stehen grundsätzlich unter Verdacht. Theorien, intellektuelle Speicherkapazitäten sind auch keine Kennzeichen dieser Formationen. In diesen Bewegungen brechen sich eruptiv Ohnmachts- und Überforderungserfahrungen Bahn, sie verknüpfen sich für einen Moment zu einer scheinbar mächtigen Bewegung, die wie eine farbenfrohe Silvesterrakete explodiert und im Nichts verschwindet.
Die französische Soziologin Cécile Van de Velde sieht die jungen Gutausgebildeten im Westen zusehends eingeklemmt zwischen zwei widersprüchlichen Anforderungen. Sie sollen der Doktrin des „Verwirkliche dich selbst“ genügen (dem Ideal des von den 68ern umgemodelten Kapitalismus), aber auch schnell Karriere machen, um in den sich rasch ändernden Anforderungsprofilen der digitalen Ökonomie bloß den Anschluss nicht zu verpassen.
Nie genügen, nichts bewirken
Die Unfähigkeit, ein Wir zu formen und stabile Organisationen zu bilden, entspricht dem Lebensgefühl, das kürzlich ein 21-Jähriger in Berlin treffend auf den resignativen Punkt brachte: „Ich kann nichts machen.“ Der Satz beschreibt das nagende Gefühl, überfordert zu sein, ein Staubkorn im Wind.
Die von keinen gesellschaftlichen Verbotsschildern mehr gebremste Selbstverwirklichung ist zum Gebot geworden, die Möglichkeitsräume scheinen unendlich – und beflügeln das Gefühl, nie zu genügen, nichts zu bewirken. Früher war das Individuum weit mehr in sinnstiftenden, einengenden Milieus und Kollektiven eingebunden. Gewerkschaften, Kirchen oder auch die Alternativbewegung schützten das Ich vor Selbstüberforderung und dem angekoppelten Gefühl, zu versagen. Bei den Post-68ern sorgte die Abgrenzung von der Elterngeneration für das beruhigende Bewusstsein, Teil von etwas Neuem, Größeren zu sein. Jetzt ist das Ich frei, aber unfähig, sich zu einem Wir zu verbinden, das mehr als Flackern wäre.
Einen anderen Typus Revolte kann man derzeit in Frankreich beobachten. Die Gelbwesten kommen aus der Provinz, nicht aus der Metropole. Sie rekrutierten sich aus der unteren, kaum akademisch geprägten Mittelschicht, die hart arbeitet und wenig verdient. Sie ist politisch eher diffus als links – die Hälfte versteht sich als unpolitisch. Und sie ist noch misstrauischer gegen organisierte Politik als die rebellischen JungakademikerInnen. Eine wenn auch nicht repräsentative Umfrage förderte zutage, dass die Hälfte der Gelbwesten-AktivistInnen jede Form von Repräsentation ablehnt. Nur das authentische Ich soll sprechen dürfen. Wer Wir sagt, scheint unter Betrugsverdacht zu stehen. Darin spiegelt sich das Paradox einer Bewegung, die nur aus einzelnen Ichs zu bestehen scheint.
Solche fragmentarischen Formationen sind nicht in der Lage, Erfahrungen zu speichern, Strategien zu entwerfen, langfristige Ziele ins Auge zu fassen oder gar die Machtfrage zu stellen. Sie erinnern von ferne „an die antikapitalistischen Strömungen der 1840er Jahre“ (Franz Walter), vor der Gründung von Gewerkschaften und Sozialdemokratie.
Die Welten werden weiter auseinanderdriften
Die kommenden Aufstände werden spontan und unvorhersehbar entstehen. Sie werden in Provinzstädten mit kaum bekannten Namen ausbrechen. Die Lebenswelten zwischen verödeten Kleinstädten und den florierenden Großstädten (mit explodierenden Mieten) werden weiter auseinanderdriften. Die Digitalisierung, deren zarte Anfänge wir erleben, wird die sozialen Gräben vertiefen. Die Kluft zwischen heftig umworbenen high potentials und Abgehängten in mies bezahlten Jobs, zwischen dem liberalen, weltoffenen oberen Drittel, dessen Kinder im Ausland studieren, und dem nach rechts driftenden, verstockten Kleinbürgertum wird nicht geringer, sondern noch größer werden. Auch in der EU wird die digitale Ökonomie die sozialen Unterschiede zwischen dem prosperierenden Norden und dem unter Überschuldung und Arbeitslosigkeit leidenden Süden forcieren.
In Deutschland werden Jüngere schon wegen der Demografie als Fachkräfte dringend gesucht. Die Arbeitslosigkeit wird, vor allem bei AkademikerInnen, niedrig bleiben, jedenfalls wenn die Exportökonomie nicht zusammenbricht.
Die Kerntruppe der urbanen Revolten, die jungen Gutausgebildeten, sind hierzulande längst nicht so verzweifelt wie in London oder den USA. Sie werden zwischen Hamburg und München eher Geld für eine Eigentumswohnung sparen als gegen Wohnungsspekulanten auf die Straße zu gehen oder rabiat zu protestieren, dass die Bankenkrise die Steuerzahler hierzulande mehr als 80 Milliarden und der Cum-Ex-Betrug mehr als 30 Milliarden Euro kostet. Der Protest in den Regionen wird rechtspopulistisch bleiben, böse, wütend und ratlos.
Der akademische Nachwuchs in den Metropolen sucht sein „Glück in Familie und Beruf“, weil die Welt keine fundamentalen „Alternativen“ mehr bietet. Die Nachwuchselite hat aufgehört zu sein, was sie früher einmal war – „ein Ferment produktiver Unruhe“.
So sieht es 2018 aus. Doch das Zitat stammt vom linksliberalen Soziologen Ludwig von Friedeburg, der erforschte, wie die bundesdeutschen Studierenden ticken. Und zwar 1965. Es kam anders, entgegen allen fundierten, wohlbegründeten Prognosen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










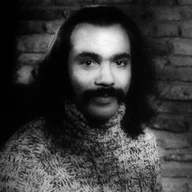
meistkommentiert
Historiker Traverso über den 7. Oktober
„Ich bin von Deutschland sehr enttäuscht“
Elon Musk greift Wikipedia an
Zu viel der Fakten
Grünen-Abgeordneter über seinen Rückzug
„Jede Lockerheit ist verloren, und das ist ein Problem“
Nach dem Anschlag in Magdeburg
Das Weihnachten danach
Nach dem Anschlag in Magdeburg
Scholz fordert mehr Kompetenzen für Behörden
Krieg in der Ukraine
„Weihnachtsgrüße“ aus Moskau