Verbrechen und Gender: Es sind Männer
Eine Europol-Kampagne weist darauf hin, dass auch Frauen Schwerverbrechen begehen. Die wichtigere Wahrheit bleibt dabei auf der Strecke.
Mit jedem Scroll wird der Leser*in eine neue Information mitgeteilt und ein Teil der Maskerade verschwindet – bis am Ende alle Informationen und das Bild der Kriminellen sichtbar sind. In diesem Fall: Ildikó Dudás, 31 Jahre alt, gesucht in Ungarn wegen Drogenhandel und Kindesmissbrauch, momentan auf der Flucht. Daneben prankt in großen Lettern: „Crime has no Gender“, also Verbrechen hat kein Geschlecht.
Bei der interaktiven Website handelt es sich um die neue Kampagne der EU-Polizeibehörde Europol. 21 gesuchte Verbrecher*innen, 18 davon Frauen, verstecken sich hinter der Maskerade – ausgesucht von verschiedenen Mitgliedstaaten. So möchte Europol auf spielerische Art die Gesellschaft dafür sensibilisieren, dass auch Frauen schwere Straftaten begehen können. Denn laut der Behörde sei es genauso wahrscheinlich, dass Frauen Schwerverbrechen begehen wie Männer.
Dafür Belege zu finden, stellt sich jedoch als schwierig heraus. Denn klar können auch weibliche Täter*innen Schwerverbrechen begehen, man denke nur an die rechtsextremistische Terroristin Beate Zschäpe. Doch in der Forschung ist umfassend belegt, dass Männer in allen Staaten der Welt deutlich mehr Verbrechen begehen als Frauen.
Irreführende Kampagne
In Deutschland beispielsweise sind laut polizeilicher Kriminalstatistik nur ein Viertel aller Tatverdächtigen weiblich. Hinzu kommt, dass je schwerwiegender die Delikte sind, der Frauenanteil immer geringer wird. So ist das Geschlechterverhältnis bei kleinen Delikten wie Diebstahl relativ ausgeglichen, unter den Tatverdächtigen bei Gewaltdelikten ist der Frauenanteil dann allerdings sehr klein.
Das zeigt sich auch auf der richtigen Liste der meist gesuchten Verbrecher*innen, ebenfalls veröffentlicht von Europol. Auf dieser stehen mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen. Auch die Begründung, immer mehr Frauen würden kriminell, delegitimiert Europol in ihrer Presseerklärung gleich selbst, da die Anzahl der Männer deutlich schneller steigt.
Die Kampagne von Europol ist also nicht nur irreführend, sondern der Slogan „Crime has no Gender“ verkennt, dass es sehr wohl geschlechtsbezogene Kriminalität gibt – vor allem wenn es um Gewalttaten geht. Dabei sind Frauen in der Regel nicht die Täter*innen, sondern die Opfer.
In Deutschland versucht jeden Tag ein (Ex-)Partner seine Frau zu töten, an jedem dritten gelingt es einem. Femizide, also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind, haben System. Und auch bei anderen Formen von Partnerschaftsgewalt wie Körperverletzung, Vergewaltigung oder Stalking sind 82 Prozent der Betroffenen Frauen.
An diesem Umstand etwas zu verändern, daran ist eigentlich auch der EU gelegen. So verpflichten sich die EU-Staaten mit der sogenannten Istanbul Konvention, die 2014 in Kraft getreten ist, zur „Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“.
Nur ein Slogan
Die „Crime has no Gender“-Kampagne wird jedoch vermutlich nicht dazu beitragen, denn anstatt bestehende Strukturen zu bekämpfen, zielt sie lediglich darauf ab, mit einem kontroversen Slogan Aufmerksamkeit zu generieren. Nämlich für den wenig überraschenden Umstand, dass auch Frauen Verbrechen begehen können.
Stattdessen sollte Europol Aufmerksamkeit dafür generieren, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Frauen und Menschen, die sich nicht dem männlichen Geschlecht zuordnen, Angst haben müssen, auf Grund ihres Geschlechts Opfer zu werden. Solange sich daran nichts ändert, haben auch Verbrechen ein Geschlecht.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







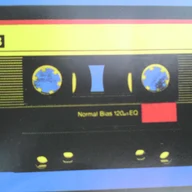


meistkommentiert
Klimagerechtigkeit in Berlin
Hitzefrei für Reiche
Irrsinn des Alltags
Wie viel Krieg ertragen wir?
Artenvielfalt
Biber gehören in die Flüsse und nicht auf den Teller
US-Luftangriff auf Irans Atomanlagen
Trump droht mit „Frieden oder Unheil“
+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++
Israel stellt sich auf langen Einsatz gegen Iran ein
Diskussion um Kriegseintritt der USA
Zwischen drohen und bomben