Queen und Kolonialismus: Wessen Heldin?
Die Rolle der Queen im kolonialen Schreckensregime zu thematisieren ist nicht pietätlos. Der richtige Zeitpunkt dafür ist gerade jetzt gekommen.
Wer war Queen Elisabeth II.? Die Antwort variiert, je nachdem wen man fragt. Für viele Menschen in Großbritannien war sie das geliebte Staatsoberhaupt, das in Zeiten von Krisen, Neoliberalismus und Brexit etwas Stabilität ausstrahlte. Für nicht wenige Deutsche dient sie bis nach ihrem Tod als Projektionsfläche für die eigene identitäre Krise: mit royalem Kitsch kann man sich selbst aus deutscher Sicht in eine schöne Parallelrealität befördern.
Für Millionen von Menschen in den ehemaligen Kolonien Großbritanniens war und ist Queen Elisabeth II. dagegen das Gesicht eines ausbeuterischen und gewalttätigen Regimes, das bis heute Landesgrenzen und Lebensrealitäten prägt. Von Jamaika über Kenya bis Ägypten und Pakistan regten sich nach der ersten Eilmeldung zum Tod der Queen kritische Stimmen zum Wirken des britischen Staatsoberhaupts. Dies sind Menschen, die nicht trauern, weil sie nicht trauern können; die manchmal auf sozialen Medien Witze reißen über den eurozentrischen Blick auf eine königliche Familie, in deren Namen Kolonialismus betrieben wurde.
Wiedermal klafft also eine Wahrnehmungslücke zwischen mehrheitlich weißen Menschen auf der einen und vielen rassifizierten Menschen auf der anderen Seite. Die einen erinnern sich an eine Frau in bunten Kleidern, die Empfänge organisieren ließ und – wie nun oft betont wurde – „schon immer da war“.
Die anderen erinnern sich an ihre Rolle während der Suezkrise 1956, bei der unter anderem britische Truppen Tausende ägyptische Unabhängigkeitskämpfer töteten; an den Mau-Mau-Aufstand im heutigen Kenia, bei dem Zehntausende Schwarze Kämpfer deportiert und gelyncht wurden; an die Apartheid in Südafrika, die als direkte Folge europäischer Kolonialherrschaft bis heute den Alltag der Menschen dort prägt. Bei all diesen Menschheitsverbrechen spielte die Queen eine aktive Rolle. „Sie war schon immer da“, nur im negativen Sinne. Es braucht dabei das Präfix post- vor dem Adjektiv kolonial nicht.
Mit aller Vehemenz verteidigen
Viele Queen-Bewunderer konzentrierten sich also weniger auf ihre teils performative Trauer, sondern gingen dazu über, die verstorbene Königin mit aller Vehemenz zu verteidigen. Sie habe keinen politischen Einfluss gehabt und nichts ausrichten können, heißt es oft. Dabei hätte sie sich hinter den Kulissen und in der Öffentlichkeit durchaus davon distanzieren können, dass in ihrem Namen geraubt und gemordet wurde.
Der Dankbarkeit der eurozentrischen Masse liegt die Verpflichtung der Queen ihrem eigenen Volk zugrunde. Auch die Tatsache, dass sich die Königin – als nun mal höchste Repräsentantin des Vereinigten Königreichs – nie für die kolonialen Verbrechen entschuldigt hat, sorgte nach ihrem Tod für eine Eruption der Gefühle bei jenen, die in ihren Familiengeschichten Leid und Schmerz aufgrund der Expansion europäischer Mächte erfahren haben, jene, die ihre eigenen Toten seit Generationen betrauern.
Dieses vererbte Trauma hängt auch damit zusammen, dass es in ganz Europa – also auch in Deutschland – keine etablierte und von der breiten Bevölkerung, insbesondere von Weißen getragene de-koloniale Erinnerungskultur gibt. Es ist das Aussparen dieses Menschheitsverbrechens, dass die Trauer der einen auf das Trauma der anderen prallen lässt. Eure Heldin ist das Gesicht unseres Schreckens: Ja, das hört niemand gerne auf einer Beerdigung.
Dabei spart eine gute Trauerrede die kritischen Episoden aus der Biografie einer verstorbenen Person nicht aus. Knackpunkt war die Art und Weise, wie an die Queen in den ersten Tagen nach ihrem Tod erinnert wurde: historisch alles andere als akkurat. Auf allen großen Nachrichtenseiten, Titelblättern und in Fernsehprogrammen führten Redaktionen im Schnelldurchlauf durch das lange Leben der Queen. Von ihrer Geburt über ihre Krönung 1953, ihren Umgang mit Prinzessin Diana, ja sogar ihr Lieblingsessen, ihre Leidenschaft für Pferde bis zu der abgenutzten Anekdote, dass sie mit ihrer Handtasche ihren Bediensteten nonverbal ihr Empfinden signalisierte. Nur ein Thema wurde in den vergangenen Tagen an vielen Stellen ausgeblendet: die Rolle des royalen Systems während und nach dem britischen Kolonialismus, die feste Beziehung europäischer Staaten zu autoritären Systemen in Afrika, Asien und Amerika heute.
Dieses Schweigen sprach zu vielen marginalisierten Menschen in den ehemaligen Kolonien und in der europäischen Diaspora. Auch weil der Tod der Queen nicht plötzlich kam, und das Programm für den Tag danach fertig in den journalistischen Schubladen lag. Nur dachte niemand im Mainstreamdiskurs daran, dass es andere Perspektiven auf das Leben einer der einflussreichsten Menschen der Welt geben könnte. Viele entschieden sich nur für die schöne Hälfte der Trauerrede.
Druck marginalisierter Communitys
Eine Thematisierung der kolonialen Melancholie Europas sei jetzt pietätlos, gaben einige in den vergangenen Tagen zu Protokoll. In Wahrheit ist für sie eine Thematisierung des Kolonialismus immer fehl am Platz.
Die Verwischung europäischer Verbrechen auf anderen Kontinenten ab der Berliner Konferenz 1884/1885 bis hin zur Unabhängigkeit afrikanischer Staaten in den 1950er und 1960er Jahren und der Rückgabe Hongkongs an den Autoritarismus der Kommunistischen Partei Chinas im Jahr 1997 wird die Gesellschaften Europas in Zukunft allerdings auf Druck marginalisierter Communitys im Inland und vor allem aus der ehemaligen kolonialen Peripherie nun öfters beschäftigen. Das ist gut, weil dieser Druck heilsame Kraft entfalten und eine gemeinsame Trauer ermöglichen könnte.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










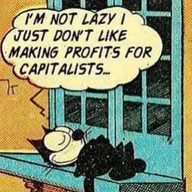

meistkommentiert
Nan Goldin in Neuer Nationalgalerie
Claudia Roth entsetzt über Proteste
Politikwissenschaftlerin über Ukraine
„Land gegen Frieden funktioniert nicht“
taz-Recherche zu Gewalt gegen Frauen
Weil sie weiblich sind
Verein „Hand in Hand für unser Land“
Wenig Menschen und Traktoren bei Rechtspopulisten-Demo
Scholz und Pistorius
Journalismus oder Pferdewette?
Internationaler Strafgerichtshof
Ein Haftbefehl und seine Folgen