Debatte Linke Sammlungsbewegung: Schachmatt gesetzt
Warum einiges für Sahra Wagenknechts Idee spricht, sie aber an der unrealistischen Haltung der Linken in der Flüchtlingspolitik scheitern wird.
W er sollte schon kommen? Jakob Augstein vielleicht? Lafontaines Ex-Staatssekretär Heiner Flassbeck? Viele Prominente sind es nicht, die einem als mögliche Zugpferde für Sahra Wagenknechts Sammlungsbewegung einfallen. Die Linke-Fraktionschefin wirbt seit einigen Monaten dafür, viel Konkretes war noch nicht zu hören. Man darf skeptisch sein, ob mehr daraus werden wird.
Dabei spricht einiges für eine Umgründung auf der politischen Linken. 38,6 Prozent haben im September 2017 SPD, Grüne oder Linkspartei gewählt, 56,3 Prozent CDU/CSU, FDP oder AfD. Eine linke Mehrheit ist nicht in Sicht. SPD und Grüne haben daraus ihre Schlussfolgerungen gezogen: Die Sozialdemokraten mit dem erneuten Versprechen einer Erneuerung, die Grünen mit einer stärkeren Orientierung auf die bürgerliche Mitte. Wer links keine Machtoptionen sieht, sucht sie woanders.
Für die Linkspartei ist die Lage scheinbar bequem. Sie liegt so weit oberhalb der Fünfprozenthürde und so weit weg von einer Regierungsbeteiligung, dass sie keine anstrengenden innerparteilichen Konflikte austragen müsste. Sie dürfte von der Orientierung der Grünen an der Union und der Beteiligung der SPD an einer neuen großen Koalition profitieren. Aber am Fehlen einer Machtperspektive ändert das nichts: Die Stimmen innerhalb des rot-rot-grünen Lagers zu verschieben ist ein politisches Nullsummenspiel.
Was also tun? Wagenknechts Sammlungsbewegung ist innerparteilich so umstritten, weil sie einen Teil der Wähler gewinnen will, die von SPD und Linkspartei zur AfD gewechselt sind. Was heißt, dass man zumindest auf einen Teil ihrer Anliegen eingehen muss. Im Kern ist das ein Streit seit dem Flüchtlingsherbst 2015: Wenn die linken Parteien eine moralisch wie politisch glänzende Performance hingelegt hätten, wäre es Opportunismus gegenüber rechtspopulistischem Gedankengut, diese Linie zu verändern. Hätten sie aber zumindest teilweise falschgelegen, wäre es dringend notwendig, darüber zu reden.
Andere Utopien verstecken sich im Programm
Die Linkspartei ist eine mehrheitlich realpolitische Partei, mit einer eher rechtssozialdemokratischen (Ost-Reformer) und einer linkssozialdemokratischen (Wagenknecht und Gewerkschaftsflügel) Variante. Wie stets in sozialdemokratischen Parteien unterscheiden sich die beiden Flügel darin, welches Maß an Umverteilung sie als ökonomisch und politisch möglich sehen. Wie sollte es auch anders sein? Geld, das in Sozialpolitik fließt, muss zunächst einmal erwirtschaftet – und anderen weggenommen werden.
Dennoch hat wie jede linke Partei, die einmal in großen Entwürfen gedacht hat, auch die Linkspartei ihre utopischen Reservate: Wenn der Kampf in Stadträten und Parteigremien zäh ist, strahlt die Sonne in Kuba umso heller.
Andere Utopien verstecken sich im Programm – üblicherweise in Punkten, bei denen die Parteispitze sicher sein kann, dass Koalitionspartner sie in Verhandlungen kassieren würden. So war es bis 2015 auch beim Thema Asylrecht, bei dem sich eine Arbeitsteilung eingependelt hatte: SPD und Union waren dafür zuständig, die Grenzen möglichst dicht zu halten, Grüne und Linkspartei dafür, möglichst vielen Flüchtlinge den Zugang nach Deutschland zu ermöglichen.
Das ermöglichte es Grünen und Linkspartei, nicht über die Tragfähigkeit ihrer Flüchtlingspolitik debattieren zu müssen. Die Linkspartei ging 2013 in ihrem Wahlprogramm sogar so weit, „offene Grenzen“ zu fordern. Grüne und Linke suchten in der Flüchtlingsfrage nach nationalen Lösungen für globale Probleme.
Mit Empathie und Augenmaß
Mit dem Herbst 2015, als Merkel die Politik von Grünen und Linken betrieb, brach diese Arbeitsteilung zusammen. Innerhalb von wenigen Monaten zeigte sich die Unhaltbarkeit der Offene-Grenzen-Politik. Die wichtigsten Fragen konnte niemand beantworten: Wie viele Flüchtlinge würden kommen, wenn die Grenzen dauerhaft offen blieben? Wie könnte man dafür sorgen, dass sie Wohnraum und Beschäftigung erhielten – und zwar so, dass dies nicht zu Lasten der schon ansässigen Bevölkerung ging? Und wie begründete sich eigentlich die moralische Notwendigkeit der Aufnahme von Flüchtlingen in einer so hohen Zahl, wo doch der überwiegende Teil aus der Türkei, einem für sie sicheren Drittstaat, kam?
Nur in wirklichen Notfällen darf über die nötigen Ausgaben nicht gestritten werden. Bei ihren Regierungsbeteiligungen hielt es die Linkspartei jedoch für legitim, öffentliche Betriebe zu verkaufen, den öffentlichen Dienst zu schrumpfen und Landkreise zusammenzulegen. Kurz: Soziale Politik richtete sich auch nach der Kassenlage. Im Herbst 2015 aber war die Linkspartei der Auffassung, dass Geld keine Rolle spielen durfte.
Das konnte schon deshalb nicht gut gehen, weil von der revolutionären Flüchtlingspolitik nur Menschen profitierten, die nicht wahlberechtigt waren, während die eigenen Wähler mit Realpolitik versorgt wurden.
Wagenknechts Sammlungsbewegung wäre vollkommen überflüssig, wenn sich die Linkspartei vor den nächsten Wahlen über eine sinnvolle Flüchtlingspolitik verständigen könnte. Mit Empathie, aber auch Augenmaß. Kurz: Wenn sie die Idee fallen lässt, alle Flüchtlinge der Welt könnten nach Deutschland kommen, wenn sie wollen. Niemand sollte auf einfache Rezepte hoffen.
Merkel tickt längst wieder im Realpolitikmodus
Und wenn nicht? Die Ironie des Flüchtlingsherbstes 2015 ist, dass Merkel längst wieder im Realpolitikmodus tickt, während ihre damalige Politik für eine ganze linke Generation identitätsstiftend geworden ist. Und zwar insbesondere für jene urbanen Schichten, die im Westen früher zu den Grünen gegangen wären, jetzt aber der Linkspartei zuströmen.
Deshalb ist weder eine andere Politik der Linkspartei noch eine Sammlungsbewegung wahrscheinlich. Letzterer fehlt es – bis zum Beweis des Gegenteils – nicht nur an Prominenten, sondern auch an der Basis. Merkel hat die linke Opposition schachmatt gesetzt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen















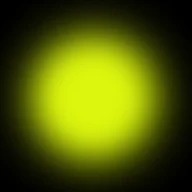
meistkommentiert
Grünen-Abgeordneter über seinen Rückzug
„Jede Lockerheit ist verloren, und das ist ein Problem“
Historiker Traverso über den 7. Oktober
„Ich bin von Deutschland sehr enttäuscht“
Elon Musk greift Wikipedia an
Zu viel der Fakten
Hoffnung und Klimakrise
Was wir meinen, wenn wir Hoffnung sagen
Nach dem Anschlag in Magdeburg
Das Weihnachten danach
Die Wahrheit
Glückliches Jahr