Soziologe über Klimawandel: „Ziele formulieren kann jeder“
Wie kann man die Erderhitzung stoppen? Die einen glauben an Greta, die anderen an den Markt. Der Soziologe Armin Nassehi hat eine bessere Idee.
Deutschlands wichtigster Gegenwartsanalytiker kommt morgens um 10 Uhr in die taz-Kantine in Berlin-Kreuzberg. Die Kollegin vom Service sagt: „Und was hättest du gern?“ Armin Nassehi zuckt keine Sekunde und bestellt. Er ist Sohn einer Schwäbin und eines Iraners, Schalke-Fan, trägt immer Schwarz und den Kopf haarfrei. Nassehi ist aus München eingeflogen für einen Spottpreis, das ist halt so. Am Nachmittag trifft er eine Spitzenpolitikerin, am Abend geht er ins klassische Konzert. Jetzt soll er erklären, warum über die Zukunft nicht entscheidet, ob Grün-Rot-Rot oder Grün-Schwarz regiert.
taz am wochenende: Herr Nassehi, manche halten Sie für einen unsicheren Kantonisten, weil Sie das Rechts-links-Denken überwunden haben.
Armin Nassehi: Und weil ich mich nicht darauf einlasse, dass es eine eindeutige oder einfach durchführbare oder gar revolutionäre Lösung unserer Probleme gibt. Gibt es nicht. Wir müssen die Probleme mit den Bordmitteln dieser Gesellschaft lösen, denn andere haben wir nicht.
Das wird von theoriebewussten Linken vehement bestritten, dass die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft etwas für alle voranbringen würde oder könnte.
Was meint die „Mitte der bürgerlichen Gesellschaft“? Diese Mitte immer nur als Mittemilieu oder so zu denken, ist doch langweilig. Zunächst gilt: Am laufenden Motor kannst du keine Revolution machen, ohne ihn stillzulegen. Ich will sagen: Die Widerständigkeit der Gesellschaft, ihre Struktur, ihre Trägheit und ihre Unbeeindruckbarkeit ist enorm. Man muss einfach sehen, wie schwierig der Eingriff in Systeme, Gewohnheiten, Lebenspraxis in einer strukturell komplexen Welt ist. Das ist die entscheidende Frage, die aber in politischen Diskussionen kaum mehr auftaucht: Wie funktionieren Strategien?
Die Bundesregierung hat die Pariser Klimaziele mitbeschlossen – tut aber nichts dafür, sie einzuhalten und den dafür nötigen sozialökologischen Umbau voranzubringen.
Armin Nassehi
Das Problem ist, dass wir nur noch Ziele haben. Ziele formulieren kann jeder. Ich habe kürzlich einen Vortrag vor den versammelten deutschsprachigen Klimaforschern gehalten, 400 Leute, die sagten, dass sie den Politikern immer erklärten: Ihr müsst den CO2-Ausstoß um soundsoviel Prozent senken oder auf diese oder jene Technologie setzen. Und die unterschreiben dann Klimaschutzziele, teilweise mit bestem Wissen und Gewissen – aber es gelingt schon deshalb nicht, weil man das Ziel bereits für den Weg hält. Wer ein genaues Ziel vorgibt, scheitert womöglich daran, dass das Ziel schon wie die Lösung aussieht. Dabei ist es der Weg dorthin, um den es geht. Das gilt auch bei anderen operativen Fragen: Wenn jemand seinen Blutdruck von 170/110 auf 120/70 senken soll, ist die Information des wünschenswerten Ziels geradezu simpel im Vergleich zu der Frage, wie man da hinkommt. Und wenn man das nicht fragt, wirkt jeder kleine Schritt in die richtige Richtung lächerlich im Vergleich zum Ziel.
Haben Sie noch ein Beispiel?
Armin Nassehi wurde 1960 in Tübingen geboren und ist seit 1998 Inhaber des Lehrstuhls I für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Mit den „Münchner Theoriegesprächen“ trägt er in öffentlichen Vorträgen soziologische Themen in die Gesellschaft hinein. Seit 2012 ist er Herausgeber der Zeitschrift Kursbuch und bezieht immer wieder Stellung zu aktuellen Fragen. Zuletzt erschien von ihm „Gab es 1968? Eine Spurensuche“ (Kursbuch Edition, 200 Seiten, 20 Euro).
Wenn man über ein 3-Liter-Auto sagt: Das verbraucht exakt drei Liter zu viel. Die großen Ziele sind von einer sehr großen Hybris geprägt und ignorieren das Operative und aktuell Mögliche. Es gibt aber auch eine Entwertung durch Anerkennung. Nehmen Sie Fridays for Future: Die können sich vor Anerkennung kaum retten, weil die Ziele so groß sind und als letzte Dinge der Menschheit formuliert werden. Diese Anerkennung entwertet das Engagement, weil es demonstriert, wie blank manche Konzepte doch sind.
Warum?
Weil Politik, Parteien, öffentliche Meinung und Unternehmen das Ziel loben, aber kaum konkrete Lösungen zur Verfügung stellen. So gibt es im Hinblick auf Fridays for Future nur Zustimmung oder Nichtzustimmung, beides löst das Problem aber nicht. Die Unsäglichen von der AfD kehren den Spieß einfach um. Also gibt es bei ihnen den Klimawandel gar nicht.
Wenn es um den Weg geht: Haben Sie denn einen?
Die klassische Industriegesellschaft war um zwei Achsen gebaut: das Besitzverhältnis gegenüber den Produktionsmitteln und das Verhältnis zwischen kulturellem Konservatismus und liberaler Öffnung. Heute geht es um die Komplexitätsfolgen der Moderne, die politisch nicht mehr mit der alten Parteidifferenzierung bearbeitet werden können.
Die Entscheidung fällt also nicht zwischen Grün-Schwarz, Grün-Rot-Rot oder Jamaika?

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.
Politisch schon, aber Politik ist nur ein System von vielen und in der eigenen Logik gefangen. Es gibt auch eine rechtliche Logik, technische Logik, wirtschaftliche Logik, wissenschaftliche Logik. Es geht nicht um das Zusammenschließen von bestimmten Parteien oder ähnlich tickenden Milieus, es geht heute um Bündnisse zwischen den Denkungsarten unterschiedlicher Systeme und Funktionslogiken. Und man sollte sich nichts vormachen: An Lösungen etwa für den Klimawandel wird außerhalb der Parlamente bereits akribisch gearbeitet, in wissenschaftlichen Labors, in Unternehmen, in der Stadtplanung, in der Architektur. Vieles davon bleibt erstaunlich unsichtbar.
Viele denken: Die Systeme müssen sich halt zum Wohl des Großen und Ganzen ändern.
Das ist schön gesagt, ein starker Satz, der wie die Lösung aussieht, aber eher das Problem beschreibt. Wenn man etwas aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive lernen kann, dann dies: Das Wohl des Großen und Ganzen erscheint stets nur aus der Perspektive konkreter Handlungsmuster und Perspektiven. Das Ganze ist eben nicht adressierbar und nicht erreichbar. Das ist bitter, aber leider die unhintergehbare Ausgangsbedingung. Die Funktionen der Systeme sind kaum zu ändern, aber man kann ihre Ressourcen durchaus sehr unterschiedlich nutzen. Es geht darum, die Kompetenzen innerhalb der Systeme anzuzapfen und nicht sie auszuschalten. Es geht eher um konkrete Updates statt um Gesamtlösungen.
Was heißt das?
Keines dieser Systeme kann seine je eigene Logik außer Kraft setzen, um sich dem Wohl des Großen und Ganzen zu verschreiben. In der Wirtschaft muss man Geld verdienen können. Als Politiker muss man wiedergewählt werden können, um Macht ausüben zu können. Rechtliche Normen müssen gelten dürfen. Medien brauchen jeden Tag etwas zu melden. Diese Logiken arbeiten zum Teil gegeneinander und sind nicht von einer Stelle aus kausal zu steuern. Entscheidend ist, wie sich die unterschiedlichen Logiken ineinander übersetzen lassen. Und es gilt: Ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und politische Stabilität wird es eng, nicht nur mit dem Klimawandel.
Der Moralist wird jedoch weiterhin sagen: Um die Erderhitzung zu begrenzen, müssen wir unsere Leben und unsere Gesellschaftsform radikal ändern.
Am Klimathema kann man aber das Problem dabei genau sehen: Eine Gesellschaft kennt keine Gesamtlösung. Die Idee der Gesamtlösung ist in einem differenzierten System eine paradoxe Form. Eigentlich kann sich schon demokratische Politik kaum auf ökologische Gefahren einstellen, weil diejenigen, deren Verhalten sich ändern soll, wählen. Nicht wenige träumen deshalb von durchaus autoritären Formen des Verbots, der Vorschrift und der zentralen Lenkung. Es weht manchmal ein chinesischer Wind. Die Tragik lautet: Die größten Ziele sind nur mit den kleinsten Schritten erreichbar. Wie im richtigen Leben.
Jetzt haben wir einen pseudopolitischen Diskurs, in dem gesagt wird, die Grünen werden wieder linker, die Union wird wieder rechter – je nach Sichtweise gut oder schlimm? Was fängt man damit an?
Es sind beides falsche Bewegungen. Es geht eben nicht darum, linker zu werden, auch nicht rechter zu werden, denn im Prinzip führen diese Bewegungen weg von dem Problem, über das wir hier gerade sprechen. Über Rechte muss man kaum reden. Die ethnischen Fragen und die um kulturelle Differenz sind nicht unser Grundproblem, das ist eine aufgebauschte Geschichte, für die es Lösungen gibt, auch durchaus restriktive, die aber nicht rechts sein müssen. Dass auf der anderen Seite Gerechtigkeitsformen organisiert werden müssen, speziell, wenn durch die Digitalisierung neue Jobs entstehen, aber viele rausfallen oder viele einen Job haben, von dem sie nicht leben können – das muss man lösen, das ist doch keine Frage.
Die Lösungen sind dann aber wieder nicht radikal genug?
Okay, man kann die radikale Lösung wollen, man kann sagen, dass man sofort alles verbieten muss, und wird auch ein paar Leute finden, die das gut finden. Aber das ist natürlich überhaupt nicht mehrheitsfähig. Am Ende bricht sich Politik immer an dieser einen Frage, dass du damit Mehrheiten organisieren musst. Das ist nun einmal das einzige politische Kriterium, das funktioniert.
Aber kann ich den Gedanken ertragen, profaner Teil einer Mehrheit zu sein? Das ist kulturell nicht eingeübt.
Der Luxus, zur Minderheit gehören zu wollen, setzt ein großes Vertrauen in die Mehrheit voraus.
Sie meinen, es lief ja letztlich ganz gut bei Schmidt und Kohl und Schröder und Merkel?
Das ist die Schlüsselszene in „Das Leben des Brian“. Die Judäische Volksfront sitzt zusammen und fragt sich, wer eigentlich der Feind ist. Und dann sagen sie: Die Römer? Nein, die direkte Konkurrenz, die Volksfront von Judäa. Und dann zählen sie auf, was die Römer ihnen alles gebracht haben: Kanalisation, soziale Sicherheit, Ordnung auf den Straßen und all diese Sachen.
Könnten Sie noch mal begründen, warum klassische Volksparteien mit den Problemen der Gegenwart nicht klarkommen?
Die Idee der klassischen Volkspartei war, dass ein bestimmtes Interesse mit einem Milieu einigermaßen identisch war. Kapital und Arbeit, Union und Sozis. Das war ein stabile Unterscheidung mit Teilen, die in einer stabilen Unterscheidung direkt voneinander abhängig waren. Und das ist nicht mehr da. Darauf kann man heute keine Volksparteien mehr bauen. Das kann man heute nur, wenn man die unterschiedlichen gesellschaftlichen Logiken und Systeme angemessen aufeinander bezieht.
Trotzdem will die SPD wieder linker werden, die Union konservativer?
Das Godesberger Programm der SPD von 1959 hatte die Idee, das politische System und die dynamische Wirtschaft und das Rechtssystem so aufeinander zu beziehen, dass neue Verbindungen entstehen. Dadurch wurde die Sozialdemokratie viel größer und nicht nur für Arbeiter, sondern auch für Intellektuelle interessant. Der linksliberale Lehrer war immer SPD, der Lateinlehrer im Philologenverband war immer CDU. Diese Grundformen haben wir immer noch im Kopf, und es gibt und gab wenige Politiker, die darüber hinausgreifen. Aber genau diese Figuren sind entscheidend. Angela Merkel ist hier vielleicht der paradigmatische Fall, verbunden übrigens mit der Tragik der SPD, dass ihre unbestreitbaren Leistungen in der Groko nicht ihr selbst zugerechnet werden.
Wer kann aktuell in der Bundespolitik die alten Grenzen sprengen?
Es ist kein Zufall, dass sich Kompetenzzuschreibung der angedeuteten Art derzeit nicht unbedingt in den alten Volksparteien konzentriert, sondern eher bei den Grünen, was sich ja in Wahlergebnissen und Umfragewerten auch zeigt. Die Aggression, die sie derzeit zum Teil bei Rechtskonservativen ernten, ist eine Art Umleitung der Aggression gegen Merkel, der man diese Kompetenz des Denkens über die Lager hinweg dort übel genommen hat. Dass jemandem wie Robert Habeck das derzeit offensichtlich gelingt, ist beeindruckend.
Es gehört zur Wahrheit, dass Sie Ihr Konzept der neuen Bündnisse für die Grünen entwickelt haben. Warum?
Na ja, ich arbeite seit langer Zeit über Übersetzungsfragen, und das hat mit den Grünen zunächst nichts zu tun. Aber ich war mit Robert Habeck darüber im Gespräch, auch mit Katrin Göring-Eckardt. Mein Vorschlag lautet: Denkt über Bündnisse von Akteuren unterschiedlicher Systemlogiken nach. Gründet Orte dafür, Foren, in denen sich die unterschiedlichen Logiken gegenseitig verunsichern können und wo auch die Übersetzungskonflikte hart ausgetragen werden können. Und dass die Verteilung der Klugen sich nicht an Parteigrenzen hält, wissen wir. Aber hier muss jemand die Meinungsführerschaft übernehmen und sich den Konflikten auch stellen.
Die Gesellschaft hat gerade angefangen, die Bundesgrünen durch Annalena Baerbock und Robert Habeck neu zu sehen, manchen Medien wird die Aufmerksamkeit schon wieder zu viel.
Die anbiedernde Geste vieler Medien der Person Habeck gegenüber ist peinlich und ein Ausdruck des Verlusts von Urteilskraft bei einem großen Teil der kommentierenden Klasse. Das ändert nichts an seinem lagerübergreifenden Denken. Fast noch beeindruckender finde ich, wie es Annalena Baerbock gelingt, etwa vor Wirtschaftsvertretern zu reüssieren und inhaltliche Brücken in andere Logiken zu bauen. Das ist offensichtlich die beginnende Kompetenz, die unterschiedlichen Logiken der Gesellschaft aufeinander beziehen zu können. Strukturell ähnelt das der Nach-Godesberg-SPD, aber in einer ganz anderen historischen Situation. Und es wäre von der Logik her etwas anderes als die Idee der linken Mehrheit mit Polarisierungspotenzial, wofür etwa Katja Kipping steht.
Ist die Idee der linken Mehrheit tot?
Weiß man nicht.
Ich meine inhaltlich.
Inhaltlich schon. Es gibt auch ein Milieu, das Grün nur wählen würde, wenn nicht R2G dabei rauskäme.
Was ist das Problem?
Das ist nicht die alte Linkenkritik, da sitzen genug vernünftige Leute. Wahrscheinlich muss eine politische Kraft sich wenigstens einem politischen Paradigmenwechsel stellen. Es geht nicht mehr um die Links-rechts-Achse, sondern eher um die Frage, ob es gelingt, politische und ökonomische Dynamiken, wissenschaftliches Wissen und rechtliche Formen aufeinander zu beziehen. Genaugenommen ist das immer das zentrale Thema des Kapitalismus und seiner Folgen gewesen – aber die klassische Akteurskonstellation hat das in Milieus aufgelöst. Heute wird es nicht anders gehen, als ökonomische Akteure, die Wirtschaft, wie wir gern sagen, ins Boot zu holen. Ich fürchte, dass eine linke Mehrheit eher die klassischen Konfliktlinien verlängert.
Die sozialökologische Bewegung und auch die grüne Partei wurden bisher von ihren Gegnern als bürgerliche Postmaterialisten auf Sinnsuche skizziert. Nun haben wir eine Jugend auf der Straße, die einfordert, dass ihre materielle Grundlage, die Erde, nicht zerstört und ihre Zukunft verheizt wird.
Genau darum geht es: nicht mehr nur um die üblichen milieudifferenzierenden Fragen, sondern um ein externes Problem. Bei allen anderen Dingen kann man interpretieren: Freiheitsverlust? Gibt es nicht. Gerechtigkeit? Haben wir längst. Aber Erderhitzung kann man nicht weginterpretieren. Bisher war Umwelt mehr eine interne Frage, nämlich, wie wir sie verteilen. Die Marxisten hatten eine Idee von materieller Umwelt, aber es war nur eine Frage der Produktivkräfte, ob man das entsprechend ausbeuten und dann gerecht verteilen kann. Jetzt sind die Produktivkräfte das Problem und nicht die Lösung. Da ist die Frage: Muss man die Produktivkräfte loswerden, um das Problem zu lösen, muss man sie ändern oder womöglich gar steigern? Diese Herausforderung ist mit den klassischen Bordmitteln nicht zu lösen. Deshalb funktionieren die klassischen Milieus nicht und die klassischen Konflikte auch nicht.
Konkret?
Das CO2-Problem wird sich weder als Gerechtigkeitsproblem lösen lassen noch mit der eher bürgerlichen Idee des freiwilligen Verzichts und schon gar nicht mit Staatslenkung und Verboten. Aber es gibt schon sehr unterschiedliche milieubedingte Energieverbrauchsmuster. Eine CO2-Steuer würde sicher sinnvolle Anreize für die Industrie setzen, für das individuelle Verhalten ist es in den sozial schwachen Milieus eher bedeutungslos, weil dort ohnehin weniger Energie verbraucht wird. Es würde dort sogar zu Entlastungen kommen. Und bei den Besserverdienenden wird der Benzinpreis oder eine CO2-Steuer die Leute kaum am Fahren oder Fliegen hindern, eine perfekte Infrastruktur aber vielleicht schon, etwa der ICE Berlin–München. Wäre übrigens auch ein schönes Investitionsprogramm. Solche Konzepte sind möglich, werden aber zu wenig verfolgt, was ein großes Misstrauen in die politischen Problemlösungskapazitäten hineinbringt. Warum triggert denn Fridays for Future eine ganze Generation?
Wie wird aus dem generationellen Protest ernsthafte Klimapolitik?
Richard David Precht etwa meint, die Leute wollten Verbote. Ich würde eher von praktikabel erscheinenden klaren Regeln sprechen. Aber die Frage ist, wie und wer davon profitieren kann. Darum geht es. Wenn man Menschen etwas wegnimmt, muss man ihnen was anderes geben. Damit meine ich nicht Geld, sondern Lösungen für das, was sie nicht mehr machen sollen. In der Mobilität, beim Fleischessen und so weiter. Das funktioniert wie auf Märkten – und vielleicht sollte man die Angst vor der Marktlogik verlieren. Es fallen mir genügend Bereiche der Gesellschaft ein, bei denen die Marktlogik versagt und sogar eher schädliche Folgen hat. Aber wenn es ums konkrete Verhalten geht, geht nichts über Anreizstrukturen.
Selbst über Industriefleischreduktion kann man bisher nicht vernünftig reden.
Die Herausforderungen sind so groß, da bleibt uns nichts anderes übrig, als das große Gespräch zu führen, wie Willy Brandt das genannt hat. Wir haben die Westbindung hingekriegt, dann die Ostpolitik, die soziale Aufstiegspolitik mit ihren ideologischen Debatten, immer verbunden mit den Warnungen, dass das Land zugrunde geht und es am Ende unendlich profitierte.
Ausgerechnet die Grünen sollen dieses neue Willy-Gespräch voranbringen? Eine verbreitete Annahme ist immer noch, dass die Grünen ein selbstbezogenes Milieu von okay verdienenden Weltbürgern seien.
Die Grünen sind ja insofern eine moderne Partei, dass sie nicht mehr wie Volksparteien der Industriegesellschaft die Sachprobleme ihrer Milieus abbildeten und bearbeiteten. Mir geht es aber nicht um den Milieubereich, dazu gibt es widersprüchliche Forschungsergebnisse. Mir geht es jetzt um die Streuung in den Funktionssystemen. Da sitzen Wissenschaftler, Unternehmer, Lehrer, Ärzte, Anwälte, Techniker, Gewerkschafter zuzüglich weiblicher Formen natürlich. Man kann nicht sagen, das sei eine Partei, die eher auf der Seite von Kapital oder Arbeit steht, die eher soziale Gerechtigkeit oder Bewahrung will.
Sondern?
Das ist eine, die dazwischen steht, was ihnen von den Linken immer übel genommen wurde. Darin sind sie übrigens der Union viel ähnlicher als der Sozialdemokratie, weil auch dort mit ähnlichen Bezugsproblemen gearbeitet werden muss. Ich denke, dass die entscheidende strategische Partnerschaft für das Experiment einer Politik der Bündnisse mit unterschiedlichen Logiken am ehesten mit der Union möglich ist, auch weil das das eigentliche Thema eines modernen Konservatismus sein müsste. Mal sehen, ob sich da entsprechendes Personal herausbildet. Es sieht gerade nicht so aus, aber ich hätte ein paar Namen im Sinn. Die Grünen wollen eine radikale Transformation ohne radikale Revolution. Und sie glauben an technische Lösungen. Sie sind sowohl wirtschaftsnah als auch protestnah.
Ist das jetzt ein Vorteil?
Man kann selbstverständlich sagen, ich will den Kapitalismus gar nicht, aber damit setzt man seine Logik nicht außer Kraft. Man muss die Marktlogik so einsetzen, dass sie die Sache voranbringt. Wir müssen denen helfen, mit den richtigen Sachen Gewinne zu machen, wie etwa Ralf Fücks seine liberale Idee skizziert hat. Vertragliche Modelle zwischen Staat und Wirtschaft, ein ganz neues Verhältnis zu den Gewerkschaften, die sich auch auf Transformationen einstellen, nicht zuletzt die Frage intelligenter Steuerung durch technische, rechtliche und ökonomische Anreizformen – nur damit kann man langfristige Politik machen. Die unterschiedlichen Logiken ineinander übersetzen und nicht in einer zentralen Idee aufheben – das wäre jene Transformation, die die Tradition der liberalen Idee der Gewaltenteilung von der politischen Sphäre in die Gesellschaft hineinholen will. Diese Übersetzungsleistung – das wäre für mich eine gute Strategie. Vielleicht müssen die Grünen nicht linker werden und nicht konservativer, aber liberaler vielleicht in dem Sinne, dass sie Andockstellen an ganz unterschiedliche Systemlogiken finden müssen. Beim Liberalen ist noch viel Luft nach oben.
Diese Übersetzung versuchen Kretschmann, Habeck, Al-Wazir seit Jahren. Aber für viele Funktionäre ist es ein radikaler Widerspruch zu dem, was sie gelernt haben, was sie fühlen, wie sie aufgewachsen sind?
Ja, aber nicht nur für die Grünen, das ist für alle ein Widerspruch. Irgendwie müssen sie alle Federn lassen, damit ihnen neue wachsen. Wir sehen es doch in der Union, die keine Idee davon hat, was sie da eigentlich bewahren will. Wir sehen es bei den Liberalen, für die derzeit eigentlich Hochzeit sein müsste. Wir sehen es bei den Sozialdemokraten, die ihren Fokus völlig verloren haben. Und wir sehen es bei den Linken, die ja durchaus einen interessanten Lernprozess hinter sich haben. Aber es geht nicht mehr mit der Hybris einer Kontrolllogik. Ein komplexes System lässt sich nicht gängeln.
Wie geht es?
Es geht um intelligente Gängelung, um die Entfachung von Eigendynamiken.
Welche?
Wir haben genügend Beispiele. Wenn man Schutzrechte für Arbeitnehmer einbaut, geht jedes Mal das Abendland unter, das kennen wir doch. Kündigungsschutz, Mutterschutz, Mindestlohn, immer sagen wirtschaftliche Akteure: Geht nicht. Zwei Jahre später gewöhnen sie sich dran. Man darf doch nicht glauben, dass die Leute das tun, was sie sagen. Sie tun, was sich bewährt. Ich bin da illusionsfrei, dass es über Aufklärung läuft. Sie müssen sich an bestimmte Argumente und Praktiken gewöhnen.
Die bequemere Denkungsart geht andersherum: Mit denen geht das nicht.
Es ist strukturell ähnlich mit dem, was ich Bündnisse der unterschiedlichen Logiken nenne: Man müsste mit denen arbeiten, die eher maximal unterschiedlich als maximal ähnlich sind. Das wäre die Grundlogik, die Übersetzungslogik, die ich vorschlage.
Das müsste man.
Ich weiß, das hört sich unglaublich naiv an, aber es ist die einzige Möglichkeit. Es geht um das Äquivalent dessen, was in der Wissenschaft Interdisziplinarität heißt. Natürlich haben die Leute je eigene Interessen. Aber es muss klar werden, dass die nur in strategischen Partnerschaften erreicht werden können. Man muss über die Grenzen hinausdenken. Das können nur die Schlauen. Und das ist nicht nur ein politisches Programm, das muss auch unternehmerisch, gewerkschaftlich, wissenschaftlich, rechtlich und nicht zuletzt technisch gedacht werden.
Das ist elitär, damit werden die Dummen nicht glücklich sein.
Natürlich ist das elitär, das ist immer elitär gewesen. Die pädagogische und politische Kunst der Eliten ist es, den Leuten Dinge zu sagen, von denen sie denken, dass sie sie selbst gesagt haben. Leider ist das auch die Kunst der Unsäglichen. Die AfD schafft es, bei Leuten Ressentiments zu produzieren, die vorher gar nicht auf die Idee gekommen wären. Aber das Entscheidende sind die Übersetzungsleistungen. Ich selbst bin dadurch erst auf Fragen gekommen, auf die ich mit meinen eigenen Mitteln nicht gekommen wäre. Daraus muss man mehr machen. Das ist Kompetenz. Das ist es, was Eliten können müssen – Übersetzung leisten. Und wenn ich noch eine Bemerkung zum Anfang des Gesprächs machen darf: Der Vorwurf des unsicheren Kantonisten ist für mich als engagiertem Chorsänger natürlich schon niederschmetternd.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen















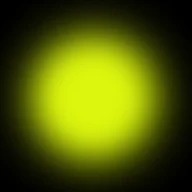


meistkommentiert
Studie zu Bürgergeldempfängern
Leben in ständiger Unsicherheit
Selbstfahrende Fahrzeuge von Tesla
Ein Weg weg vom Privatauto
Nach Russland-„Manifest“
Ralf Stegner soll Parlamentarisches Kontrollgremium verlassen
Spanien verweigert 5-Prozent-Natoziel
Der Trump die Stirn bietet
Neurowissenschaftlerin
„Hirnprozesse führen dazu, dass wir entmenschlichen“
Mindestlohn für Erntehelfer
Bauernverband für weniger Lohn an Ausländer als Deutsche