Rassismusvorwürfe gegen Jugendamt: Kindeswohl in Gefahr
Viele Inobhutnahmen seien ungerechtfertigt, weil Behörden häufig aufgrund von Vorurteilen arbeiten, kritisieren antirassistische Organisationen.
„Die Jugendämter sind Hilfseinrichtungen, deren Aufgabe die Sicherung des Kindeswohls ist. Doch meistens kommt es seitens der Jugendämter zu einer viel größeren Kindeswohlgefährdung, sagt eine Sprecherin von Space2grow, einem Projekt für geflüchtete und migrierte Frauen, das zusammen mit der Kampagne für Opfer von Polizeigewalt (KOP) und der Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt Reach Out die Veranstaltung organisiert hat.
Im Jahr 2022 ist die Inobhutnahme von Kindern in Deutschland um 40 Prozent gestiegen; migrantische Familien sind hier überproportional betroffen.
Marie Melior, Rechtsanwältin für Familienrecht, sagte: „Bei Essen und Sprache fängt der Rassismus bereits an. Wenn das Kind zum Beispiel nur arabisches Essen bekommt und mit der Mutter kein Deutsch spricht, gilt dies bereits als eine Kindeswohlgefährdung.“ Dies seien Gründe genug, um eine Kindesentziehung einzuberufen.
Verlust von Kultur
Die Maßnahmen würden für die Eltern ein Entzug von Autorität und Kultur bedeuten: Die Familien sind unter Beobachtung, es wird alles notiert, es werden Protokolle über die jeweiligen Betroffenen geführt, und diese dürften aus datenschutzrechtlichen Gründen ihre eigenen Akten nicht einsehen.
In den meisten Fällen wehren sich die Betroffenen nicht, da sie Angst haben, ihre Kinder nie wiedersehen zu dürfen, heißt es von den antirassistischen Initiativen. Ein weiteres Problem seien Sprachbarrieren. Die Dokumente, Beratungsgespräche und Gerichtsverfahren seien alle auf Deutsch. Auch bei den Jugendämtern wird das sprachliche Unverständnis als mangelnde Kooperationsbereitschaft ausgelegt. Auch das führe nicht selten zu Kindesentzug.
Marie Melior berichtete von einem Gerichtsverfahren gegen eine junge Mutter. Die Frau habe kein Deutsch verstanden, weshalb Melior anfing zu dolmetschen. Daraufhin sei sie vom Richter zurechtgewiesen worden; es sei keine Übersetzung vorgesehen. Das Urteil des Richters: Die Frau brauche eine Therapie, sei unzurechnungsfähig. „Und so wird in den meisten Fällen entschieden. Die Betroffenen verstehen die Sprache nicht und können nicht reagieren. Dies aber wird als Unzurechnungsfähigkeit eingestuft.“
Die Teilnahme an rassismuskritischen Weiterbildungen für Sozialarbeiter:innen wäre eine Möglichkeit, die Situation zu verbessern, schlägt Melior vor. Auch würde es helfen, wenn mehr Dolmetscher:innen eingestellt werden, um die sprachliche Barriere aufzuheben. Die Organisationen würden gern intensiv mit den Jugendämtern zusammenarbeiten, aber dies sei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machbar. Das Problem, kritisieren sie, sei in erster Linie ein politisches. Statt Kürzungen sozialer Infrastruktur bräuchten Betroffene mehr Beratungsstellen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen












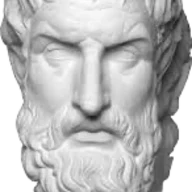
meistkommentiert
Wahl der Bundesverfassungsrichter:innen
Spahns miese Tricks
Kruzifixe in bayrischen Schulen
Das Kruzifix ist ein Eingriff in die Freiheit
Streit über Verfassungsrichter*innen
Bundestag verschiebt die Wahl
Inhaftierte Aktivist*in in Ungarn
„Herr Wadephul muss Maja T. zurück nach Hause holen“
Kompromisse in der Politik
Aufeinander zugehen heißt zu oft Rechtsruck
Hitze und Klimapolitik
Kommt zurück, Futures!