Proteste gegen die Räumung von Lützerath: Gegen den Wind
Zehntausende protestieren: Die Polizei setzt vor dem Dorf Schlagstöcke ein, während drinnen die Zerstörung von Lützerath voranschreitet.
S chlamm. Knietiefer Schlamm ist das, was vor allem anderen in der Erinnerung bleiben wird von der großen Demonstration am Samstag gegen die Zerstörung des Weilers Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier. Groteske Szenen spielen sich ab in den tief vermatschten Feldern zwischen dem von der Polizei hermetisch abgesperrten Lützerath selbst, dem Kundgebungsgelände gut einen Kilometer entfernt und auf den vielen Wegen und Pfaden dorthin: Immer wieder bleiben Menschen querfeldein mitten im Gehen die Stiefel stecken, worauf der nächste Schritt ungewollt auf Socken folgt. Dann müssen Umstehende mit vereinten Kräften das zurückgebliebene Schuhwerk zuerst orten und dann bergen.
Manche Protestierende stürzen Maikäfern gleich rücklings in den braunen Morast. Andere bewegen sich gleich barfuß voran. Regen peitscht über das weite flache Land, von Sturmböen untersetzt.
Und dann droht noch etwas ganz anderes: eine Schlammschlachtdebatte nämlich, bei der es allerdings nicht um aufgeweichte Böden infolge von Dauerregen geht, sondern um massive Polizeigewalt.
Die Veranstalter haben mit achttausend Menschen gerechnet, es kommen trotz des fürchterlichen Wetters mehrere zehntausend, quer durch alle Generationen übrigens und von überall aus dem Land: Busse aus Berlin und Hamburg, viele Privatwagen aus Brüssel, Stuttgart oder Bühl bei Baden-Baden.
In den Bahnhöfen von Köln und Düsseldorf geht zeitweilig ob der Menschenmassen, die sich auf den Weg zur Demonstration machen, nichts mehr. Seriös zählen kann die Menschenmenge niemand, die sich beim kilometerlangen Weg durch die Felder und das zu rund 90 Prozent entsiedelte Geisterdorf Keyenberg aufmachen.
Auffällig sind dabei vorgetragene Forderungen, die weit über die verlangte Rettung eines Weilers am Niederrhein hinausgehen: Vom „Systemwechsel“ ist da auf Fahnen die Rede, und Gesänge wie „One solution – revolution“ oder „A – Anti – Anticapitalista“ oder „No justice, no peace – abolish the police.“ Und einen feministischen Block mit mehr Männern als Frauen gibt es auch.
Am tiefen Loch zur Braunkohle
Am Freitag noch hatte das Verwaltungsgericht Aachen die Polizei zurückgepfiffen, weil diese nur einen abgelegenen Demonstrationszug genehmigen wollte. Die Begründungen: befürchtetes Verkehrschaos und Gefahren durch die zu große Nähe zur Tagebaukante. Das Gericht verwies darauf, dass es eben genau Aufgabe der Polizei sei, Verkehr und Sicherheit zu regeln.
Neugierig bewegen sich viele Protestierende bis an die Grubenrandkante, dort wo das Land jäh abfällt in ein tiefes Loch. Sie bleiben unbehelligt von der trotz tausendfacher Präsenz überforderten Polizei, die über die sozialen Medien Warnungen vor Lebensgefahr verschickt. Ein Demonstrant stellt sich an den Rand und pisst unter Applaus der Umstehenden in das Loch: „Ich flute jetzt den Tagebau.“
Östlich von Keyenberg sieht man plötzlich am Grubenrand eine Gruppe Polizisten im Laufschritt. Nichts wie hin, haben es Protestierende etwa geschafft, dort herunterzukommen? Fehlalarm. Unten ist nur ein Reh zu erkennen, das in Panik durch die Mondlandschaft springt, auf der Suche nach Schutz, den es nicht gibt. Später schaffen es woanders doch noch einige Protestierende nach unten.
Greta Thunberg spricht
Als dann Greta Thunberg, 20, die „Ikone der Klimabewegung“ aus Schweden, deutlich verspätet ihre Rede beginnt, sind Tausende immer noch auf dem Weg zum Kundgebungsgelände. Windböen tragen Fetzen der empörten englischsprachigen Worte Thunbergs heran, unterbrochen von Jubelsalven. Sie spricht von Deutschlands Blamage in der Klimafrage, wie „absolut absurd“ es sei, weiter Kohle zu verstromen gegen alles Wissen um die Klimavernichtung. „Die wahren Führungspersönlichkeiten sind da drüben: Es sind die Menschen, die in den Baumhäusern sitzen und Lützerath seit Jahren verteidigen“, sagt Thunberg. Neue lange Jubelsalve, auch als sie die verwüstete Garzweiler-Welt mit „Mordor“ verglich, dem Schicksalsberg des Bösen im „Herrn der Ringe“.
Greta Thunberg auf der Demonstration
Genau dort, wo Greta Thunberg steht, soll nach neuen Erkenntnissen die Eigentumsfrage der schlammigen Äcker noch nicht geklärt sein. Die Aktivistin und Landtagsabgeordnete Antje Grothus (Grüne) hat den Medien am Donnerstag Dokumente zugespielt, die nahelegen, dass 4 Prozent der Flächen für die geplante Erweiterung des Tagebaus noch anderen gehört, die partout nicht verkaufen wollen, und nicht der RWE. Langwierige Enteignungsverfahren und Prozesse drohen.
In Wahrheit ist es noch schlimmer: Schon beim Deal zwischen den grünen Klimaministerien in Bund und Land mit dem Energiekonzern im Oktober letzten Jahres war das Problem bekannt, wurde aber geflissentlich verschwiegen. Bleibt ein Stück Hoffnung: „Solange die Kohle hier noch unter der Erde ist“, ruft Greta Thunberg, „ist der Kampf nicht zu Ende. Gebt nicht auf.“
Die Schwedin ist schon am Freitagnachmittag in Lützerath eingetroffen. Sie besucht, wohl ausgewiesen durch ihren Prominentenstatus, den eigentlich hermetisch abgeriegelten Rest des Dorfes. Zusammen mit ihrer deutschen Fridays-Kollegin Luisa Neubauer und den verbliebenen Menschen in den Baumhäusern skandiert sie dort, das Pappschild „Keep it in the ground“ vor sich: „Lützi bleibt!“ und „Ihr seid nicht allein.“ Danach übersetzt ihr die Sprecherin von „Lützerath Lebt“ die Bedeutung der Rufe.
Von Lützerath ist kaum mehr etwas übrig geblieben
Während am Samstag draußen die Demonstrationszüge aufziehen, zeigt sich in Lützerath selbst die Traurigkeit mit all ihrer Wucht: Am späten Vormittag schlägt ein Bagger die erste Schneise in das letzte geräumte Steinhaus. Das große Protestcamp, eben noch voller Zelte und Hütten, hat sich in eine einzige Morastfläche und Unratwüste mit nur noch wenigen verbliebenen Bauten verwandelt. Der Turm in der Mitte mit den Greenpeace-Sonnenpaneelen steht noch wie ein Mahnmal in der Leere, auch die Friedenslinde, gepflanzt um 1650, ist unangetastet. Noch. Aber: So überraschend schnell die Verwüstung Lützeraths anfangs vonstattengeht, das heimliche Ziel, mit der Räumung bis zur Demonstration fertig zu sein, wird nicht erreicht.

Beamte auf Hubbühnen schneiden sich in Lützerath durchs Geäst in Richtung der am Samstagmittag noch sechs verbliebenen Baumbehausungen, die sich „Reihenhaussiedlung“ nennen, mit Blick auf die Tagebauwüste im Osten. Im allgegenwärtigen Lärm von Sägen, Baggern und den Motoren der Baufahrzeuge sind nur noch vereinzelt Durchhalteparolen aus großer Höhe zu hören, so wie das allgegenwärtige „Du bist nicht allein“. Es kommt auch mal von irgendwoher ein lautes „Hilfe!“
Ein polizeilicher Kletter-Experte aus Berlin macht sich auf den Weg zum ersten Höhen-Einsatz des Tages: Ob er auch etwas Schiss habe? Nein, sagt er, „meistens geht oben alles ganz friedlich ab. Aber man weiß halt nie, was die Leute vorbereitet haben.“ Der Wunsch „Alle Sicherheit Ihnen und wenig Erfolg!“ begleitet ihn. Er lächelt. „Danke. Das ist ja auch meine Aufgabe, aber eine eigene Meinung zu dem allen hier haben wir ja schon …“
Mittlerweile stehen in Lützerath mehr Mannschaftswagen der Polizei in unendlicher Reihe, als Bäume stehen geblieben sind. Ein Bagger macht sich an an den Aluminium-Konstruktionen einer Halle zu schaffen; eine nach der anderen Aluminium-Schiene kracht scheppernd herunter. Am Nachmittag hängt eine Baumhausbewohnerin minutenlang kopfüber an ihrem Seil von einer Baumhausstruktur herunter. Ein Polizeikletterer rettet sie.
In der Nacht zum Sonntag bauen die verbliebenen AktivistInnen in Lützerath, höchstens zwanzig sind es noch, nach eigenen Angaben neue Traversen zwischen die verbliebenen Baumhäuser und Pfahlkonstruktionen. Auch „Pinky“ und „Brain“, die Höhlenbewohner, bleiben tief im Untergrund versteckt. Die beiden haben sich in einem über Monate erbauten Tunnelsystem verschanzt. Schon seit dem Donnerstag versucht die Polizei sie aus ihrem Erdreich-Verließ herauszuholen. Das Vorhaben scheitert Tag um Tag.
Mittlerweile suchen Spezialkräfte des Technischen Hilfswerks nach neuen Ideen, bislang erfolglos. Am Sonntag heißt es aus Kreisen der Protestierenden: „Die Menschen im #LuetziTunnel lassen alle grüßen und haben nochmals betont, dass es sich bei ihrer Situation um eine Räumung und keine Rettung handelt.“ Am Sonntagnachmittag meldet die Polizei, dass die letzten Baumbesetzer geräumt worden sind.
Bauer Heukamp und sein Haus
Wenn „Pinky“ und „Brain“ irgendwann wieder ans Tageslicht kommen, werden sie ihre Umgebung nicht wiedererkennen: Wüste statt Wohnort eben. Ein blauer Bagger zerlegt am Samstag weiter den mächtigen, 1763 erbauten Hof des zwangsvertriebenen Bauern Eckardt Heukamp. Der 58-Jährige vormalige Hofbesitzer wohnt seit dem Oktober vorübergehend in einem drei Kilometer entfernten Hof von Holzweiler und weiß noch nicht, ob und wo er Land weiter dauerhaft bewirtschaften wird.
Zur der Demonstration ist Heukamp extra aus dem lange geplanten Urlaub in Österreich gekommen, wo er die Bilder von der Zerstörung seines Hofs im Fernsehen gesehen hat: „Mein Zuhause ist kein Spielball für Gerichte und Politik, die sich aus der Verantwortung für Klimaschutz ziehen wollen“, sagt er am Samstag der Aachener Zeitung. Jetzt steht er am frühen Samstagnachmittag hier draußen mit Blick auf die Polizeiketten. Er habe seine Heimat ein letztes Mal sehen wollen, sagte er. „Am liebsten würde ich da durchlaufen“, wird er zitiert. „Das ist bitter. Hier sieht man das Versagen der Grünen-Führung, Lützerath zu retten.“
Zur gleichen Zeit entwickeln sich vor dem hermetisch abgeschotteten Dorf kleine Scharmützel zwischen der Polizei und den Demonstrierenden. Immer wieder versuchen Gruppen in das flutlichtgestrahlte Gelände durchzubrechen. Ob es einzelnen zeitweise gelingt, ist bis zum Sonntag umstritten. Unstrittig sind viele hässliche Szenen: Schmähgesänge und Schlammwürfe gegen die Beamten, von denen einer eine kleine Böschung heruntergeschubst wird. Der Täter entschwindet im Getümmel.
Die Gewalt greift um sich
Auf der anderen Seite ist das rabiate Vorgehen der Polizei unverkennbar: Es wird reichlich Pfefferspray versprüht, es gibt Rangeleien, Tritte der Beamten, Hundebisse gar, vor allem aber einen erschreckend heftigen Einsatz der „Einsatzmehrzweckstöcke“, wie die Polizei ihre Gummiknüppel nennt. Reiterstaffeln marschieren auf, Pferd und Beamte unter gelben Regenplanen geschützt. Videos zeigen, wie wenig die Stockschläge der Aufgabe dienen, dass kein Demonstrierender in den Ort eindringt. Es geht vielmehr um eine wahllose Maßregelung drängelnder Menschen.
Die Folgen zeigen sich am Sonntag: Verletzte auf beiden Seiten, teilweise schwer misshandelte Demonstranten, mehrere mit Knochenbrüchen und eine zeitweilig ohnmächtig. Rettungskräfte würden das ausdrücklich belegen, twittert die Aktionsgruppe „Lützerath Bleibt“
Die Polizei beklagte mehr als 70 Verletzte in ihren Reihen. Die Zahl umfasse allerdings sämtliche Verletzungsformen und Ursachen und differenziere nicht zwischen Gewalt durch Demonstranten oder Unfälle. Am Samstag beispielsweise hat ein Polizeipferd auf dem Weg zum Einsatz gescheut, der Polizist ist heruntergefallen.
Seit Beginn der Räumung am Mittwoch seien, so die Polizei, inklusive der Großkundgebung am Samstag etwa 150 Strafverfahren eingeleitet worden. Die Vorwürfe: Sachbeschädigung, Widerstandsdelikte, Landfriedensbruch.
Grotesk gerät der Polizei allerdings der Einsatz ihrer mächtigsten Waffe: Zwei Wasserwerfer fahren am späteren Nachmittag auf die vorwärts drängenden DemonstrantInnen zu. Ihre Fontänen geraten allerdings genau gegen die Sturmböen, so dass das Nass auf die Fahrzeuge zurückgeblasen wird. „Maßnahme fruchtet nicht. Bitte einstellen“, so wird ein Einsatzleiter zitiert.
Rückweg in das Dorf Keyenberg: Zurückgeblieben sind an einer Stelle elf Mannschaftswagen der Polizei in Reihe mit aufgeschlitzten Reifen, abgerissenen Spiegeln und rundherum massiv schlammverschmiert. „Was hat das wohl dem Klima gebracht?“, schimpft ein Beamter dem zurückströmenden Lindwurm entgegen. Eine Mittfünfzigerin antworte: „Und was bringt Ihr Einsatz dem Klima?“ Der empörte Mann schweigt.
Der Streit um die Deutung der Ereignisse
Es ist offensichtlich, dass dem chaotischen Samstag nun eine etwas andere Schlammschlacht folgen wird, in der es nicht um Regenfälle, sondern um Gewalt geht, um Argumente, Schuldzuweisungen, Rechtfertigungen und das Aufrechnen von Verletztenzahlen. Die Fronten dürften sich noch weiter verhärten.
Einige lokale Blätter im Rheinland geben schon seit Tagen die Richtung vor. Da werden Jubelkaskaden über die Polizei in die Welt gesetzt, da heißt es: „Widerstand bröckelt“, „Holzhütten und Barrikaden dem Erdboden gleichgemacht“. Schon ein einzelner geworfener Apfel aus einem Baumhaus wird zur Kriegserklärung stilisiert.
Wenig beachtet in der Debatte um die Braunkohleförderung ist der Beifang bei der Erweiterung des Tagebaus für RWE: die Millionen Tonnen Abraum, die der Konzern dringend zur Abflachung der besonders steil gegrabenen Tagebaukanten benötigt. Der Abraum, immerhin bester Lößboden, ist gerade in den Quadratkilometern hinter Lützerath besonders kostenarm und einfach zu gewinnen.
Am Abend, schon fern schon von Lützerath und der Demonstration, bleibt eines: der Schlamm. Überall auf den Bahnsteigen der Region sieht man zwei verschiedene Sorten Menschen: solche mit Normalkleidung und die vielen, die intensiv verschmutzt und von trocknender Erde verkrustet den Ausgängen zustrebten, teils noch ihre Fahrräder schiebend, die wie nach einer Weltmeisterschaft im Querfeldeinfahren aussehen. Die zweite Gruppe eint lächelnd die stille Übereinkunft: Ach, ihr wart also auch da. Dazu die Idee: Könnte Schlamm, effizient genutzt, in Strom verwandelt werden, wäre die Energiedebatte umgehend vom Tisch.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen













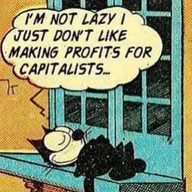


meistkommentiert