Polizeigewalt in Lützerath: Demokratie erleben, Nase gebrochen
Ein politischer Familienausflug endet mit Verletzungen. In Lützerath hat nicht nur der Kampf gegen den Klimawandel eine Niederlage erlitten.
Als Familie A. am Vormittag des 14. Januar zur Demonstration Richtung Lützerath mit dem Auto fährt, herrscht gute Stimmung. Zwar standen sie am Vormittag mehr als eine Stunde im Stau und mussten im fünf Kilometer entfernten Wanlo parken, aber es fühlte sich irgendwie wie ein Familienausflug mit Sinn an. Ein Selfie zeigt den Ehemann, ein Diplomingenieur Anfang 40, lächelnd mit seiner Ehefrau, einer Ärztin, und dem 14-jährigen Neffen. Der Jugendliche soll hier Demokratie live erleben.
Familie A. ist nicht damit einverstanden, dass der Energiekonzern RWE die Braunkohle in der Region fördern will, dafür das ganze Dorf abreißen lässt und das Klima schädigt. Was die Familie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt: Wenige Stunden später werden sie alle große Zweifel hegen, nicht nur an der Klimapolitik, sondern auch an dieser Demokratie.
Auf dem Familienselfie sind hinten ein paar Demonstrant*innen zu sehen. Drei Menschen mit Kameras, vermutlich Vertreter*innen der Presse, stehen erhöht und überblicken die Menschenmasse am Rande von Lützerath. Danach folgt eine Reihe mit Polizeiwannen, dahinter vier freistehende Gebäude, ein paar kahle Bäume – was halt von dem mittlerweile weltberühmten Dorf noch übrig geblieben ist. Der Zeitstempel in den Metadaten des Selfies gibt den 14. Januar, 15.55 Uhr an.
Viele Menschen erheben seit den Zusammenstößen am vergangenen Wochenende schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden und RWE. Sie beklagen unverhältnismäßige Polizeigewalt gegen friedliche Proteste. NRW-Innenminister Herbert Reul verteidigte das Vorgehen seiner Beamt*innen und nannte ihre Arbeit „hochprofessionell“. In Interviews sprach er von „zwei, drei Einzelfällen“, bei denen sich „ein Polizist nicht richtig verhalten habe“ und deswegen „zur Rechenschaft gezogen werden müsse“. Diese Fälle lasse er überprüfen.
Exemplarischer Fall
Die Masse der dokumentarischen Videos und Bilder im Netz und der vielen Beschwerden von Demonstrant*innen wirken wie ein krasser Kontrast zur Darstellung des CDU-Innenministers. Vier Tage nach dem Polizeieinsatz in Lützerath haben sich bei der Initiative „Lützerath lebt“ laut eigenen Angaben 145 verletzte Demonstrant*innen gemeldet: 115 seien von Polizist*innen getreten oder geschlagen, 45 Menschen am Kopf verletzt worden, 10 Menschen hätten Knochenbrüche erlitten, 15 Menschen seien vom Notdienst oder im Krankenhaus behandelt worden. Der Fall der Familie A. steht also exemplarisch für eine Debatte rund um Polizeigewalt, die die Klimabewegung, die Sicherheitspolitik, die Polizei und Gerichte in NRW und Deutschland noch lange beschäftigen dürfte.
Familie A. möchte nicht mit Klarnamen vorkommen. Sie haben Angst davor, in einen medialen Strudel gezogen zu werden. Sie haben aber auch Angst vor der Polizei. Der taz sind die Klarnamen der Familie bekannt. „Am Anfang war die Atmosphäre locker“, sagt Herr A. Sie seien herumgelaufen, hätten den Ausblick auf die Äcker rund um Lützerath auf sich wirken lassen. Nach ein paar Stunden wollten sie dann den Heimweg antreten, im Stau könnte es ja wieder länger dauern. Dann aber seien sie doch noch spontan auf einen letzten Demonstrationszug aufgesprungen.
Auf einmal standen Polizist*innen vor ihnen, erinnert sich das Ehepaar A. im Gespräch mit der taz. Die Beamt*innen hätten die Demonstrant*innen geschubst. „Ich habe spontan ‚Hey, hey, hey!‘ gerufen, daran kann ich mich erinnern“, sagt Herr A. Dann sei alles sehr schnell gegangen.
Auf Twitter kursiert ein sechs Sekunden langes Video, der taz liegt eine 19-sekündige Version der Aufnahme vor. Zu sehen ist ein am Boden liegender Mann mit blauer Jeans, grauer Jacke, kräftiger Statur. Die Kleidung deutet darauf, dass es sich um Herrn A. handelt, so wie er auf allen Selfies der Familie an diesem Tag aussieht. Ein Polizist hat ihn im Griff und schlägt mit der Faust in Richtung seines Gesichts. Im Video sind Schreie zu hören, jemand ruft laut „Bitte! Meine Güte!“ Ganz vorne steht ein Demonstrant in einer schwarzen Jacke mit dem Rücken zur Kamera. Er hat beide Arme angehoben, so als würde er fragen: What the fuck passiert hier gerade? Ein Polizist kommt von links ins Bild und schubst ihn weg. Vor dieser Szene versucht die Polizeikette die Demonstrant*innen zurückzudrängen. Dabei sind zwei Männer – einer von ihnen Herr A. – offensichtlich zwischen die Fronten geraten. Die Ehefrau und der Neffe, ebenfalls gut an der Kleidung identifizierbar, sind direkt hinter der Polizeikette zu erkennen.
Drei Faustschläge
A. sagt, dass er kurz vor der Attacke Augenkontakt mit dem Polizisten gehabt habe. „Wir retten die Welt, was tut ihr?“, hatte A. im Chor mit den anderen Demonstrant*innen gerufen. Kurz danach hätten ihn mindestens drei Faustschläge getroffen. „Ich hatte einfach Angst um meinen Neffen und wollte zu ihm. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass die Polizei so extrem mit Gewalt arbeitet“, sagt A.
Als der Polizist von A. ablässt, soll er noch gerufen haben: „Hast du genug Großer?“ A. soll immer wieder beteuert haben, dass er nichts getan habe. So stellt es die Familie dar. Danach wurde er von der Polizei abgeführt, von seiner Familie getrennt und – während die Dämmerung einsetzte – ins abgesperrte Gebiet in Lützerath gefahren. „Ich habe quasi eine Führung durch das Dorf bekommen, ich habe die abgerissenen Häuser und Baumhäuser gesehen. Es war alles so absurd“, sagt A.
Die Polizei habe ihn auf dem RWE-Gelände in Lützerath durchsucht und seinen Rucksack ausgeräumt. Ein Beamter hat alles in einem Protokoll festgehalten, das der taz vorliegt. Dort steht aufgelistet, was im Rucksack von A. zu finden war: ein faltbarer Miniregenschirm, ein Mobiltelefon, eine Trinkflasche aus weichem Kunststoff, ein Baguette mit eingebackenen Peperoni und Feta und zwei Servietten, mit denen A. später das Blut von seinem Gesicht wegwischen wird.
„Der Polizist, der mich geschlagen hat, war die ganze Zeit dabei“, sagt A. Nach mehreren Bitten, ärztlich behandelt zu werden, habe A. ein Kühlakku für sein Gesicht bekommen. Der Polizist soll ein Kühlakku für seine Faust bekommen haben. Einige Stunden habe es gedauert, bis A. entlassen wurde, in dieser Zeit habe sich niemand ernsthaft medizinisch um ihn gekümmert – obwohl er konstant im Gesicht geblutet habe.
Zwei Kühlakkus
A. sei dann von einer Polizistin in einem Gefangenentransport mit einzelnen Zellen eingesperrt und an einem Acker abgesetzt worden, sagt A. Die Metadaten eines Selfies, das er kurz danach mit seinem Handy aufgenommen hat, zeigt 20.41 Uhr an. Es ist stockdunkel. Die Nase von A. ist dick geschwollen, aus einer Platzwunde unter seinem linken blau angelaufenen Auge fließt Blut.
„Ich war orientierungslos, verdreckt, es hat stark geregnet, es gab keinen Gehweg, und Polizeiwagen rauschten gefährlich nah auf der Piste an mir vorbei“, sagt A. Sein Handy habe ihm angezeigt, dass er bis Wenlo mehr als eine Stunde zu Fuß brauche. Er habe Angst gehabt, habe sich degradiert gefühlt: „Ich wurde wie Abfall behandelt.“ Das Selfie mit den Wunden im Gesicht postet er in die Familiengruppe auf der Messenger-App Signal. Es dauert ab da noch knapp zwei Stunden, bis er erschöpft zu seiner Familie ins Auto steigen kann.
Die Verletzungen im Gesicht von Herrn A. werden nach dem Chaos-Samstag in Lützerath in der Uniklinik Düsseldorf begutachtet und genäht. Der taz liegen mehrere medizinische Protokolle und ein rechtsmedizinisches Gutachten der Ambulanz für Gewaltopfer in Düsseldorf vor: eine gebrochene Nase, Hämatome im Gesicht, eine Platzwunde unter dem linken Auge.
Die zuständige Pressestelle des Polizeipräsidiums in Aachen lässt einen Fragenkatalog der taz zum Fall der Familie A. und zum Einsatz in Lützerath trotz einer ausreichenden Bearbeitungszeit von mehr als 24 Stunden unbeantwortet.
Ein Anwalt rät der Familie, gründlich darüber nachzudenken, ob sich eine Anzeige gegen den Polizisten, der A. die Nase gebrochen hat, lohnt. „Solche Anzeigen führen meistens ins Leere“, sagt der Anwalt. Polizist*innen würden sich gegenseitig decken, Staatsanwaltschaften die Verfahren irgendwann einstellen. Die Erfolgschancen seien aus strukturellen Gründen eher gering. Familie A. überlegt derweil, wie es nun weitergeht. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagt A. Drei Tage nach seiner Odyssee in Lützerath ist er krankgeschrieben. Er sei wenig schmerzempfindlich, frage sich nun aber andauernd, warum die Polizeigewalt in Lützerath so eskaliert sei. Er frage sich nun jeden Tag: Das alles zum Schutz eines Privatgeländes von RWE?
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen











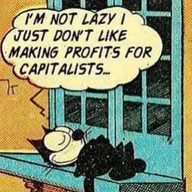
meistkommentiert
Teures Wohnen
Linke will Mieten erst stoppen, dann senken
Ein Rezept für den Abgang
Jens, uns schmeckt’s nicht!
Verzicht auf Dating
Die Liebe, die ich habe
Bericht über weltweiten Energieverbrauch
Fossile Energien dominieren – und wachsen weiter
Künstler über Krise der Demokratie
„Dass wir sie lächerlich finden, nützt der AfD“
Ein Jahr Pflicht für Tethered Caps
Befreit die Deckel!