Klima wandelt sich, Gesellschaft auch: Abschied von Sylt
Die Insel wird verschwinden, wenn der Meeresspiegel steigt. Das alte Sylt ist längst untergegangen, mit ihm das Aufstiegsversprechen der alten BRD.
D as Meer, das ist das Glück. Immer gewesen. Und ist es immer noch. Der Strand, das ist ein Ort des unhinterfragten Seins.
Empfohlener externer Inhalt
Aber was bedeutet mir Sylt, diese langgestreckte Insel mit ihrer Ausrichtung genau nach Westen? Es gibt viele Sylts. Ich muss zuerst an Sonnenuntergänge denken, nirgendwo sind sie so ergreifend wie hier. Ich denke an unschuldige Kinderspiele, aber auch an die Fragwürdigkeiten der Aufsteigergesellschaft und die lange unaufgearbeitete Nazizeit. Sylt steht für die Erfahrung, dass nichts so bleibt, wie es ist. Außer dem Meer –
Oh Mann, worauf habe ich mich hier eingelassen? Schreib einen Abschied von Sylt, haben die Kolleginnen gesagt. Der Meeresspiegel wird steigen, Sylt wird untergehen, über kurz oder lang. Du kennst Sylt. Schreib den Mythos auf. Und erzähl uns von der Realität. Kampen, Springer, Fun Beach Brandenburg, Faserland, Reetdachhäuser, „Ich will zurück nach Westerland“, Gosch.
Denk dich hinein, beschreib, was das bedeutet, ein Abschied von einem so aufgeladenen Ort. Und eins noch: Du darfst ruhig ich sagen. Schreib eine Ich-Geschichte. Wie oft bin ich hier gewesen? Nicht zu zählen. Hundertmal? In der Kindheit jede Ferien und viele Wochenenden. Bis heute mindestens einmal im Jahr, wenn es irgend geht.
Dass Sylt weggespült wird, gehörte von Anfang an dazu. Auch schon, als man vom Klimawandel noch nicht redete und vom steigenden Meeresspiegel nichts wusste, nahm sich die Nordsee in jedem Winter ein Stück der Steilküste bei Kampen und der Sandbank rings um Hörnum. Das wird sich verstärken. Jetzt steigen die Pegel. Die Gletscher schmelzen. Die Sturmfluten nehmen zu. Im Internet gibt es interaktive Karten, auf denen man nachvollziehen kann, wie weit Sylt bei welchem Wasserstand verschwunden sein wird, bei einem Meter höheren Meeresspiegel, bei zwei Meter, bei fünf Meter.
Ja doch, das ist mit Gefühlen verbunden. Es wird bei mir ein langer Abschied werden.
Ich stehe jetzt, in diesem Winter, in Westerland oben auf der Düne am Strandübergang Käpt’n-Christiansen-Straße neben dem Häuschen, an dem man während der Saison seine Kurkarte vorzeigen muss, und schaue hinab auf mein unter mir liegendes Kindheitsparadies.
Wie sich die Sandkörner im Haar anfühlen vom vielen Purzelbaumschlagen am Strand. Krebse, die zur Seite huschen. Muscheln in vielen Farben und Formen. Der angeschwemmte Seehund, der, verendend, kläglich rief. Wellen. Das Zittern im ganzen Körper, wenn man mal wieder zu lange im Wasser gewesen ist. Und der Sand in all seinen Zuständen. Der matschige Sand, wenn man nah am Wasser buddelt. Der Sand, wenn er ganz hell ist und fliegt, ausgetrocknet von der Sonne. Und der Sand nach einem Regenguss, wenn man kleine zusammenbackende Platten vorsichtig in die Hand nehmen kann.
Früheste Erinnerungen, immer wieder vom Gedächtnis reproduziert, längst fühlen sie sich so an wie ein vertrauter Stapel verblassender Polaroids.
Otto fällt mir ein, der Strandkorbwärter. Viel weiß ich gar nicht über ihn. Nur den Namen und dass er im Gefängnis gewesen war, was uns Kindern mächtig imponiert hat. Dass er auf eine bärbeißig-kameradschaftliche Art freundlich zu uns war und uns jedenfalls nicht gleich wegscheuchte wie viele andere Erwachsene zu der Zeit. Wie ein Seeräuberkapitän, ein bisschen auch wie der Vater von Pippi Langstrumpf mag er uns vorgekommen sein.
Es war um 1970 herum, ich war sechs, sieben Jahre alt, als ich also Strandkorbwärter werden wollte. Wir halfen Otto, schoben Strandkörbe hin und her, klappten sie auf und zu. Und als wir einmal morgens zum Strand kamen, fanden wir alle umgekippt vor. Hilflos lagen sie auf dem Bauch wie gestrandete Tümmler.
Große kindliche Aufregung! Mit der Ernsthaftigkeit von Grundschülern machten wir uns daran, die Strandkörbe wieder aufzurichten. Doch Otto wurde wütend, als wir ihm stolz das Ergebnis präsentierten. Ein Sturm war angekündigt. Die Strandkorbwärter hatten die Körbe mit voller Absicht umgekippt, um die Angriffsfläche des erwarteten Windes zu verringern. Jetzt mussten sie diese Arbeit noch einmal tun.
Kurz darauf waren die Ferien zu Ende.
Mir fällt aber auch gleich ein, wie ich vor dreieinhalb Jahren hier oben am Strandübergang stand, im Sommer 2018, und plötzlich so unglaublich wütend auf Sylt war, so ins Mark getroffen, wie man nur dann sein kann, wenn einem etwas wirklich identitär wichtig ist. Ich glaubte, mich an diesem Tag endgültig von dieser Insel und meinen verklärenden Kindheitserinnerungen an sie verabschieden zu müssen. Nicht wegen der Klimakatastrophe, sondern aus anderen Gründen.

Ich war 2018 auf den Tag genau so alt geworden wie mein Vater, als er gestorben ist, 54 Jahre, 8 Monate und 25 Tage. Und ich war aus diesem Anlass für eine Woche allein nach Sylt gefahren. Das hatte ich mir schön vorgestellt, emotional und tröstlich. Ich wollte viel am Strand spazieren gehen und über mein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater nachdenken, der noch am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hatte und die deutsche Niederlage nie adäquat verarbeitet hat. Doch meine Fahrt wurde zum Desaster.
Die Sylter sahen darüber weg
Die Katastrophe begann damit, dass sich das Grundgelenk meines linken großen Zehs stark entzündete. Anstatt in Gedanken die Wasserlinie abzuschreiten, konnte ich nur mühsam über den Sand humpeln, es war furchtbar. Und lächerlich außerdem. Ich wollte mich um letzte Dinge kümmern und war die ganze Zeit über nur mit meinem großen Zeh beschäftigt!
Hinzu kam, dass ich in einer hinteren Ecke der übersichtlichen Westerländer Stadtbibliothek das Buch „Der Fall Reinefarth“ des Schweizer Historikers Philipp Marti entdeckte und – am Strand spazieren ging ja nicht – gleich an Ort und Stelle verschlang.
Heinz Reinefarth ist ein hoher SS-Führer und ein schlimmer Kriegsverbrecher gewesen. Er war federführend bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstands 1944, von deutscher Seite ein unbarmherziges Gemetzel. Zehntausende Zivilisten verloren ihr Leben. Und dieser Schlächter konnte dann, nach dem Krieg nach Nordfriesland geflüchtet wie viele andere Nazis – Norddeutschland war bei Kriegsende noch nicht besetzt gewesen – Bürgermeister in Westerland werden und es bis 1963 auch bleiben. Reinefarth war hoch angesehen, eine, wie Philipp Marti schreibt, „Integrationsfigur“, während deren Amtszeit „die Grundlagen gelegt wurden für die Entwicklung der Gemeinde zu einem Kur- und Badeort von europäischer Ausstrahlung“.
Ich weiß noch, wie mir an diesem Tag schwindelig wurde, weil meine Kinderspiele als blonder, blauäugiger Junge am Strand jegliche Unschuld verloren hatten. Die Täuschungen und teilweise dreisten Lügen des bis zu seinem Tod 1979 uneinsichtigen Reinefarth, der sich sogar noch als Widerständler gegen das NS-Regime verkauft hat, sowie das Drüberhinwegsehen seitens der Sylter sind das eine. Das andere sind die Kontinuitäten im Denken, Fühlen, Sehen, die noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg nachwirkten, mindestens untergründig, im Weltverhältnis und Selbstverständnis.
Die „nordischen Menschen“, das waren für die Nazis die Vorzeigearier, und die Nordfriesen zählten dazu. Dem Kampf gegen die Nordsee, der Landgewinnung, der Schaffung von Lebensraum konnten sie einige Heroik abgewinnen. Sylt bauten die Nazis zur Festung aus, mit Bunkern in den Dünen (in denen ich noch gespielt habe), Geschützstellungen, Kasernen (die nach dem Krieg unter anderem als Landschulheime genutzt wurden) und einem großen Flughafen. Das alles hatte ich längst gewusst, aber ich hatte es nicht mit meinem Kindheitsparadies zusammengebracht. Jetzt tat ich es.
Was mich wieder beruhigte, war das Meer. Vorsichtig fuhr ich mit dem Fahrrad – das ging besser als laufen – auf der ehemaligen Strecke der Sylter Inselbahn durch die Dünen zum Ellbogen ganz an die Nordspitze Sylts. Hinter der letzten Bushaltestelle, an deren Bambus-Bar ich ein Eis aß, kann es da wirklich wild und einsam werden. Wegen der Strömung kann man nicht baden. Man begegnet nur ein paar einsamen Wanderern, Schafen, manchmal auch Seehunden und der Weite des Himmels. Ich blickte aufs Meer und konnte voll Dankbarkeit sagen, dass dies zumindest nicht mehr das Meer der Nazis ist.
Ich bin noch mit Bildern von schwerer See aufgewachsen. Friesische Genreszenen mit Menschen, die sich gegen den Wind stemmen. Emil Noldes wilde Ölbilder vom Meer mit den heroischen Brechern. Der vereinzelte Mensch, ausgeliefert den Stürmen. Es brauchte diese Krise meiner Syltverbundenheit, um zu begreifen, dass dieses kämpferische Verhältnis zum Meer für mich gar nicht stimmt. Das Meer habe ich nie als Gegner und Feind erfahren. Das verdanke ich wohl Sylt, den Ferien, den Wochenenden, den frühen Sommern. Der Schriftsteller Vladimir Nabokov sagt irgendwo, dass es der Sinn der Wiederbegegnung mit der eigenen Autobiografie sein könne, wiederkehrende Muster des Lebens auszumachen. Das ist bei mir offenbar so ein Muster: Das Meer ist gut.
Später bin ich oft im Herbst und im Winter auf Sylt gewesen und habe auch viele Stürme gesehen. Ich habe Kälte gespürt, die bis auf die Knochen drang. Nordseewogen habe ich gesehen, die weit über die Promenade von Westerland schlugen. Aber immer war etwas Belebendes, etwas Seligmachendes in diesen Momenten.
Die Geschichte Sylts ist eben auch die Geschichte einer Pazifizierung und Zivilisierung. Vom Heroisch-Militärischen ist die Insel längst zum Hedonistisch-Touristischen umcodiert worden. Ich zumindest kann dafür auch dankbar sein.
War Sylt Treffpunkt der Reichen, Mächtigen und Schönen?
Wenn es nicht gleich in die Klischees geht – Schickimicki, Sansibar, Sonnenuntergänge, Strandhafer –, werden über Sylt gerne zwei sehr unterschiedliche Geschichten erzählt.
Die erste handelt davon, wie die Insel in der alten Bundesrepublik zum Rückzugsort und Treffpunkt der Reichen, Mächtigen und Schönen geworden ist, wobei viele derjenigen Menschen, die sich übers Wochenende in Kampen und entlang der Wattseite trafen, auch die damals noch zentral in Hamburg angesiedelte Medienszene kontrollierten. Das sicherte dieser Geschichte dann auch gleich eine flächendeckende Verbreitung.
In Hamburg trugen sie ihre publizistischen Fehden aus, die Augsteins, Springers, Bissingers, Nannens, Jürgs, Raddatz, Böhmes, Theo Sommers, in Kampen verkumpelten sie sich wieder. Und beides zusammen bestärkte wohl ihre Weltwichtigkeit. In anderen Sparten, unter hanseatischen Privatbankiers etwa, oder unter den damals sogenannten Industriekapitänen aus dem Ruhrgebiet, wird das ähnlich gewesen sein.
Diese Geschichte rund um Kampen gehört zu den Fixpunkten einer Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik. Auch wer sich gar nicht sonderlich für die Upper Class interessierte, bekam über die Medien ganz nebenbei viele Details zugespült. So weiß ich zum Beispiel, dass die große freitägliche Redaktionskonferenz der Wochenzeitung Die Zeit um eine Stunde vorverlegt wurde, damit die Chefs am Freitagabend noch über die Autobahn nach Niebüll brettern und dort den letzten Autozug nach Sylt erreichen konnten.
Und ich weiß, dass Berthold Beitz, der legendenumwobene Generalbevöllmächtigte des einst mächtigen Krupp-Konzerns, in seinem Wochenend-Reetdachhaus in Kampen gerne Hummer mit Bratkartoffeln aß, während Arnd Krupp von Bohlen und Halbach, der ausgezahlte Familienerbe, in einer Bar zugedröhnt und mit zerlaufender Wimperntusche auf der Tanzfläche mit Platinherzchen um sich warf. Für den Feuilletonchef der Zeit, Fritz J. Raddatz, der diese Szene in seinem Buch „Mein Sylt“ kolportiert, sah der Erbe wie eine Figur in einem Fellini-Film aus.
Als Rückzugsort der Elite und zugleich als Hort der Dekadenz, so stellte sich die Öffentlichkeit Kampen damals vor. Das gehörte so selbstverständlich zur geistigen Innenausstattung der alten Bundesrepublik wie „Dalli Dalli“, der Ost-West-Konflikt, die Tarifverhandlungen, made in Germany und „Der internationale Frühschoppen“.
Ich weiß noch, dass in der Strandburg meines Großvaters, die – jeden Sommer wieder neu geschmückt mit Fisch- und Schiffsmosaiken aus Muscheln – eine Zeitlang fast so etwas wie eine allgemeine Attraktion von Sylt gewesen ist, plötzlich alle Erwachsenen nach oben zur Promenade blickten und sich gegenseitig anstießen. Der damals berühmte Industriellenerbe, Playboy und Fotograf Gunter Sachs, Mitglied des internationalen Jet Set von Davos, Saint-Tropez und wasweißichnochwo, lehnte sich über die Brüstung und schaute auf uns hinab. Was ich leider nicht mehr weiß, ist, ob die Schauspielerin Brigitte Bardot, mit der Sachs ein paar Jahre verheiratet war, in diesem Augenblick tatsächlich neben ihm stand oder ob ihr Fehlen von den Erwachsenen ringsum bedauert wurde; jedenfalls fiel bei uns im Strandkorb auch ihr Name.
Noch Christian Krachts Debütroman „Faserland“ lebt auf seinen ersten Seiten von diesem Hintergrund aus High Society und Sittengemälde. In dem Buch, längst ein Klassiker, lässt Kracht die traurigen Rich Kids von Kampen im Cabrio durch die Dünen fahren und Champagner trinken, die Kinder der Manager und ihrer Desperate Housewives, die sich diesen Ort erobert haben. Als Kontrast dazu beschreibt er die touristische Massenabfertigung mit Scampi und Fischbrötchen bei Gosch am Hafen von List.
Eine große Traurigkeit weht durch diese ersten Szenen des Romans, und das Traurigste daran ist, dass Sylt dabei nur als Kulisse herhalten muss für die mehr oder minder ernsten emotionalen Versuche und hohlen Sozialprestigespiele der Figuren – und dass der Erzähler das im Grunde auch weiß. Aber selbst durch diese Traurigkeit und allen Ennui hindurch weht der Sylter Sommer. Ich habe mir beim erneuten Lesen im vergangenen Jahr unwillkürlich denken müssen, der Ich-Erzähler hätte eben seine sogenannten Freunde einfach links liegen lassen und runter zum Strand gehen sollen. Da wäre er auf andere Gedanken gekommen (aber Christian Kracht hätte dann auch diesen Roman nicht schreiben können).
Die zweite Sylt-Geschichte erzählt davon, dass die Insel längst nicht mehr das ist, was sie einmal war. Diese Geschichte habe ich inzwischen in vielen Variationen gelesen oder gehört. Nachbarn in dem Vorort, in dem ich aufgewachsen bin, erzählten sie. Sylt war ihnen inzwischen zu voll geworden, und sie fuhren längst lieber nach Amrum oder nach Dänemark, wenn nicht sowieso gleich auf die Malediven. Oder, immer wieder sehr beliebt, enttäuschte Ex-Sylt-Fahrer schreiben die Geschichte als Hochglanzreportage in Magazinen. Manchem Sylt-Veteranen ist die Insel inzwischen zu neureich, allerdings ohne dabei über die eigene Rolle in ihrem Aufstieg nachzudenken.
Es gehört zum grundlegenden Selbstbetrug vieler Sozialaufsteiger, zu meinen, dass sie in dem Moment, in dem sie selbst oben angekommen sind, die sozialen Prozesse, die sie nach oben gebracht haben, einfach wieder abstellen können. Aber so läuft das eben nicht, erst recht nicht auf Sylt.
In unserer Gesellschaft mögen auf der einen Seite viele Menschen sozial abgehängt sein, auf der anderen Seite werden die Vermögenden immer vermögender und die Reichen immer reicher, sodass die Immobilienpreise auf Sylt immer weiter durch die Decke gehen und für Luxussanierungen und Neuerschließungen kein Ende abzusehen ist. Mit einer tragischen Pointe für die eingeborenen Sylter. Angesichts der Verteuerung des Wohnraums mussten viele von ihnen längst von der Insel wegziehen und sich ein Haus auf dem Festland suchen. Wie teilweise seltsam die Zustände mittlerweile sind, kann man tagtäglich erfahren, wenn man sich einmal früh an den Bahnhof von Westerland stellt. Die ersten Züge des Tages sind oft voll. Ihnen entsteigen aber keineswegs Massen von Urlaubern, sondern vor allem Bäckereiverkäuferinnen, Reinigungskräfte, die Angestellten der Kurverwaltung sowie all das Servicepersonal, das den Betrieb des Ortes am Laufen hält.
Wer auf Sylt arbeitet, kann es sich oft gar nicht mehr leisten, hier zu wohnen, und muss vom Festland aus pendeln. Das ist mühsam. Für geborene Sylter ist es auch eine Demütigung. Sie könnten sicher einiges über die Erschütterungen des Selbstbildes erzählen, wenn man einerseits wegen Menschen, die für ein Urlaubsdomizil locker 20.000 Euro pro Quadratmeter bezahlen können, von seiner Heimat wegziehen muss, und andererseits genau auch von solchen Menschen lebt. Auch ein Fall von Gentrifizierung.
Verluste habe ich, auf anderem Niveau natürlich, auch zu verkraften, wenn es um Sylt geht. Denn in Wirklichkeit ist es ungenau erzählt, wenn ich weiter oben schreibe, dass ich auf mein Kindheitsparadies hinuntersehen würde. Bei Licht besehen gibt es mein Kindheitsparadies nämlich gar nicht mehr, es ist längst untergegangen. Dafür brauchte es gar keine Sturmfluten, dafür reichten die Zeit, die Sandaufspülungen und der Bauboom.
Tatsächlich hat sich in dem halben Jahrhundert, das ich Sylt jetzt kenne, vieles verändert, das meiste eigentlich. Die Tetrapoden, mächtige vierfüßige Klötze aus Beton, in deren Höhlungen wir noch verstecken spielten: längst von dem zum Küstenschutz alljährlich aufgespülten Sand vergraben. Die Kurlichtspiele, das so großartige Kino im Fünfziger-Jahre-Stil, auf deren kleiner Bühne vor der Leinwand ich einmal die echte Pippi Langstrumpf sah, die Schauspielerin Inger Nilsson, die mit roter Perücke auf Promotour durch die Urlaubsbäder tingelte: abgerissen und durch ein Apartmenthaus ersetzt.

Das Freibad in Keitum, in dem ich schwimmen lernte: abgerissen. Das kleine Aquarium am Wellenbad mit den Seepferdchen und Seehundbecken, in dem ich Meeresbiologe werden wollte: abgerissen. Der Minigolfplatz auf dem Weg von unserer Wohnung zum Strand: geschlossen und längst mit einem Apartmenthaus bebaut. Die Wiese auf dem Weg zum Westerländer Südwäldchen, aus der die Lerchen aufstiegen und jubilierend ihre Lieder zwitscherten (ich habe sie noch im Ohr): auch längst bebaut.
Jetzt wuchten sie an die Promenade von Westerland auch noch diese hässliche Schutzmauer gegen die Sturmfluten und nehmen in Kauf, dass der kostbare Blick aufs Meer von Beton versperrt wird. Spätestens diese Maßnahme hat wirklich etwas Verzweifeltes.
Unsere Wohnung lag 300 Meter vom Strand entfernt, ich kann sie von meinem Standpunkt oben am Strandübergang sehen, sie lag ziemlich gleich hinter der Düne in einem langgestreckten zweistöckigen Apartmenthaus mit grünen Balkonen, neben dem kleinen Friedhof für unbekannte Seeleute. Wie abenteuerlich mir dieser früher oft barfuß und in Badehose zurückgelegte Weg von da aus zum Strand vorkam! Und wie kurz er mir jetzt vorkommt.
Zur Geschichte der Reichen, Mächtigen und Schönen kann ich mit meinem Familienhintergrund nicht beitragen, und zur Geschichte der eingeborenen Sylter Bevölkerung auch nicht, aber dafür zu einer möglichen dritten Geschichte, die nicht so oft erzählt wird, obwohl sie doch eigentlich die wirkmächtige Geschichte war und immer noch ist: die Geschichte der Aneignung der Insel durch soziale Aufsteiger, wie es meine Eltern waren.
Diese Geschichte führt weit zurück, bis in die Zeit, in der es für Sylt nach dem Zweiten Weltkrieg eine Richtungsentscheidung zu treffen galt. Sollte es seine Zukunft in der Entwicklung zum „Volksbad“ suchen, zu preiswerten Angeboten für die Breite der Bevölkerung also, wofür unter anderem die SPD-Fraktion Sylts votierte; oder in exklusiveren Angeboten für den gehobenen Bedarf samt zugehörigem dickeren Geldbeutel. Man entschied sich fürs Gehobene und konnte dabei an Seebad-Traditionen anknüpfen, die bis ins deutsche Kaiserreich zurückreichten.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.
Hatte doch Kaiser Wilhelm II. höchstselbst einmal im Hotel Miramar direkt am Meer genächtigt. Der Schriftsteller Thomas Mann hat Mitte der 1920er Jahre drei Sommer auf Sylt verbracht, in seiner Pension Haus Kliffende in Kampen eine berühmte Widmung hinterlassen („An diesem erschütternden Meere habe ich tief gelebt“) und sich zu großartigen Beschreibungen der Wellen vor Sylt inspirieren lassen, die er schlussendlich in das legendäre Schnee-Kapitel seines Romans „Der Zauberberg“ einbaute. Von „erfrischender Melancholie“ schreibt Mann dort und vom „Raubtiermäßigen der Wellen“.
Niemand Geringeres als der Philosoph Theodor W. Adorno ist in einem dieser Sommer, damals noch als heranwachsender Frankfurter Bürgers-Sohn, seinem Idol Thomas Mann am Strand heimlich hinterhergelaufen, was er ihm erst im Exil in Kalifornien, als es im Umfeld des „Doktor Faustus“-Romans zu einer Zusammenarbeit kam, gestand. Bevor die Nazis aus Sylt eine Festung machten, ist es also schon ein gutbürgerliches Bad gewesen.
Die Entscheidung fürs Gehobene führte 1949 zur Eröffnung der Sylter Spielbank, die Ende 2021 ihren Betrieb einstellen musste, und zu noblen Hotels, zu gastronomischen Angeboten und Nachtclubs.
Doch das Exklusive ließ sich nicht vollständig halten. Die zu Geld gekommene Mittelklasse drängte auch nach Sylt, und die Insel ist dann doch zu einer Art Volksbad geworden, dem des gehobenen Teils der nivellierten Mittelklassengesellschaft, von denen also, die meinten, „es geschafft zu haben“ – mit Bildungsaufstieg, Kleinfamilie, Vierzigstundenwoche und all dem. Unter den Gemeinden Sylts kam es zur Arbeitsteilung mitsamt den dazugehörigen feinen Unterschieden und handfesten Klassenschranken. Kampen mit seinen Reetdachhäusern und manche Bereiche der Wattseite mit ihren friesischen Anwesen behielten den Ruf der Exklusivität. In Wenningstedt und Westerland sowie von da ab südlich wurden dagegen Apartmenthäuser gebaut für Leute wie uns.
Spätestens mit dem Bau des neuen Kurzentrums in Westerland direkt hinter der Kurmuschel mitsamt seinen zwölf Etagen und mehreren hundert Wohnungen, das vielen Syltern bis heute ein Dorn im Auge ist, war Ende die sechziger Jahre die Exklusivität dahin.
Wie es zum Kauf unserer Wohnung kam, hat mir meine Mutter immer wieder erzählt, es muss zu den einschneidenden Momenten ihres Lebens zählen. Ich selbst spielte dabei auch eine Rolle, als Vierjähriger, der es mit den Bronchien hatte. Der Kinderarzt riet zu Reizklima und Meeresluft. Und so mieteten wir uns im Sommer mitsamt Großvater in einer Pension in Westerland ein. Auf dem Weg zum Strand kamen meine Eltern an dem Neubau des Apartmenthauses vorbei, eine Eckwohnung im Hochparterre war noch frei.
Ich sehe diesen Moment meiner Eltern manchmal im geistigen Auge vor mir. Überlebende beide. Mein Vater auch Täter, Ende vierzig, Arbeiterkind, Kriegsteilnehmer, auch Kriegsversehrter – den linken Unterarm gleich im Polenfeldzug verloren, den Rest des Arms im Endkampf bei Dresden –, der die nationalistischen Prägungen weder hinter sich lassen konnte noch wollte. Er hatte schon drei Ehen hinter sich, hatte sich zum gutverdienenden Rechtsanwalt und Notar hochgearbeitet und jetzt noch einmal den Wind eines neuen Anfangs unter den Flügeln (die Leukämie-Diagnose kam dann kurz darauf).
Meine Mutter, 21 Jahre jünger, Flüchtlingskind aus Kolberg, Vater unbekannt, Mutter seit der Flucht mit den Nerven zerrüttet, nun selbst Hausfrau und Mutter, und zum ersten Mal in ihrem Leben mit dem Gefühl, sicheren Grund unter den Füßen zu haben.
Eigentlich konnten sie sich die Wohnung gar nicht leisten, der Zeitpunkt war ungünstig. Das Einfamilienhaus im Vorort von Kiel war gerade gekauft und nach eigenen Wünschen umgebaut worden, es gab Verbindlichkeiten. Aber die Mischung aus „was für die Kinder tun“ und Steigerung des eigenen Sozialprestiges durch eine Adresse auf Sylt war zu verführerisch. Ich weiß noch, wie stolz ich als Kind immer auf die NF-Kennzeichen (für Nordfriesland) an den Autos meiner Eltern war, die man nur bekam, wenn man eine Meldeadresse dort hatte. Diesen Stolz haben sie mir vermittelt.
Knapp fünfzig Quadratmeter hatte unsere Wohnung. Wohnzimmer mit Kochnische und Balkon – ein Balkon ist wichtig auf Sylt. Bad. Zwei kleine Schlafzimmer. In dem einen haben wir Kinder übernachtet, manchmal sechs Stück an der Zahl, mitsamt Cousinen und der Tochter unserer Haushälterin. Wir schliefen in dem Zehn-Quadratmeter-Raum in drei Etagenbetten, die so über Eck gestellt waren, dass man von Bett zu Bett springen und Seeräuberschiff spielen konnte. Unsere Ferien auf Sylt glichen privaten Kinderlandverschickungen. Und unsere Eltern waren oft gar nicht dabei, sie blieben in Kiel, arbeiten. Auf uns passte unser Großvater auf oder unsere Haushälterin.
Wenn ich manche Erinnerungen mit jüngeren Eindrücken übereinanderlege, kann ich wie im Zeitraffer gesellschaftliche Entwicklungen ablaufen lassen.
Damals baute man noch Strandburgen. Der gesamte Strand vor Westerland war parzelliert in kleine, von aufgeschichteten Sandwällen umgebene Fürstentümer, in deren Mitte jeweils ein Strandkorb thronte. In diesen Strandkörben saßen die Erwachsenen und wollten ihre Ruhe haben. Wir Kinder tobten durch die schmalen Gänge zwischen den Sandburgen hindurch runter ans Wasser, das war unser Abenteuerspielplatz.
Das Freizeitverhalten war noch ganz anders als heute. Den Fun-Fitness-Mix aus Yoga am Strand, Aperol-Sundowner mit Meeresblick und Windsurfingkurs gab es noch nicht. Und das freie WLAN am Strand, das heutzutage auch ein Homeoffice im Strandkorb ermöglichen würde, natürlich erst recht nicht. Damals brachte man sich noch Stullen und in den Urlaubswohnungen selbst gekochten Milchreis mit an den Strand. Heute snackt man zwischendurch Crepes mit Schafskäse, Rucola und Honigsenf. Damals wäre niemand auf die Idee gekommen, die Promenade entlangzujoggen. Heute dominiert auch in den Restaurants die Funktionskleidung.
Es mag auch sein, dass sich meine Eltern als Sozialaufsteiger inmitten der auf Sylt ausgestellten feineren Manieren und Genüsse latent ein wenig unwohl fühlten. Wenn man heute dabei zusieht, mit welcher Selbstverständlichkeit die Urlauber ihre Krabbenbrötchen mit Cocktailsoße verhunzen (mir wirklich ein Rätsel) und in lauen Sommernächten ihre Cocktails mit Strohhalm schlürfen, hat man nicht mehr den Eindruck, dass Habitusfragen beim Freizeitverhalten eine Rolle spielen.
Es ist das Meer, das Sylt ausmacht
Alte Zeiten. Unsere Wohnung in der Käpt’n-Christiansen-Straße ist längst verkauft, und ich habe seitdem in vielen unterschiedlichen Unterkünften auf Sylt gewohnt, manchmal mit der Familie für zwei, drei Wochen im Sommer, manchmal auch auf ein paar Tage zum Luftschnappen allein. Einmal waren wir auf Einladung in einem dieser nachgebauten friesischen Bauernhof-Anwesen, für die man – ich habe auf Immoscout nachgesehen – inzwischen zweistellige Millionenbeträge zahlen müsste; so etwas imponiert einem schon.
Mit etwas Glück, und wenn man früh dran ist, kann man auch immer noch schöne, eingesessene Urlaubswohnungen mit Gartenmitbenutzung mieten, ein nachmittäglicher Tee mit Kuchen und dann noch mal ins Meer, das hat schon was. Mich rühren aber auch die 28-Quadratmeter-Miniwohnungen, auch sie immerhin mit Balkon, die oft leicht hilflos mit maritimem Flair versehen sind: einige Muscheln und kleiner Leuchtturm auf der Fensterbank, Fotografien von am Sand auslaufenden Wellen an den Wänden.
Ich stehe weiterhin hier oben am Strandübergang und zögere. Die Wintersonne kämpft sich durch die ziehenden Wolken. Möwen hängen wie an Fäden am Himmel. Die Sturmfluten werden kommen, doch noch gibt es die Insel. Was fange ich jetzt mit ihr an?
Ich könnte mit dem Fahrrad zur Kirche nach Keitum fahren und das Grab von Rudolf Augstein suchen, wie ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Ich könnte auch am Rantum-Becken entlanglaufen, an dem man auch im Winter seltsame Vögel beobachten kann. Oder ich könnte – man hat immer Hunger auf Sylt – einen Fischteller mit Bratkartoffeln essen, nicht bei Gosch, sondern im Stammhaus des Fischgeschäfts Bluhm in der Neuen Straße hinter den Aquarien, in denen immer noch die Hummer mit zusammengebundenen Scheren auf Kunden warten.
Ich lasse das alles und gehe hinunter zum Meer. Es ist schlussendlich dann doch das Meer, das Sylt ausmacht. Wenn man sehr nah herangeht, bis an den Bereich, in dem die Wellen am Strand auslaufen, ist man ganz umgeben von seinen Geräuschen. Dem Knallen, Saugen und Rauschen der Wellen. Dem Zerplatzen der Luftbläschen, wenn die auslaufende Welle im Strand versickert. Dem Schaben und Rascheln und Schieben der vom Wasser bewegten Sandkörner.
Das Meer in diesem Bereich, am Übergang vom Wasser zum Land, ist ganz Gegenwart. Und zugleich bekommt man ein Gefühl dafür, wie jede Geschichte über Sylt andere Geschichten überdeckt, so wie die Wellen sich manchmal übereinanderlegen.
Für mich sind die oft gar nicht sonderlich hohen, aber kraftvollen Wellen vor Sylt immer der Maßstab geblieben, das Urmeter, mit dem ich alle anderen Wellen der Welt verglichen habe. Die Wellen der Ostsee: irgendwie noch nicht ausgewachsen. Die Brecher an der Atlantikküste: eher sportiv interessant. Die Wogen des Pazifiks: zu groß und weit, im Maßstab verrutscht. Das sanfte Auf und Ab der Andamanensee: auch nicht schlecht, anders meditativ.
Habe ich oben geschrieben, dass sich das Meer nie ändert? Das stimmt nicht. Das Meer ändert sich ständig. Es ist jeden Tag ein anderes Meer. Und es stimmt auch nicht, dass das Meer bleiben wird, wenn Sylt verschwunden ist. Es wird nicht mehr dieses Meer sein. Das Meer vor Sylt wird ohne Sylt auch nicht mehr da sein.
Wenn man diesen Gedanken richtig an sich heran lässt, ist er kaum auszuhalten.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen













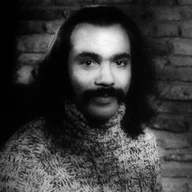






meistkommentiert
Günstiger und umweltfreundlicher
Forscher zerpflücken E-Auto-Mythen
Krieg im Gazastreifen
Netanjahu fordert Vertreibung der Palästinenser
Nach tödlichen Polizeischüssen
Wieder einmal Notwehr
Attentat an israelischen Diplomaten
Mörderische Selbstgerechtigkeit
Probleme bei der Deutschen Bahn
Wie absurde Geldflüsse den Ausbau der Schiene bremsen
NRW-Grüne Zeybek über Wohnungsbau
„Es muss einfach leichter werden, mehr zu bauen“