Waffengewalt in den USA: Krieg im Klassenraum
In den USA stecken Eltern ihren Kindern Schutz-Schildkröten in den Rucksack. Eine eigene surreale Waffenindustrie soll vor Amokläufern schützen.

Die lachende Schildkröte „Tank the turtle“ schaut hinter einem Schild hervor. Es ist nicht ihr eigener Panzer, denn ihn ziert die Flagge der USA, links die Sterne, rechts die weiß-roten Streifen. Der Eindruck mag täuschen, doch es handelt sich nicht um ein Spielzeug.
Im Gegenteil, die 25 mal 30 Zentimeter große Platte aus Polyethylen soll das Leben von Kindern und Jugendlichen schützen. Laut Angaben stoppt die Platte alle Stichwaffen und Kaliber bis hin zu den Kugeln einer Kalaschnikow.
Für den Schulalltag können Eltern sie ihren Kindern ganz simpel in den Rucksack stecken, schon läuft der Nachwuchs gepanzert umher. Das soll sie vor Amokläufen schützen, denn die Opfer der „school shootings“ sind in erster Linie Kinder und Jugendliche. Es ist surreal, was weite Teile der US-Gesellschaft alles unternehmen, bevor sie ihren geheiligten zweiten Zusatzartikel – das Recht auf Waffenbesitz – abschaffen oder auch nur regulieren.
Militaristische Industrie zum Schutz vor Waffengewalt
Das Gun Violence Archive zählte allein 2024 fast eintausend Fälle von Schusswaffeneinsatz auf Schulgelände. Jeder davon hätte einen oder mehrere Tote nach sich ziehen können. Insgesamt kosteten Amokläufe an US-Schulen letztes Jahr 69 Menschen das Leben, 194 wurden verletzt.
Aus dieser Waffengewalt hat sich eine neue, perfide wie opportunistische Industrie herausgebildet. Aus dem Leid an Kindern wird Kapital geschlagen. So beginnt der Kaufpreis von Schutzplatten für den Kinderrucksack bei rund 150 US-Dollar mit reichlich Luft nach oben. Und damit nicht genug, denn inzwischen sollen Kinder auch mit schusssicheren Mäppchen, Tablet-Hüllen oder direkt einer Ganzkörperweste geschützt werden.
Die Produkte tragen martialische Titel wie „Defender“, „Ninja“ und „BulletBlocker“. Manche von ihnen – wie die „Tank the turtle“-Schutzplatte – haben eine kindergerechte, verspielte Optik, um von ihrer eigentlichen Funktion abzulenken. Für viele Hersteller:innen ist es darüber hinaus wichtig zu erwähnen, dass es sich bei ihnen um ein Geschäft in den Händen von Veteranen handelt.
Auch Accessoires für Lehrkräfte sollen angeblich dabei helfen, Opfer bei Amokläufen zu verhindern. Stürmt jemand eine Schule, kann zum Beispiel die mit Rollen ausgestattete und kugelsichere Tafel bewegt werden, damit sie die Tür oder den Gang blockiert. Auch schusssichere Tische sollen umgedreht und als Schild genutzt werden.
Einige Schulen, besonders die weiterführenden High Schools, setzen Metalldetektoren ein, um eine Mitnahme von Schusswaffen zu verhindern. Was an Krieg erinnert, ist noch immer ein Klassenraum.
Empfohlener externer Inhalt
Video: Krieg im Klassenraum

Der Waffenbesitz ist ein hohes Gut – und bleibt es wohl auch
Es wirkt surreal, dass aus den Amokläufen eine eigene Industrie entstanden ist. Andererseits hatte das Kapital noch nie eine Moral, ganz gleich, ob es um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene geht. Würde man ernsthaft Opfer verhindern wollen, ist eine Änderung oder Abschaffung des zweiten Zusatzartikels dringend notwendig. In ihm heißt es: „Da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden.“
Doch dieses Gesetz stammt von 1791, als die USA ihre Unabhängigkeit gegenüber Großbritannien noch nicht vollends gesichert hatten. Heute, über zwei Jahrhunderte später, ist es ein antiquierter Zusatz, der primär von Republikaner:innen verteidigt wird. Aber eben nicht nur: Auch Kamala Harris und ihr Vizekandidat Tim Walz sprachen im letztjährigen Präsidentschaftswahlkampf davon, dass sie Waffen besitzen. Während eines Interviews mit Oprah Winfrey im September sprach Harris sogar davon, dass sie einen Einbrecher sofort erschießen würde.
Es ist unwahrscheinlich – um nicht zu sagen unmöglich –, dass sich die Waffengesetze unter einer trumpschen Regentschaft zum Besseren ändern. Stattdessen sorgt die republikanische Regierung explizit für den Rückbau von Programmen zur Prävention von Waffengewalt und will den Zugang zu Munition erleichtern. Auch das „concealed carry“, das verdeckte Tragen einer Waffe, soll vielerorts ermöglicht werden, sogar bei Lehrkräften. In Staaten wie Florida, Arkansas, Illinois, Arizona und Texas ist das bereits erlaubt – ohne jedwede Lizenz. Auch in Mississippi, Alabama und Louisiana kann man die Waffen offen tragen, obwohl gerade diese drei Staaten die proportional die meisten Toten durch Schusswaffengewalt haben.
Die Fetischisierung von Schusswaffen kostet Leben
Der Konflikt des Waffenrechts ist kein neuer und längst ein fester Bestandteil der alltäglichen US-Politik. Während die demokratische Seite stärkere Regulation, Hintergrund-Checks und mehr Prävention fordert, argumentiert das republikanische Lager mit der Verfassung, den individuellen Rechten und seinem Lieblingsargument – der Freiheit – dagegen. Was bleibt, ist ein juristisch vages Feld, das von den jeweiligen Staaten meist selbst bestimmt wird.
Die Leidtragenden sind letztendlich Kinder, wie auch beim Amoklauf an der Apalachee High School im September 2024. Dabei starben zwei Kinder und zwei Lehrkräfte, neun weitere wurden verletzt. Schutzplatten, Tafeln, Mäppchen und sonstige angeblich kugelsichere und lebensrettende Ausrüstung hat kein Leben geschützt. Der 14-jährige Schütze soll die Tatwaffe, ein halbautomatisches Sturmgewehr, als Weihnachtsgeschenk von seinem Vater bekommen haben.
Dass eine tödliche Waffe in den USA als Geschenk für ein Kind gilt, zeigt das tief verwurzelte Problem des Landes. Und im Ernstfall bieten Platten und Rucksäcke den Kindern keinen Schutz vor jemandem, der sie töten will. Doch Schusswaffen sind längst beständiger Teil der US-amerikanischen DNA und für viele zu einem großen Fetisch geworden. Einer, in dem eine vermeintliche Freiheit und Sicherheit gesehen wird – auch wenn sie die eigenen Kinder das Leben kostet.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
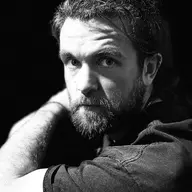








meistkommentiert