Verdrängung in Berlin-Kreuzberg: Linke Vermieter
Ausgerechnet eine linke Eigentümergemeinschaft plant den Verkauf ihres Mietshauses an einen Investor. Die Mieter*innen protestieren.
Yilmaz arbeitete als Pressefotograf, auch für die taz. Es liegen Speicherkarten und Kameras herum, aus dem Fenster schaut man auf einen ruhigen Hinterhof mit Laubbäumen. Yilmaz wohnt seit 1996 dort, sein Mietvertrag wurde damals in aller Freundschaft und nur mündlich abgeschlossen.
Yilmaz kennt seine Vermieter*innen schon lange persönlich. Sie sind ebenfalls Journalist*innen, die teilweise für die taz und andere eher linke Publikationen geschrieben und gearbeitet haben. Lange hätten die Eigentümer*innen teilweise selbst vor Ort gewohnt, sagt Yilmaz. Der Umgang miteinander sei in dem gepflegten Altbau mit 21 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten stets freundschaftlich und gut gewesen, sagt Yilmaz. Eigentlich Vermieter, wie man sie sich wünscht.
Heute aber machen sich viele Bewohner*innen Sorgen, weil die Eigentümer*innen das Haus verkaufen wollen – nicht an eine gemeinwohlorientierte Genossenschaft oder ein kommunales Wohnungsunternehmen, sondern offenbar an einen privaten Investor. Erstmals hätten die Mieter*innen im Mai von einem geplanten Verkauf erfahren, seither würden Interessenten durch das Haus geführt.
Die Vermieter*innen stammen aus demselben Kreuzberger Milieu wie Yilmaz und haben in der Vergangenheit recht deutlich Missstände der Berliner Mietenpolitik kommentiert. Organisiert haben sich die acht Eigentümer*innen in einer GbR, zu der namhafte, teilweise preisgekrönte Journalist*innen gehören, darunter auch ehemalige taz-Autor*innen, sowie ein Mitglied im Kuratorium der taz Panter Stiftung. Mehrere Anfragen der taz an Eigentümer*innen blieben unbeantwortet, ein direktes Gespräch wurde abgewimmelt.
Ähnlich ging es seither den Bewohner*innen. Besorgte Nachfragen wurden abgeblockt, erzählt Yilmaz: „Sie schrieben uns, dass sie mit uns nicht darüber zu reden brauchen.“ Besonders ärgere ihn das, weil man sich schon so lange kenne und sich die lange freundschaftlich verbundenen Vermieter*innen nun so verhalten wie ein normaler Investor – „das finde ich ein bisschen arrogant und abgehoben“, sagt Yilmaz.
Er und viele andere Mieter*innen fordern den Verkauf an ein gemeinwohlorientiertes Wohnungsunternehmen oder eine Genossenschaft, befürchten aber weiter, höchstbietend an einen Spekulanten verkauft zu werden, der die Immobilie aufwerten und Mieter*innen verdrängen könnte. „Unsere Schreckensvision ist, dass wir bei einem internationalen Investor landen, der zuallererst wohl die Gewerbemieter mit extremen Mieterhöhungen verdrängen würde“, sagt Yilmaz. Dann kämen sicher auch die Mieter dran.
Kritikwürdig erscheint der Verkauf auch, weil die Eigentümer*innen das 1993 für 1,2 Millionen Mark gekaufte Haus mit öffentlichen Fördermitteln saniert haben. Eine kürzlich veröffentlichte Anfrage der Grünen-Abgeordneten Katrin Schmidberger bestätigt, dass die Sanierung mit knapp 3,5 Millionen DM „für besondere wohnungspolitische Projekte“ gefördert wurde.
Die Eigentümer*innen profitierten dabei von der sogenannten Selbsthilfeförderung des damaligen Senats. Auch Mieter*innen sollten dabei für die Instandsetzungen eingespannt werden – im Gegenzug für günstige Mietkonditionen. Die beantragten Hilfen wurden schließlich von der damals zuständigen Erneuerungskommission abgesegnet – „unter der selbstverständlichen Maßgabe, dass keiner der Wohn- und Gewerbemieter durch die Sanierung verdrängt wird“, wie es in einem damaligen Fachmagazin hieß.
Jetzt weht ein anderer Wind
Die Förderung lief bis zum Februar 1997. In der Folge gab es bis 2017 eine Sozialbindung. Seitdem diese jedoch ausgelaufen ist, weht ein anderer Wind, sagt Yilmaz. Mit der Hausverwaltung wurde eine GmbH beauftragt. Seitdem gebe es im ganzen Haus Mieterhöhungen – „unausgesprochene Staffelmietverträge bis zur Grenze des Erlaubten“, wie Yilmaz sagt.
Am meisten Sorgen macht Yilmaz und anderen Mieter*innen jedoch der drohende Verkauf. Mietrechtlich schutzlos sind vor allem die zwei Gewerbemieter im Haus, das Modegeschäft Luzifer sowie ein Geschäft für Vintage-Möbel. Beim Letzteren läuft der Mietvertrag im nächsten Jahr aus, wie der Inhaber der taz sagte.
Nach einem Treffen von 10 Mieter*innen mit dem Arbeitskreis Gemeinwohl des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, der dabei hilft, öffentlichen Wohnraum zu schaffen, schrieben 18 Bewohner*innen einen gemeinsamen Brief an die Vermieter*innen mit der Bitte, sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst zu sein.
Die Antwort der Vermieter: Man wisse zwar um die schwierige Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt, aber „ohne dass alle Eigentümer zustimmen“, könne man nicht an eine Genossenschaft oder Wohnbaugesellschaft verkaufen. Darauf hätten sich die acht Eigentümer*innen nicht einigen können.
„Deswegen können wir Ihnen an dieser Stelle nur versichern, dass wir bemüht sind, einen Käufer zu finden, der das Haus langfristig hält und pflegt“, schreibt die Eigentümergemeinschaft Anfang August in einem Brief, der der taz vorliegt. Zudem verweist sie darauf, dass die Mietverträge mit allen Rechten und Pflichten beim Verkauf ihre Gültigkeit behielten. Sie würden potenzielle Käufer über Mietspiegel, Kappungsgrenze und Milieuschutzgebiet in Kenntnis setzen.
Nach der Ablehnung eines gemeinwohlorientierten Verkaufs und dem fortgesetzten Schweigen zu potenziellen Käufern versuchten die Mieter*innen, diverse Kommunal- und Mietenpolitiker*innen einzuschalten. Die glaubten zunächst, dass man in diesem Fall doch sicher etwas im Dialog erreichen könne.
Keine Antwort von den Eigentümer*innen
Doch Fehlanzeige: Mehrere Politiker*innen, die sich an die Eigentümergemeinschaft wendeten, warten bis heute auf eine Antwort: Bezirksstadtrat Florian Schmidt, Canan Bayram (beide Grüne) und Pascal Meiser (Linke). Cansel Kiziltepe und Sevim Aydin (beide SPD) bekamen zwar immerhin eine Antwort, in der hieß es jedoch, dass sich die Vermieter*innen nicht auf ein Gespräch einlassen und die Mieter*innen nicht in den Verkaufsprozess einbinden wollen, wie Aydin der taz mitteilte.
Katrin Schmidberger, grüne Wohnungspolitikerin, findet die Funkstille seitens der Vermieter*innen besonders enttäuschend, wie sie der taz sagt: „Weil wohl einige Eigentümer*innen selbst journalistisch tätig sind und zum Thema Mieten gearbeitet haben, müsste ihnen klar sein, dass ein renditeorientierter Käufer durchaus Methoden findet, um den Grundsatz ‚Kauf bricht Miete nicht‘ faktisch auszuhebeln.“
Allein schon eine Aufwertung des Hauses könne zur Verdrängung der Altmieter*innen führen – „wie leider schon in anderen Fällen oft erlebt“. Das Haus in kommunale Hand zu bringen, sei nicht nur aufgrund der Sozialstruktur der Bewohner*innen wichtig, „sondern auch, weil das Haus mit öffentlichen Geldern instandgesetzt und modernisiert wurde“, so Schmidberger.
Auch der grüne Bezirksstadtrat Florian Schmidt sagt: „Es ist schade, wenn Menschen, die gerade nicht als Spekulanten bekannt sind, nicht einmal ins Gespräch kommen wollen.“ Er habe Genossenschaften an der Hand, die für Sondierungen bereitstünden – auch was den Kaufpreis angehe, sagt Schmidt, „das Minimum in Demokratie, Wirtschaft und Politik ist, dass man miteinander spricht“.
Die Eigentümer*innen sollten sich fragen, zu welchem Preis sie die Immobilie gekauft haben und wie viel Gewinn man noch erzielen wolle, sagt Schmidt: „Ich habe immer noch Hoffnung, dass etwas passiert.“ Auch Bayram fordert die Eigentümer*innen auf, einen gemeinwohlorientierten Käufer zu suchen.
Noch etwas schärfer wird Pascal Meiser, Kreuzberger Bundestagsabgeordneter für die Linke: „Das besonders Perfide an dem aktuellen Fall ist, dass der Eigentümer kein anonymer Luxemburger Fonds ist. Es handelt sich um eine private Eigentümergesellschaft, deren Mitglieder in der Vergangenheit sonst zum Teil selbst den Ausverkauf unserer Stadt scharf kritisiert haben, sich bis jetzt weigern, das Haus an einen gemeinwohlorientierten Erwerber zu verkaufen. Ich bin mir sicher, dass die Reputation der Eigentümer nachhaltig beschädigt wird, sollten sie an ihrer unnachgiebigen Haltung festhalten“, so Meiser zur taz. Auch fordert er wie die Grünen-Politiker die umgehende Wiederherstellung des Vorkaufsrechts auf Bundesebene – „im besten Fall könnte die Oranienstraße 169 noch gerettet werden“.
Obwohl das Gebäudeensemble aus der Gründerzeit im Milieuschutzgebiet liegt, ist der Bezirk machtlos. Das dort geltende kommunale Vorkaufsrecht ist derzeit nach einem Rechtsstreit ausgehebelt. Trotz Bundesratsinitiativen unter anderem von Berlin wurde es seither nicht reformiert, weil sich die FDP in der Ampelkoalition bisher erfolgreich dagegen sperrt.
Die Sorgen der Mieter*innen wachsen
Weil auch die Politiker*innen keine Antworten bekamen, wachsen bei den Mieter*innen weiter die Sorgen. Derzeit ist unklar, wann und an wen das Haus verkauft wird. Einige von ihnen beteiligten sich nicht zuletzt deswegen am Jahrestag der Verdrängung der Buchhandlung von Kisch & Co. an einer Kundgebung in der Oranienstraße.
Eine der Mieter*innen las dabei auch einen mietenpolitischen Kommentar von Brigitte Fehrle vor, die früher auch in der taz tätig und danach lange Chefredakteurin der Berliner Zeitung war. Sie kommentierte zur Wohnungspolitik scharf. So wie am 16. 11. 2005, als der rot-rote Berliner Senat in großem Stil öffentlichen Wohnraum an die Privatwirtschaft vertickte.
Der Text könnte auch heute von uns stammen, sagte die Mieterin und zitierte ihre Vermieterin: „Das Land Berlin hat seinen Besitz allen Warnungen zum Trotz zur internationalen Spekulation freigegeben … Keiner hat das Land gezwungen, an Großinvestoren zu verkaufen. Der rot-rote Senat hat nur aufs Geld geschaut, statt zu überlegen, wozu ihn sein Eigentum verpflichtet. Dazu hätte es zunächst einmal gehört, festzustellen, wem die Wohnungen eigentlich gehören. Nicht juristisch. Sondern moralisch (…) Viel Arbeit wurde investiert, um eine soziale und ethnische Mischung auszubalancieren – oder noch besser im Lot zu halten. Das muss bewahrt werden. In den Wohnungen steckt mehr als nur materieller Wert. Sie und ihre jeweiligen Mieter sind geronnene Gesellschaftspolitik. Die ist gar nicht zu bezahlen. Sie gehört nicht in Investorenhand. Sie gehört uns allen und muss von allen gepflegt werden. Nicht vom Staat. Von möglichst vielen Einzelnen.“
Hinweis: In der ursprünglichen Version des Artikels hieß es, dass keiner der Politiker*innen eine Antwort durch die Eigentümergemeinschaft erhalten habe. Die SPD-Politiker*innen Cansel Kiziltepe und Sevim Aydin haben allerdings eine Antwort bekommen, auch wenn diese für die Mieter*innen ebenso negativ ausfiel. Wir haben das entsprechend korrigiert.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen













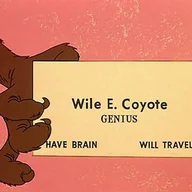
meistkommentiert
Boykotte gegen Israel
Gut gemeint, aber falsch
USA errichten Abschiebegefängnis
Wer flieht, wird gefressen
Bundestagskontrollgremien ohne Linke
Linke wirft Union Demokratiegefährdung vor
Café in Gaza-Stadt
„Überall um mich herum lagen Leichen“
Verhältnis der Deutschen zu Israel
Streit bei „Zeit“ über Löschung der Maxim-Biller-Kolumne
Hungerstreik in Ungarn
Maja T. wird in Haftkrankenhaus verlegt