Studie zum weltweiten Insektensterben: Kurz vor Kollaps
Wissenschaftler beobachten bei Insekten das „größte Aussterben seit der Perm- und Kreidezeit“. Das hat Auswirkungen auf das Ökosystem.
Die Artenvielfalt bei Insekten ist weltweit bedroht, zeigt eine Studie der Fachzeitschrift Biological Conservation. Das Sterben habe so dramatische Ausmaße erreicht, dass 40 Prozent aller Insektenarten in den nächsten Jahrzehnten aussterben könnten. Ein Drittel aller untersuchten Arten sei akut gefährdet.
Für die Untersuchung haben die Wissenschaftler Francisco Sánchez-Bayo und Kris Wyckhuys 73 Berichte über Insektensterben auf der ganzen Welt gesichtet. Auf dem Land seien vor allem Schmetterlinge und Hautflügler wie Bienen, Wespen und Mistkäfer betroffen, an Gewässern vermehrt Libellen und Fliegenarten bedroht.
„Da der Rückgang die Mehrheit aller Insektenarten betrifft“, schreiben die Forscher, „ist es offensichtlich, dass wir global gesehen das größte Aussterben seit der Perm- und Kreidezeit beobachten“. Weil Insekten die am häufigsten vorkommende und artenreichste Tiergruppe seien und entscheidende Funktionen in Ökosystemen hätten, „kann diese Entwicklung nicht ignoriert werden“, so das Fazit ihrer Forschung. „Schnelles, entschlossenes Handeln ist notwendig, um einen katastrophalen Zusammenbruch der Ökosysteme abzuwenden.“
Vier Ursachen hat das Massensterben nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen: erstens der Verlust von Lebensräumen durch intensive Landwirtschaft und Verstädterung, zweitens Verschmutzung durch Pestizide und Düngemittel, drittens Krankheitserreger und fremde Arten und viertens der Klimawandel.
Auswirkungen auf das ganze Ökosystem
Vor allem Letzteres führe zum Artenverlust in tropischen Regionen, wobei nur eine Minderheit der Arten in kälteren Weltgegenden von der globalen Erwärmung betroffen sei.
In den letzten drei Jahrzehnten hat es laut den Daten jährlich einen durchschnittlichen Verlust von 2,5 Prozent an Insekten gegeben. „In 10 Jahren wird es ein Viertel weniger Insektenbestände geben, in 50 Jahren nur noch die Hälfte und in 100 Jahren wird es keine mehr geben“, sagte Sánchez-Bayo dem britischen Guardian am Sonntag.
Artenverlust hat laut der Studie Auswirkungen auf ganze Ökosysteme, weil Insekten die Grundnahrung vieler Wirbeltiere wie Vögel, Mäuse, Igel und Eidechsen seien. Selbst wenn manche der verschwindenden Insektenarten durch andere ersetzt würden, sei schwierig vorauszusehen, wie sich der Rückgang auf die gesamte Nahrungskette auswirke. So habe massenhaftes Insektensterben wie in Deutschland unweigerlich dazu geführt, dass abhängige Wirbeltiere verhungerten.
Schon im Jahr 2017 kam nämlich eine Langzeitstudie zum Ergebnis, dass mehr als drei Viertel aller Fluginsekten aus deutschen Schutzgebieten verschwunden sind.
Grünstreifen sind verschwunden
Benedikt Polaczek, Agrarwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, beschäftigt sich schon seit mehr als 50 Jahren mit Bienen. Er vergleicht die vielen Belastungen, denen die Insekten und die Natur ausgesetzt sind, mit einem vollen Glas unter einem Wasserhahn: „Jetzt ist die Frage: Wenn man den Hahn jetzt nur ein ganz klein wenig öffnet, wird das Glas überlaufen? Stehen wir vor dem vorletzten oder dem letzten Tröpfchen?“
Er beobachtet nicht nur, dass die Bienenvölker immer neue Krankheiten bekommen, sondern auch massiv mit chemischen Mitteln zu kämpfen hätten. In vielen Pestiziden sind nämlich sogenannte Neonikotinoide enthalten, die das Nervensystem der Bienen angreifen, wenn sie mit ihnen in Berührung kommen.
Der Landwirtschaft komme hier also eine maßgebliche Rolle zu: „Früher gab es zwischen den langen schmalen Feldern Grünstreifen“, erinnert sich Polaczek. Auf den unbeackerten Flächen habe es Lebensräume für Wildbienen gegeben und blühende Pflanzen, die ihnen Nahrung boten. Diese Grünstreifen seien nun verschwunden. „Wir brauchen dauerhafte Inseln, die Vögeln und Insekten ein Zuhause bieten“, fordert Polaczek daher.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen














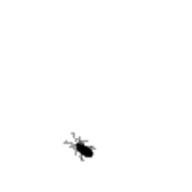

meistkommentiert
Bundeshaushalt
Aberwitzige Anbiederung an Trump
Söder bei Reichelt-Portal „Nius“
Keine Plattform für Söder
Rutte dankt Trump
Die Nato ist im A… von …
Soziale Kürzungen
Druck auf Arme steigt
Studie zu Bürgergeldempfängern
Leben in ständiger Unsicherheit
„Compact“-Urteil
Die Unberechenbarkeit von Verboten