Studie zu Artensterben: Insektenschwund belegt
Die Zahl der Tiere ist seit 1989 sogar in Schutzgebieten um 76 Prozent gesunken, so eine Studie. Eine Ursache könnte die intensive Landwirtschaft sein.
Was Naturschützer schon lange behauptet haben, ist jetzt wissenschaftlich belegt: Die Zahl der Insekten in Deutschland geht nicht nur bezogen auf wenige Arten oder Regionen zurück, sondern insgesamt und in großen Gebieten. Das geht aus einer Studie hervor, die am Mittwoch in der renommierten Fachzeitschrift Plos One erschienen ist.
Wenn es den Insekten schlecht geht, geht es der Natur allgemein schlecht. Laut Studie bestäuben sie 80 Prozent der Wildpflanzen. 60 Prozent der Vögel benötigten sie als Futter. Zudem verwerten sie Nährstoffe aus Pflanzenresten und Tierkadavern.
Doch von 1989 bis 2016 hat die Gesamtmasse der Fluginsekten in 63 Naturschutzgebieten um 76 Prozent abgenommen, wie es in der Studie heißt. In der Mitte des Sommers, wenn am meisten Insekten herumfliegen, betrug das Minus sogar 82 Prozent. Der Rückgang sei besonders alarmierend, weil nur geschützte Gebiete untersucht worden seien, schreiben Caspar Hallmann von der Radboud University im holländischen Nijmegen und seine Ko-Autoren. Außerhalb ist der Insektenschwund also wohl noch größer.
Die Zahlen haben die Forscher mithilfe sogenannter Malaise-Fallen ermittelt. Das sind zeltartig aufgestellte Netze, in denen Fluginsekten in einen Behälter geleitet und getötet werden.
Die Publikation liefere den Beleg, dass der Schwund „wirklich ein größerflächiges Problem“ ist, sagt Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle, der nicht an der Untersuchung beteiligt war. Frühere Studien hatten Rückgänge nur bei bestimmten Arten nachgewiesen, beispielsweise bei Schmetterlingen, Bienen oder Motten. Oder sie bezogen sich auf wenige Orte und wenige Jahre.
Für die neue Analyse dagegen ist die Biomasse aller Insekten an 63 Standorten in drei Bundesländern gewogen worden: Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie Brandenburg, sodass sowohl West- als auch Ostdeutschland vertreten waren. Das ist wichtig, da die Felder im Osten bedeutend größer sind, was sich auf die Artenvielfalt der umliegenden Schutzgebiete auswirken könnte. Die Untersuchungsorte repräsentierten auch unterschiedliche Lebensräume – etwa Heidelandschaften, Graslandschaften oder Brachflächen.
Die Methodik der Forscher sei in Ordnung, urteilen Fachkollegen. „Die Tatsache, dass an vielen Probestellen nur einmal Proben genommen wurden, spielt für die Validität der Daten keine Rolle“, sagt Johannes Steidle von der Universität Hohenheim. Dies zeige auch eine Teilanalyse der mehrfach beprobten Standorte. „Sie kommt zum selben Ergebnis wie die Hauptanalyse mit allen Probestellen.“
Klimawandel ohne negative Folgen
Änderungen des Klimas oder der Wandel etwa von Heide zu Wald könnten den Insektenverlust in dieser Höhe nicht erklären, teilen die Autoren mit. Der im Untersuchungszeitraum festgestellte Anstieg der Durchschnittstemperatur von einem halben Grad Celsius hätte sich den Daten zufolge, wenn überhaupt, positiv auf den Bestand an Insekten ausgewirkt.
Vermutlich spielen die intensivierte Landwirtschaft samt dem Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln sowie die ganzjährige Bewirtschaftung eine Rolle, erklären die Forscher. 94 Prozent der Untersuchungsstandorte waren von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. Es sei denkbar, dass Insekten in den Schutzgebieten zwar zunächst gediehen, dann aber auf den angrenzenden Ackerflächen verschwänden, heißt es.
Der Deutsche Bauernverband pocht hingegen auf weitere Untersuchungen. „In Anbetracht der Tatsache, dass die Erfassung der Insekten ausschließlich in Schutzgebieten stattfand, verbieten sich voreilige Schlüsse in Richtung Landwirtschaft“, sagte Generalsekretär Bernhard Krüsken. „Die neue Studie bestätigt und betont ausdrücklich, dass es noch dringenden Forschungsbedarf zum Umfang und den Ursachen des dargestellten Insektenrückgangs gibt.“
Weitere Langzeitdaten seien nötig, sagt auch Alexandra-Maria Klein, Landschaftsökologin von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg – aber wir sollten „nicht auf diese Ergebnisse warten, bis wir unsere Landnutzung ändern“, sagt sie. „Dies könnte für einige Insekten zu spät sein.“ (mit dpa)
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen









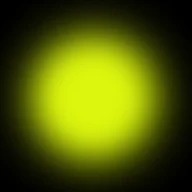




meistkommentiert