Gefühl der Ungerechtigkeit: Waldorfs Demokratieverständnis
Eine Pianistin spielte im Unterricht, es gab Bioessen. Doch unsere Autorin fühlte sich als Waldorfschülerin benachteiligt. Heute weiß sie es besser.

E s war Aufruhr in der Schulgemeinschaft. Man plante politische Aktionen. Ich weiß nicht mehr, um was es genau ging. Aber ich spürte deutlich, dass man sich als Waldorfschulgemeinschaft in der Existenz bedroht sah.
Dass es ein ganz starkes Gefühl von Unrecht gab, weil man weniger Geld bekam als vergleichbare öffentliche Schulen. Ich habe mich mit vollster Überzeugung benachteiligt gefühlt. Vermutlich ganz ähnlich wie die demonstrierenden Berliner Waldorfkinder, die am 19. 9. 2023 vors Rote Rathaus zogen.
Meine ersten Erinnerungen an Politik hängen also mit der Finanzierung meiner Waldorfschule zusammen. Das hat dazu beigetragen, dass mein Vertrauen in den Staat und in demokratische Prozesse bereits als Kind unterminiert wurden. Ich habe durch solche Argumentationslinien verstanden: Der Staat ist böse und gängelt uns unrechtmäßig – nicht nur über das Geld, sondern beispielsweise auch über die Regelungen für Schulabschlüsse.
Ein starkes Gefühl von Unrecht
Worüber damals niemand mit mir geredet hat, waren die unfairen Vorteile, die Waldorfschulen haben: Sie können sich die Kinder aussuchen, die „zu ihnen passen“ und sie können Schulverträge wieder kündigen, wenn Kinder „unbeschulbar“ werden oder das „Vertrauensverhältnis zu den Eltern“ zerrüttet ist.
An meiner Waldorfschule gab es kaum Kinder, die nicht Deutsch als Erstsprache hatten. An den umliegenden Grundschulen waren es teils über 90 Prozent, deren Zweitsprache es war. Zudem ist ein christlicher Religionsunterricht an nahezu allen Waldorfschulen verpflichtend.
Durch bewusste Selektion bestimmter Kinder kreieren Waldorfschulen eine sehr spezifische Gemeinschaft, die viele ressourcenstarke Eltern bindet und Kinder die mehr Ressourcen bräuchten, nicht aufnimmt oder später abstößt.
Wir haben damals auch nie über den Reichtum gesprochen, in dem wir aufwuchsen. Wir hatten einen Eurythmiesaal mit Parkett und eine Pianistin, die täglich für den Unterricht spielte. Wir haben an Vollholztischen gesessen, frisch gekochtes Bioessen bekommen und mit qualitativ sehr hochwertigen Materialien gemalt, musiziert, gestrickt und gewerkt. Ich dachte wirklich, das käme einfach nur weil „uns“ Bildung nun mal wichtig wäre und dass jedes Kind auf die Waldorfschule gehen könne, wenn die Eltern es nur wollten.
Eine Pianistin, frisches Bioessen, teures Werkzeug
Wir haben uns eher arm gefühlt, weil irgendwie immer zu wenig Geld da war und wir nach jeder Aufführung mit Hut oder Geigenkasten an den Ausgängen standen. Und Schulgeld wäre ja auch gar nicht nötig, wenn die Waldorfschulen voll finanziert würden. So dachte ich auch noch, nachdem ich meine Schule längst verlassen hatte.
Heute bringe ich meine Kinder morgens in eine unterfinanzierte öffentliche Grundschule und frage mich: Was wäre, wenn das praktische, politische und finanzielle Engagement der „Waldorfkohorte“ bei Regelschulen und Kiezinitiativen ankommen würde, weil sie einfach Teil davon wären? Wenn Holzwerkstatt und Malatelier inklusiv wären?
Bildungsgerechtigkeit kann doch nicht dadurch entstehen, dass ressourcenstarke Familien sich in eine scheinbar geborgene Parallelgemeinschaft zurückziehen, wo Kinder fast unkontrolliert nach einem problematischen Lehrplan unterrichtet werden und dann vielleicht, so wie ich, mit einem verzerrten Demokratieverständnis in die Welt gehen?
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen




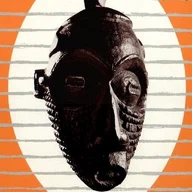









meistkommentiert