Finanzierung der UNRWA nach Vorwürfen: Höchste Zeit
Eine wachsende Koalition von Geberländern hat die Hilfe für UNRWA trotz der Vorwürfe wieder aufgenommen. Fünf Gründe, warum Deutschland folgen sollte.
V or sechs Wochen haben 18 Geberländer des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), darunter Deutschland, ihre Zahlungen gestoppt. Grundlage für diese Entscheidung waren israelische Vorwürfe, laut derer zwölf UNRWA-Mitarbeiter am brutalen Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen seien. UNRWA ergriff daraufhin umfassende Maßnahmen.
Wegen der massiven Budgetkürzungen ist die Organisation nach eigenen Angaben gezwungen, ihre Arbeit in Gaza, Ost-Jerusalem, der Westbank, Jordanien, Libanon und Syrien, wo sie die Schulbildung sowie Gesundheitsversorgung für Millionen von Palästinenser:innen gewährleistet, ab April einzustellen. In der humanitären Versorgung für zwei Millionen Menschen im vom israelischen Militäreinsatz zerstörten Gazastreifen ist das Hilfswerk als wichtigster Akteur unabdingbar.
Norwegen teilt diese Einsicht. Anstatt seine Unterstützung zu unterbrechen, knüpfte das Land seine Mittelvergabe an stärkere Kontrollen und die Abklärung der israelischen Vorwürfe. Die EU, Spanien, Kanada, Schweden, Irland, Dänemark und Australien haben nun ihre zeitweise ausgesetzten Zahlungen an UNRWA wiederaufgenommen oder sogar erhöht, teilweise mit ähnlichen Auflagen. Als zweitgrößter Geber sollte auch Deutschland sich umgehend dieser wachsenden Koalition anschließen, aus fünf Gründen.
Kürzungen gefährden Zivilist:innen in Gaza
Erstens hat UNRWA glaubhaft und umfassend auf die Vorwürfe reagiert. Noch im Mai 2023 durchliefen alle 13.000 UNRWA-Mitarbeiter:innen in Gaza einen regelmäßigen Sicherheits- und Neutralitätscheck und wurden auch von Israel überprüft. Auf Israels Vorwürfe antwortete das Hilfswerk umgehend. UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini entließ in Absprache mit UN-Generalsekretär António Guterres die zwölf Genannten ohne vorherige Prüfung der Vorwürfe. Alle Mitarbeiter:innen, die nachweislich an Terrorattacken beteiligt gewesen seien, würden zur Rechenschaft gezogen und strafrechtlich verfolgt, so Lazzarini.
Außerdem wurden unabhängige, ausführliche Überprüfungen UNRWAs sowie der Vorwürfe eingeleitet: einerseits durch das Büro für interne Aufsicht der Vereinten Nationen, andererseits durch eine externe, unabhängige Kommission, die von der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna geleitet wird.
Zweitens würde ein Boykott UNRWAs die ohnehin katastrophale humanitäre Situation in Gaza noch verschlimmern.
Ende Februar forderten 17 angesehene, auf Krisengebiete spezialisierte internationale NGOs die EU- und Geberländer in einem gemeinsamen Statement auf, ihre Unterstützung UNRWAs fortzusetzen, darunter Oxfam und Plan International. Keine andere Hilfsorganisation könne UNRWA in Gaza ersetzen und ohne UNRWA könnten über die Hälfte der dort agierenden internationalen NGOs keine Hilfe leisten, weshalb sie sich solidarisch mit dem Hilfswerk zeigten. „Jede weitere Kürzung der UNRWA-Finanzierung wäre ein effektives Todesurteil für Zivilisten […] deren Überleben auf die Organisation angewiesen ist.“ Das Ausbleiben der UNRWA-Unterstützung führe zu vermeidbarem Tod, Krankheiten und Hunger in Gazas Zivilbevölkerung.
Keine stichhaltigen Beweise veröffentlicht
Drittens könnte man vermuten, dass Israels Vorwürfe gegen UNRWA Teil einer politischen Kampagne sind. Denn seit Kriegsausbruch ist die Delegitimierung UNRWAs ein integraler Bestandteil von Israels PR-Strategie, unter anderem durch die Veröffentlichung immer neuer, unabhängig nur schwer zu überprüfender Anschuldigungen. Detaillierte Recherchen von Spiegel und dis:orient zur Entstehungsgeschichte dieser Vorwürfe zeigen: Israel hat bisher keine stichhaltigen Beweise mit der UNRWA-Untersuchungskommission, verbündeten US-Geheimdiensten oder den Medien geteilt. Deutsche wie internationale Medien popularisierten die Vorwürfe und statteten sie so mit Glaubwürdigkeit aus – selbst Netanjahus wohl eher haltlose Behauptung, dass UNRWA „vollkommen infiltriert“ von der Hamas sei – ohne Beweise von Israel einzufordern oder die dahinterstehende PR-Kampagne zu benennen.
Einige der Anschuldigungen könnten durchaus zutreffen. Doch unabhängig davon unterstreicht Israels Weigerung, stichhaltige Beweise zu liefern, dass die Vorwürfe vor allem medienwirksam auf eine grundsätzliche Kritik an UNRWA abzielen. Dies legen auch Aussagen von UNRWA-Mitarbeiter:innen nahe, nach denen sie durch Folter zu falschen Geständnissen über die Zugehörigkeit zur Hamas gezwungen worden seien.
Viertens bringt das jetzige Vorgehen UN-Institutionen in Gefahr. Deutschland erklärt, auf die Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung zu den Vorwürfen gegen UNRWA zu warten, deren Interim-Report Ende März erscheint – nur wird er nicht alle Vorwürfe ausräumen. Bereits jetzt halten pro-israelische Stimmen die Untersuchung für eine Farce. Doch selbst mutmaßliche Vergehen von zwölf Individuen rechtfertigen nicht die grundsätzliche Infragestellung einer UN-Institution. Zu dulden, dass Israel keine Beweise für die Vorwürfe mit der UN oder Verbündeten teilt, könnte ferner supranationale Institutionen wie die UN nachhaltig schädigen, wenn sich Anschuldigungen ohne Beweise in Zukunft als Methode durchsetzen.
Fünftens kostet Deutschlands Zögern Menschenleben. Als zweitgrößter Geldgeber hängen an Deutschlands Entscheidung unzählige Leben hungernder Zivilisten in Gaza, wie auch Amnesty International betont. Für Zögern bleibt keine Zeit. Ein deutscher Vorstoß zur Wiederherstellung von UNRWAs Unterstützung könnte die gespaltene EU-Außenpolitik einen. Wenn Olaf Scholz seinen humanitären Einsatz für Gazas Zivilbevölkerung ernst meint, wäre nicht eine Luftbrücke, sondern die sofortige Wiederaufnahme der Unterstützung UNRWAs das effektivste Mittel. Moralisch wie strategisch ist es dafür höchste Zeit.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







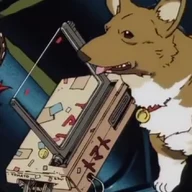
meistkommentiert
Wohlstand erzeugt Erderhitzung
Je reicher, desto klimaschädlicher
Putins Verhandlungsangebot an Ukraine
Ein durchsichtiger Schachzug mitten in der Nacht
Wohnraumkrise in Deutschland
Enger wohnen
Rassismusvorwürfe in Hamburger Kirche
Sinti-Gemeinde vor die Tür gesetzt
Stärkster Landesverband
NRW-SPD rechnet mit Klingbeil ab
AfD-Bürgermeister über Zweiten Weltkrieg
Zuerst an die deutschen Opfer denken