AfD-Verbot und Grundrechtsverwirkung: Mit Transparenz gegen rechts
Juristische Schritte gegen die Rechtsextremen sind notwendig, ihre Risiken überschaubar. Sie könnten die Demokratie resilient gegen rechts machen.
W ährend Hunderttausende endlich Maßnahmen gegen die AfD fordern, starrt die Politik wie das Kaninchen auf die Schlange. „Sehr hohe Hürden“ gebe es für ein Verbotsverfahren gegen die AfD – meint Bundesinnenministerin Nancy Faser. Ein „gewaltiger PR-Sieg der AfD“ drohe im Fall einer Verfahrensniederlage – warnt Bundesjustizminister Marco Buschmann.
Empfohlener externer Inhalt
Das gleiche Bild bei einem Verfahren zur Grundrechtsverwirkung von Björn Höcke: 1,5 Millionen Menschen haben die Petition für ein Vorgehen nach Artikel 18 des Grundgesetzes unterschrieben, aber die Antragsberechtigten ducken sich weg.
lehrt Verfassungsrecht und Internationales Recht. Außerdem leitet er das Fachgebiet Just Transitions an der Universität Kassel.
Gefährlichkeit ist der Dreh- und Angelpunkt
Es ist ja richtig: Parteiverbotsverfahren und Verfahren zur Grundrechtsverwirkung einzelner Personen sind in der Demokratie ultima ratio. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben diese Mittel der „wehrhaften Demokratie“ aus historischer Erfahrung dennoch für nötig erachtet, jeweils aber auch Voraussetzungen formuliert.
Dreh- und Angelpunkt in beiden Verfahren ist der im Grundgesetz normierte Schutz vor Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sowohl die „Gefährlichkeit“ als auch den Inhalt dieser „Grundordnung“ hat das Bundesverfassungsgericht mittlerweile so konkretisiert, dass sich mit Sicherheit sagen lässt: An der mangelnden Gefährlichkeit der Partei bzw. der Person werden die Verfahren nicht scheitern.
Die AfD hat aktuell das Gefahrenpotential, das der NPD im damaligen Verbotsverfahren fehlte. Und Björn Höcke als der Spiritus Rector einer rechtsextremen Partei, der sich aktuell wegen der Verwendung von SA-Propaganda vor dem Landgericht Halle verantworten muss, hat genau die akute Gefährlichkeit, die in den vier Verfahren zur Grundrechtsverwirkung fehlte, die das Bundesverfassungsgericht bislang zu entscheiden hatte.
Verfassungsfeindlichkeit
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Auch im Hinblick auf die Beeinträchtigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind die Dinge weniger uneindeutig als regelmäßig behauptet. Das Bundesverfassungsgericht hat den entsprechenden Maßstab in seiner Entscheidung vom Dienstag, in dem es die NPD bzw. „Die Heimat“ von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen hat, nochmals präzisiert. Das Gericht stellt insbesondere auf die Gleichheit ab: Ein ethnischer Volksbegriff und die Vorstellung von der deutschen „Volksgemeinschaft“ als Abstammungsgemeinschaft verletzen das Gebot elementarer Rechtsgleichheit.
Wenn das Gericht die Verfassungsfeindlichkeit der NPD im Urteil aus dieser Woche daran festmacht, dass gerade die Vorstellung der ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“ zu einer gegen die Menschenwürde verstoßenden Missachtung von Ausländer*innen, Migrant*innen und Minderheiten führt, dann ist das eins zu eins auf die AfD übertragbar.
Wie die NPD ist die AfD von einer rassistischen, insbesondere antimuslimischen, antisemitischen und antiziganistischen Grundhaltung geprägt. Wie die NPD nimmt die AfD eine ablehnende Haltung gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten wie transsexuellen Personen ein.
Überschaubares Prozessrisiko
Nach allem, was öffentlich bekannt ist, ist daher nicht ersichtlich, weshalb die vom Verfassungsschutz bereits als rechtsextrem eingestuften AfD-Landesverbände in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt und auch die AfD auf Bundesebene nicht als verfassungsfeindlich bewertet werden sollten.
Zahlreiche Funktionär*innen haben sichtbare Spuren dafür hinterlassen, dass sie darauf abzielen, demokratische und rechtsstaatliche Institutionen auszuhöhlen. Deportationsfantasien, völkisches Denken, Inklusionsfeindlichkeit, Antisemitismus, Sexismus: die AfD ist auf allen Ebenen und in allen Regionen durchsetzt von Menschen, die sich gegen den Grundsatz der unteilbaren und unverfügbaren Menschenwürde – nach dem Grundgesetz die Basis von Demokratie und Rechtsstaat – wenden.
Gerade vor dem Hintergrund entsprechender Präzedenzfälle in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, vor den die Verfahren sicher gebracht würden, ist eine Ablehnung der Anträge daher kaum zu erwarten.
Delegitimation der AfD durch Verfahren
Die Risiken, sowohl im Verbots- als auch im Grundrechtsverwirkungsverfahren, sind daher überschaubar, zumal davon auszugehen ist, dass die Verfahren professionell geführt werden. Dazu gehört, dass von Anfang an eine personelle Distanz zu den Verfassungsschutzämtern gewahrt bleiben muss. Das erste NPD-Verbotsverfahren scheiterte 2003 daran, dass der Verbotsantrag auf Äußerungen gestützt worden war, die V-Männer des Verfassungsschutzes getätigt hatten. Der Fehler, dass der Staat durch V-Männer und V-Frauen die Verbotsgründe quasi selbst schafft, darf natürlich nicht erneut begangen werden. Gerade im Verbotsverfahren werden also entsprechende Vorkehrungen zu treffen sein.
Zudem wäre es wichtig, dass Bund und Länder konzertiert vorgehen. Statt sich wie im zweiten NPD-Verfahren 2013 die heiße Kartoffel gegenseitig zuzuschieben, sollte der Antrag von allen Antragsberechtigten gemeinsam gestellt werden. Im Verbotsverfahren müssten also die in Paragraf 43 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes genannten antragsberechtigten Institutionen Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat gemeinsam vorgehen.
Im Verwirkungsverfahren wären nach Paragraf 36 des Gesetzes neben Bundestag und Bundesregierung die Landesregierungen zuständig – wobei hier jede Landesregierung initiativ werden kann, unabhängig vom Wohnsitz oder Dienstort des Betroffenen. Das Grundrechtsverwirkungsverfahren gegen Björn Höcke als thüringischen Fraktionsvorsitzenden der AfD sollten dementsprechend alle Landesregierungen, und nicht allein die thüringische, mittragen.
Schließlich wären die Vorwürfe auch transparent zu dokumentieren. Eine das Verfahren begleitende Öffentlichkeitsarbeit wird daher essenziell sein. So könnten die Verfahren schon durch ihre Einleitung eine aufklärende Wirkung entfalten. Zwar verschwinden die rechtsextremen Menschen dadurch nicht. Aber ein transparent geführtes Verfahren wäre Teil des Unternehmens, diese Personen wieder für die Demokratie zurückzugewinnen, flankiert von guter Politik, die ihre Lebenssituationen verbessert.
Zudem kann nicht genug betont werden, dass das Parteiverbot nicht nur auf die Milieus zielt, die die verfassungsfeindliche Partei wählen, sondern auch auf die, die von dieser Wahl besonders betroffen sind. Die Menschen in vulnerablen Konstellationen vor den Konsequenzen der Machtübernahme der Verfassungsfeinde zu schützen, ist ein maßgebliches Ziel. Dazu gehört eben auch, der Öffentlichkeit vor Augen zu führen, was die Politik der AfD für die Menschen bedeutet, die von der rassistischen, antisemitischen, sexistischen und ableistischen Politik dieser Partei in ihrer Existenz betroffen sind.
Auch eine Niederlage kann zum Erfolg führen
Schon die Einleitung der beiden Verfahren würde in der aktuellen Situation die Diskurslage in Deutschland verschieben und auch die Brandmauer gegen Kooperationen mit den Verfassungsfeinden verfestigen, selbst wenn sie absehbar nicht 2024 abgeschlossen werden.
Natürlich wird die AfD sich weiter als Opfer einer Diktatur- und Zensurpolitik gerieren. Diese Klaviatur bedient die Partei seit Jahren. Je sachlicher aber die Verfahren geführt und je sorgfältiger die Vorwürfe dokumentiert werden, desto weniger wird es der AfD gelingen, diese sich ohnehin abnutzende Strategie zu diskursiven Erfolgen zu führen.
Und selbst eine Ablehnung der Anträge muss nicht zwangsläufig in einem „PR-Sieg der AfD“ münden. Das NPD-Verfahren ist das beste Beispiel dafür, dass eine Partei auch trotz eines abgelehnten Verbotsantrages in der Bedeutungslosigkeit verschwinden kann. Zwar war die NPD im Jahr des Verbotsantrags 2013 im Vergleich zur AfD, die in aktuellen Umfragen bundesweit bei etwa 22 Prozent liegt, schon marginalisiert.
Dennoch zeigt auch das Verfahren gegen die NPD, dass es im Falle einer Antragsablehnung beim Bundesverfassungsgericht darauf ankäme, genau herauszuarbeiten, an welchem Punkt das Verfahren gescheitert ist. Wenn dies angemessen erklärt würde, wenn aus einer eventuellen Ablehnung die richtigen Schlüsse für Folgeverfahren und Gesetzesänderungen geschlossen würden, kann auch ein verlorenes Verfahren ein Schritt vorwärts auf dem Weg sein, die Demokratie gegen Rechtsextremismus resilient zu machen.
Dass auch schon die Verfahrenseinleitung unabhängig vom Ausgang einen Resilienzeffekt entfalten kann, zeigen im Übrigen auch die 1996 zurückgewiesenen Anträge auf Grundrechtsverwirkung gegen die Neonazis Thomas Dienel und Heinz Reisz. So hat das Bundesinnenministerium unter dem damaligen Bundesinnenminister Manfred Kanther (CDU) das Scheitern der Verfahren am Tatbestandsmerkmal der Gefährlichkeit gerade damit begründet, dass sich schon die Verfahrenseinleitung „mäßigend auf die rechtsextreme Szene“ ausgewirkt habe.
Voraussetzung für solch einen „Erfolg ohne Obsiegen“, wie es in der Prozessführungspraxis oft im Anschluss an das 2004 erschienene Buch „Success without Victory“ des US-amerikanischen Verfassungsjuristen Jules Lobel formuliert wird, ist freilich eine das Verfahren begleitende, professionelle Öffentlichkeitsarbeit.
Davon sind die politisch Verantwortlichen derzeit leider noch allzu weit entfernt. Doch es bleibt zu hoffen, dass der Druck der Öffentlichkeit und die sich nun regenden Proteste hier einen Unterschied machen werden.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







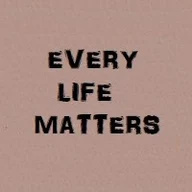




meistkommentiert