
Wasserpest-Alarm in Bremen: Angst vor dem grünen Koboldchen
Die Wasserpest, eine invasive Art, verdrängt den Menschen aus dem Bremer Werdersee. Anwohner:innen fordern schnelle Lösungen. Die gibt es nicht.
S ie sind empört. Da ist etwas anders als gewohnt, das muss doch jemand wieder ins Lot bringen, die Behörden, wer denn sonst. Um zu hören, wie die das anstellen und vor allem wann, sind sie hier, auf einer Informationsveranstaltung des Beirats Bremen-Neustadt, dem ehrenamtlichen Kommunalparlament des Stadtteils. Um die 120 Personen, vielleicht mehr, sitzen an einem Donnerstag Abend Anfang September in der Aula der Wilhelm-Kaisen-Oberschule im Süden der Stadt. Alle Altersgruppen, dem äußeren Anschein nach Menschen, denen es an wenig mangelt.
Eine Stuhlreihe nach der anderen muss angebaut werden, so viele drängen in den fensterlosen Saal. Ihnen gegenüber haben die Beiratsmitglieder im Halbrund hinter Tischen Platz genommen: Die Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken hat auch hier eine Mehrheit. Ein paar Namensschilder werden wieder entfernt, weil nicht alle Beirät:innen gekommen sind. Es scheint für sie Wichtigeres zu geben als: Grünzeug.
Moment, nicht irgendein Grünzeug, sondern Elodea nuttallii, die schmalblättrige Wasserpest, meistens nur „Wasserpest“ genannt, obwohl zur Gattung Elodea aus der Familie der Froschbissgewächse noch fünf andere Arten gehören, darunter Elodea canadensis, die Kanadische Wasserpest. Bis ins 19. Jahrhundert wurden sie nur in Nord- und Südamerika gefunden, bis sich zunächst Canadensis und seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch Nuttalii in Europa breit machten. Die Letztgenannte wird von der EU seit 2017 auf einer Liste als invasive Art geführt.
Neuerdings hat sie unter anderem den Bremer Werdersee in Beschlag genommen. So wird das fünf Kilometer lange Stillgewässer parallel zur Weser genannt, auch wenn ein Teil davon eigentlich Kleine Weser heißt. An der breitesten Stelle misst der See 300 Meter, über weite Strecken 80 bis 100 Meter, maximal drei Meter ist er tief. Im Laufe dieses Sommers wuchs also das ganze Gewässer nahezu komplett mit der krautartigen Wasserpflanze zu. Beeindruckende 20 Zentimeter am Tag kann sie schaffen; Halt macht sie erst wenige Zentimeter vor der Wasseroberfläche.
Baden verboten
Schwimmen macht so keinen Spaß mehr und ist nach Einschätzung der Behörden sogar gefährlich, weil man sich in der Pflanze verheddern und in Panik geraten kann. Deshalb ist das Baden seit Juli nur an der offiziellen Badestelle erlaubt, wo in diesem Sommer das Kraut zwei Mal gemäht wurde. Wer mit Booten auf dem See unterwegs ist, muss Rettungswesten tragen.
Viel gerudert und gepaddelt wird derzeit allerdings nicht auf dem Werdersee, er gehört ganz der Wasserpest. Oft bleiben Spaziergänger:innen auf der Fußgängerbrücke über den See stehen, beugen sich über das Geländer und schauen, manche fotografieren. Wie ein Unterwasserwald sieht der See von oben aus. Man kann sich vorstellen, wie kleine Fische darin Haschen spielen. Auf der Wasserpest hat sich eine fädige Grünalge angesiedelt. Neongrüne Inseln aus pflanzlichem Pelz schwimmen auf dem Wasser, durchzogen von Straßen, die Enten und Blässrallen hinterlassen, wenn sie durch das Grün hindurch pflügen.
Hässlich finden das manche. Eine Anwohnerin hat eine Petition an die Bremische Bürgerschaft verfasst, 5.155 Unterschriften hat sie bekommen. Titel: „Gebt den Werdersee nicht auf!“ Sie begründet die Petition nicht nur mit den begrenzten Möglichkeiten des Wassersports und Badens, sondern auch mit der optischen Beeinträchtigung: „Der Blick über den Werdersee ist auch eine Labsal für die Seele – wenn die Wasseroberfläche nicht von Schlieren und grünen Inseln verunreinigt ist wie zur Zeit.“ Der Werdersee, er soll bitte wieder trübbraun sein wie eh und je.
Nun sind sie in Bremen beileibe nicht die Ersten und sicher nicht die Letzten, denen der Anblick der Wasserpest zusetzt. Schon 1911 schrieb der „Heidedichter“ Hermann Löns ein Prosastück über „das grüne Gespenst“. Es handelte sich zwar um die kanadische Wasserpest, aber die Reaktion war ähnlich. „Der des Grünen entwöhnte Städter erschrak bis in das Mark, als die Wasserpest einwanderte“, schreibt Löns, „erschreckliches Heulen und Zähneklappern“ sei zu vernehmen gewesen, während sie sich von der Spree aus in alle deutschen Flüsse verbreitete. Das ist unwahrscheinlich, weil die Wasserpest es gerne ruhig hat und nicht fließend oder gar strömend.

Besonders laut heulen sie gar nicht an diesem Abend in der Schulaula, das bürgerliche Publikum hat seine Emotionen im Griff und grummelt nur leise vor sich hin. Einmal schimpft jemand „Schwachsinn“. Eine Frau giftet, „das wissen wir doch alles“, als die Biologin Martina Völkel erklärt, unter welchen Bedingungen die Pflanze besonders gut gedeiht. Martina Völkel ist bei der Umweltsenatorin für Oberflächengewässer zuständig und hat heute Abend die undankbare Aufgabe, gemeinsam mit einer Kollegin „die Behörden“ zu repräsentieren.
Nüchtern beschreibt sie das Wesen der Wasserpest. Die ähnelt dem Menschen, insofern sie im Kampf um Lebensraum recht anpassungsfähig ist. Ab vier Grad Wassertemperatur beginne sie zu wachsen, referiert Martina Völkel, möge aber auch Wärme, käme sowohl mit wenig als auch mit vielen Nährstoffen zurecht. Und wie alle bodenwurzelnden Wasserpflanzen braucht sie klares Wasser und geringe Tiefe. Denn entscheidend sei, wieviel Licht sie zu Beginn der Wachstumsperiode abbekomme. Und davon gab es in diesem Frühjahr reichlich; der Klimawandel schickte einen lieben Gruß.
Das ist aber nichts, was sie im Publikum hören wollen, sie interessiert nur, wann „die Behörden“ den Spuk des „grünen Koboldchens“ (Löns) beenden. Der, so glauben offenbar viele, hätte verhindert werden können. So bekommen alle Redner:innen großen Applaus, die sagen, die Behörden hätte viel eher handeln müssen, nämlich im letzten Jahr, als erstmals größere Bestände der Pflanze im See zu sehen waren. Ach was, noch früher, 2023 sei sie nämlich auch schon da gewesen, weiß eine Frau.
Das ist falsch, denn bevor Eloea Nuttallii dem Menschen unangenehm auffällt, hat sie bereits zwei bis sechs Jahre mit der Etablierung verbracht, wie es etwa in einem Bericht aus Nordrhein-Westfalen heißt, der Untersuchungen aus Hamburger Baggerseen in den 1990ern zitiert. Eingeschleppt worden kann sie auf vielen Wegen sein, vielleicht von Wasservögeln aus einem anderen Bremer Gewässer, wo die Wasserpest schon länger vorkommt. Darüber hatte sich nie jemand aufgeregt, weil man in ihnen weder baden noch paddeln kann.
Gegen die Wasserpest im Werdersee soll die Behörde jetzt aber bitte ins Feld ziehen und zwar pronto, lautet der Tenor im Saal. Bis März 2026 soll ein Konzept zum Umgang mit der Wasserpest im Werdersee entstehen, wie Martina Völkel vorgetragen hat? Zu spät! „Dann ist das Kind längst in den Brunnen gefallen“, ruft ein Mann in den Saal. Applaus. Dabei hatte die Fachfrau gerade erklärt, dass das Kind, also die Wasserpest im Brunnen bleiben wird – egal, wie sie ihm jetzt zusetzen.
Behörde schnell wie nie
Auch die Petentinnen leben in dem Glauben, man könne die Wasserpest wieder endgültig los werden. Es entstehe „der Eindruck, wir müssten uns darauf einstellen, dauerhaft mit der Wasserpest im Werdersee zu leben“, heißt es in der Petition. Und: „Das wollen wir nicht akzeptieren!“ Das ist in etwa so, als würden sich Ostsee-Urlauber:innen an den Strand stellen und die Behörden für die vielen Feuerquallen oder übermäßiges Seegras verantwortlich machen. „Das wollen wir nicht akzeptieren!“ Weiter geht es in der Petition: Die „zuständigen Stellen“ mögen „umgehend handeln“ anstatt wie der Senat „vor der Situation kapitulieren“.
Unklar bleibt allerdings, was die Befürworter:innen des schnellen Handelns darunter verstehen. Denn gehandelt hat die Behörde, sogar schneller als er das je erlebt habe, wie in seinem Schlusswort der Beiratssprecher sagt. Zwei Mal hat sie ein Mähboot ausgeliehen und die Badestelle am Sandstrand befreit, teilweise sind auch die Wurzeln mit heraus gerissen worden. Im Herbst soll noch einmal gemäht werden, zu einem Zeitpunkt, an dem sich die neuen Knospen am Stängel gebildet haben, aber bevor sie auf den Grund fallen, um im nächsten Jahr neu auszutreiben.
Gekostet hatte der erste Einsatz mit geliehenem Mähboot in Bremen 28.000 Euro, der im Herbst soll mehr als 50.000 Euro kosten, eine Neuanschaffung schlüge mit mindestens 150.000 Euro zu Buche. „Geld spielt keine Rolle“ heißt es dazu aus dem Publikum am Donnerstag Abend.

Nach der ersten Mäh-Aktion lagen meterhohe Haufen Wasserpflanzen einige Zeit zum Trocknen am Ufer. Ein Verfahrenstechniker am Helmholtzzentrum für Umweltforschung in Leipzig hatte geforscht, ob es sich lohne Biogasanlagen mit der Wasserpest zu betreiben. Beteiligt war daran das öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsunternehmen Ruhrverband mit Hauptsitz in Essen. Das hat seit 25 Jahren immer wieder mit Massenwachstum von Elodea nuttallii in den fünf Ruhrstauseen zu tun. Und, kann man das Zeug sinnvoll nutzen? Eine Sprecherin winkt auf Nachfrage der taz ab. „Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften, insbesondere des hohen Wassergehalts, kann das Material eigentlich nur entsorgt werden.“
Die Sprecherin schickt auch den 2024 veröffentlichten 265-seitigen Abschlussbericht zur „Erprobung und Entwicklung innovativer Methoden zur Eingrenzung“. Das Mähen in der Wachstumsperiode sei eher kontraproduktiv, heißt es darin, weil sich aus jedem Teilstück neue Pflanzen entwickeln können, darauf hatte auch Martina Völkel hingewiesen. Die Pflanze vermehrt sich ausschließlich vegetativ, nicht über Samen. Dadurch, ein schwacher Trost, ist sie nicht sehr widerständig, weil die genetische Vielfalt fehlt.
Zudem würden, heißt in dem Bericht weiter, mit der Mahd andere, langsamer wachsende Wasserpflanzen gleich mit rasiert. Dazu muss man wissen: Wenn es der Wasserpest gut geht, stimmen die Bedingungen im Gewässer auch für die Konkurrenz. Deshalb versuchte es der Ruhrverband mit Alternativen: Eine Bearbeitung des Bodens, um die Wurzeln zu stören, die Ansiedlung von Konkurrenzarten, ein eigens entwickeltes Pflückgerät und die Veränderung der Strömungsgeschwindigkeit. Das Ergebnis: „Ökologisch verträglich, aber wirkungslos.“
Pest hält Blaualge in Schach
Martina Völkel listet in der Aula in Bremen dennoch diese Möglichkeiten als Prüfaufträge auf, wobei die Bearbeitung des Werdersee-Bodens ausscheidet. Die Gefahr, dass Wasser absickert und die umliegenden Wohngebiete überschwemmt, sei zu groß. Auch die Anschaffung eines Mähboots werde erwogen. Ob man nicht aus Kostengründen lieber Schwäne statt Boote ins Wasser setzen sollte, wirft eine SPD-Beirätin ein. Eine Frau aus dem Publikum fordert vehement, „das Wasser schön abzulassen“. Martina Völkels Einwand, dass dass ein „ökologischer Totalschaden“ wäre, ficht sie nicht an. „Die Fische schwimmen dann in die Weser“, spekuliert sie.
Zuvor hatte die Behördenmitarbeiterin dafür geworben, die positiven Effekte der Wasserpest anzuerkennen: Sie böte Lebensräume für Jungfische, Brutvögel und Wirbellose; Rotfedern, Schwäne und Blässrallen hätten sie zum Fressen gern. Zudem würde sie Nährstoffe binden, was die Blaualge in Schach halte, deren Giftstoffe Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber, Atemnot und Hautreizungen hervorrufen können.
Aber das Argument zieht hier nicht. Stattdessen unken mehrere Redner:innen, die Wasserpest bedrohe die Natur. „Die Fische verhalten sich sehr merkwürdig“, warnt ein Mann, „sie springen aus dem Wasser!“. Er habe sein ganzes Leben am Werdersee verbracht und so etwas noch nie beobachtet, für ihn ein klares Anzeichen für Sauerstoffmangel. Tatsächlich produziert die Pflanze Sauerstoff, und es ist möglich, dass die Fische nach Insekten schnappen. Gleich mehrere Redner:innen sind sich ganz sicher, dass die absterbenden Pflanzenteile den See durch Fäulnisprozesse zum Kippen bringen würden – und verschlammen würde er auch!
Rückzug von selbst
Nichts davon ist an anderer Stelle beobachtet worden, aber Martina Völkel sagt, zur Sicherheit würde dennoch der Sauerstoffgehalt regelmäßig gemessen.
Nicht ausgeschlossen ist, dass der Spuk auch ohne irgendein Handeln so endet wie Hermann Löns es 1911 beschrieb. „Denn als einige Jahre vergangen waren, da sank das grüne Gespenst bis auf ein bescheidenes Maß in sich zusammen.“
Genau so ist es vor 21 Jahren am Steinhuder Meer bei Hannover geschehen. Hans-Heinrich Schuster erinnert sich gut daran, an die Aufregung, als der See in den Jahren 2002 und 2003 von der Wasserpest vereinnahmt wurde. An die Seglervereine, denen zwei Mähboote nicht genug waren. „20 hätten sie besser gefunden“, sagt der Limnologe, der am Steinhuder Meer aufgewachsen ist und das Seenkompetenzzentrum beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz leitet. Martina Völkel spricht dieser Tage häufiger mit ihm.
Fische und Vögel profitieren
Er habe damals zur Besonnenheit gemahnt, erinnert er sich. Dass die Wasserpest so erfolgreich war, habe daran gelegen, dass das Steinhuder Meer in den Jahren zuvor ungewöhnlich klar war. Das änderte sich 2004 wieder, das Wasser trübte wieder ein. Ein oft beobachteter Wechsel von einem Zustand, in dem die mit bloßem Auge erkennbaren Makrophyten dominieren, zu einem, in dem das mikroskopisch kleine Phytoplankton wieder die Oberhand hat.
Fische und Wasservögel hätten damals vom Wasserpestboom profitiert, sagt Hans-Heinrich Schuster. Zu Spitzenzeiten hätten sie 500 Schwäne und 34.000 Bläßrallen auf dem See gehabt. Er rechnet vor, was diese verdrücken können. Schwäne vier bis sechs Kilo am Tag, Bläßrallen 400 bis 500 Gramm. Das wären 17,8 Tonnen am Tag. „Für umsonst.“ Zum Vergleich: In Bremen waren beim Mähen 50 Tonnen geerntet worden in neun Tagen. Nicht für umsonst.
Aus dem Steinhuder Meer ist die Wasserpest seitdem nicht wieder vollständig verschwunden, aber nie wieder in dem Umfang aufgetreten wie vor 23 Jahren. So ist es auch im Goitzschesee bei Bitterfeld, wo ab 2004 aufgebrachte Bürger:innen die Verwaltung ein paar Jahre auf Trab hielten. In Bremen wird es noch ein paar Sommer brauchen, bis die Menschen die Wasserpest als das akzeptieren, was sie ist: Natur, die sich nicht zähmen lässt. Und dabei vergleichweise harmlos.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen









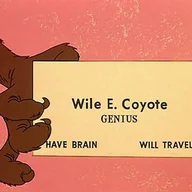

meistkommentiert