Pro und Contra Widerspruchslösung: Organspende als Standard?
Der Bundestag stimmt in dieser Woche über die künftige Regelung der Organspende ab. Wie sollte sie aussehen? Ein Pro und Contra.

JA,
d enn die Chance, als potenzieller Spender tatsächlich zum Spender zu werden, ist schon gering genug. Nur wer am Ende seines Lebens die Diagnose „hirntot“ erfährt, kommt als Spender infrage. Das ist extrem selten. Wenn also mehr Menschen potenzielle Spender wären, würde sich der Pool derer vergrößern, die tatsächlich Spender werden – und Menschenleben retten können. Ein simples Solidaritätsprinzip, das man als Mensch mit Mitgefühl nur gut finden kann.
Oder muss man es strikt ablehnen, wenn man es mit Artikel 1 des Grundgesetzes ernst meint? „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Der Satz ist so ziemlich das Beste an der Bundesrepublik, weil er sagt: Der Staat hat niemals Zugriffsrecht auf das Individuum. Das größere Gut darf er nicht über die Unversehrtheit des Einzelnen stellen.
Über die Frage, ob die jetzt zur Debatte stehende Widerspruchslösung schlicht nicht verfassungskonform ist, sollten Verfassungsrechtler streiten. Man sollte allerdings auch fragen, ob eine Widerspruchslösung tatsächlich schon ein Zugriff ist – oder lediglich ein Anstupsen des mündigen Bürgers, sich mit etwas zu beschäftigen, womit er sich nicht beschäftigen will. Oder ist das Nachdenken darüber etwa schon mehr an Solidarität, als wir uns als Gesellschaft abverlangen wollen?
Auch die Widerspruchslösung zwingt niemanden, seine Würde preiszugeben. Aber, das stimmt, mit ihr zwingt einen der Staat, sich mit dem eigenen Sterben zu beschäftigen. Verletzt das schon die Würde? Nein. Das Sterben gehört zum Leben dazu und es ist nicht Aufgabe des Staates, seine Bürger vor unangenehmen Wahrheiten zu schützen.
Richtig ist auch, dass die Diagnose „hirntot“ nicht gleichbedeutend ist mit „tot“. Verständlich ist also die Angst vor falschen Diagnosen oder vor Willkür. Aber die Gefahr besteht immer, wenn transplantiert wird. Wie bei allen medizinischen Fragen muss man auch hier beste Vorsorge vor Missbrauch leisten – durch gute Ausstattung der Entnahmekrankenhäuser etwa.
Und am Ende sollte niemand vergessen, dass er oder sie sehr viel wahrscheinlicher zum Empfänger als zum Spender wird.
Ariane Lemme
NEIN,
denn es ist mit unseren demokratischen Grundregeln nicht vereinbar, wenn der Staat seine Bürger nötigt, für Organspenden zur Verfügung zu stehen. Längst geht es bei der Debatte nur noch um Zahlen: Wie können wir erreichen, dass mehr Organe zur Verfügung stehen? Das scheint die absolute Prämisse zu sein. Kritik an den jetzt im Bundestag vorliegenden Anträgen ist nur noch zulässig, wenn sie sich diesem Ziel unterordnet.
Geht es nach dem Gesundheitsminister, sollen wir alle als potenzielle Organspender eingestuft werden, wenn wir nicht zuvor widersprochen haben. Die Angehörigen können im Falle einer bevorstehenden Organentnahme auch widersprechen, aber nur, wenn der potenzielle Spender sich zu Lebzeiten dazu geäußert hat. Man muss jetzt schon befürchten, dass diese Zusatzfrage eines Tages aus dem Gesetz gestrichen wird. Dann bleibt die reine Widerspruchslösung so, wie sie sich viele Transplantationsmediziner heute schon wünschen.
Die Frage, ob es mit Demokratie und Selbstbestimmung grundsätzlich vereinbar ist, einen Hirntoten zum Organspender zu machen, ohne dass er selbst zuvor eingewilligt hat, wird in den Hintergrund gedrängt. Auch die besondere Problematik des Hirntodkonzepts – ist der Mensch schon tot oder ist er noch im Sterbeprozess? – wird außen vor gelassen.
Die Stimmung im Lande ist mittlerweile so, dass jeder als unsolidarisch angesehen wird, der sich gegen eine Organspende ausspricht. Das Recht darauf, Nein zu sagen, darf jedoch nicht infrage gestellt werden. Und begründungspflichtig darf das persönliche Nein niemals werden.
Bezüglich des Organspende-Registers wird häufig kolportiert, Menschen hätten Angst, sich dort eintragen zu lassen, weil sie befürchten, nach einem schweren Unfall nicht alle medizinische Hilfe zu bekommen: weil die Ärzte dringend einen Organspender brauchen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: So wie die Debatte geführt wird, muss man Angst haben, weniger gut behandelt zu werden, wenn der Arzt in der Patientenakte sieht, dass bei Organspende Nein angekreuzt ist.
Wolfgang Löhr
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen











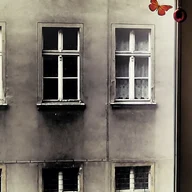
meistkommentiert