Satire kann zu weit gehen: Rassistische Gedankenspiele
In einem satirischen Text entwirft ein taz-Autor das Szenario eines „Gaza-Erlebnisparks“. Dabei bedient er rassistische Klischees und rechte Narrative.
U m das voranzustellen: Ja, Satire darf vieles. Ihr enge Grenzen aufzuerlegen, widerspricht ihrem Wesenskern. Und doch sollte sich linke Satire immer wieder hinterfragen: Gegen wen richtet sie sich, welche Narrative bedient sie? Wann ist sie machtkritisch und wann reproduziert sie schlicht frauenfeindliche oder rassistische Klischees, wie es Blondinen- oder Polenwitze tun? Letztes Wochenende ist einem taz-Text diese Balance gründlich misslungen.
Die Grundidee: In der Lüneburger Heide eröffnet ein fiktiver „Gaza-Erlebnispark“. Mitarbeiter in israelischen Militäroutfits kontrollieren am Einlass der Kriegsgebietskulisse Taschen, bei per Sirene angekündigten „Verpflegungsausgaben“ kommt es zu inszenierten Prügeleien und bei Attraktionen wie „Hau die Fatima“ (angelehnt an „Hau den Lukas“) können Besucher:innen mit faustgroßen Steinen auf Gummipuppen mit Kopftuch werfen. Das Elternpaar Jassir und Annalena H. aus Hamburg wird zitiert: Für sie sei der Besuch die „ideale Gelegenheit, um den Antisemitismus ihrer Kinder zu fördern“.
Wer an dieser Stelle entsetzt aussteigt, dem mag versichert sein: Einem Teil der taz-Redaktion ging es ähnlich.
Denn die Idee, fremde Lebensrealitäten in deutschen Parks zu inszenieren, ist nicht neu. Ausgehend von Hamburg verbreiteten sich die sogenannten Völkerschauen ab den 1870ern in ganz Europa. In diesen „Menschenzoos“ ließen die Veranstalter „Wilde“ aus Südwestafrika, aus dem Sudan und aus Grönland zur Bespaßung der Massen auftreten. Fast sechzig Jahre lang trugen sie zur Verbreitung eines rassistischen Überlegenheitsdenkens in Deutschland bei.
Kolonial-rassistisches Denken wird fortgesetzt
Im „Gaza-Erlebnispark“ scheint dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte gänzlich vergessen. Munter dürfen sich hier deutsche Besucher:innen beim Steinewerfen auf eine Gummipuppe mit Kopftuch („Hau die Fatima“) vergnügen. Instrumentalisiert der Autor hier Gewaltfantasien gegen migrantisierte Frauen, um der palästinasolidarischen Szene die Unterstützung der islamistischen Hamas zu unterstellen? Unklar. Was bleibt, ist ein Szenario, das nichtweiße Menschen zum Objekt der eigenen Unterhaltung macht – und sich damit liest wie die Fortsetzung kolonial-rassistischen Denkens.
Der Text knüpft auch an Narrative an, die in der Gegenwart existieren. Denn die Vorstellung des „inszenierten“ Leids in Gaza ist keine Erfindung des Autors, sondern eine von der israelischen Regierung verbreitete Erzählung. Auf YouTube zeigt sie Videos von Supermärkten und Konditoreien in Gaza als angeblichen Beleg dafür, dass die „voreingenommenen Medien“ lügen würden.
Unabhängige Medien berichten seit langem über katastrophalen Hunger in Gaza. Ein taz-Team vor Ort ist den Vorwürfen nachgegangen und hat die Realität beschrieben, in der es für einige wenige zu überteuerten Preisen auch Schoko-Pfannkuchen geben mag – dies aber nichts daran ändert, dass ein Großteil der Menschen hungert. Von Machtkritik ist in dieser Satire, die der Realitätsverzerrung der israelischen Regierung in die Karten spielt, wenig zu spüren.
Der Israel-Palästina-Konflikt wird vor allem in linken Kreisen kontrovers diskutiert. Auch in der taz existieren dazu teils grundverschiedene Positionen. In diesem Schwerpunkt finden Sie alle Kommentare und Debattenbeiträge zum Thema „Nahost“.
Narrativ des „importierten Antisemitismus“
Kommen wir zum Elternpaar Jassir und Annalena H., für das der Besuch des „Gaza-Erlebnisparks“ Gelegenheit sei, „den Antisemitismus ihrer Kinder zu fördern“. Dass die Kinder des fiktiven Arabers Jassir bereits vor Antritt des Parkbesuchs antisemitisch denken, scheint hier Teil des Humors. Was könnten arabische Kinder auch anderes sein als Antisemiten in Kinderschuhen? Oder „kleine Paschas“, wie Friedrich Merz es ausdrücken würde.
Das Klischee des „antisemitischen Arabers“ funktioniert dabei ähnlich wie das Stereotyp des „kriminellen Ausländers“. Es reduziert eine Gruppe auf ein ihnen zugeschriebenes Merkmal und lässt daneben wenig Menschlichkeit zu. Die Kunstfigur Jassir und sein angeblich antisemitischer Nachwuchs bedienen damit das von CDU bis AfD propagierte Narrativ des „importierten Antisemitismus“, der Antisemitismus in Deutschland vor allem migrantischen Communities zuschiebt – und damit von dem in Deutschland zur Genüge verankerten Antisemitismus und Rassismus ablenkt.
Die Presse- und Kunstfreiheit ist ein hohes Gut. Sie schützt auch diese pietätlose und von rassistischen Klischees und rechten Narrativen gespickte Satire, die erscheint, während die israelische Regierung in Gaza mutmaßlich einen Völkermord verübt. Aber als linke Zeitung muss man sich fragen, ob man diesen diskriminierenden Humor publizistisch verstärken will. Oder ob man es einfach lässt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
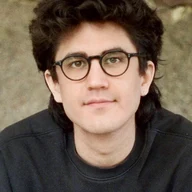







meistkommentiert