Jürgen Klopp wechselt zu Red Bull: The Stinknormal One
Klopp wird Teil des Red-Bull-Projekts. Ausgerechnet er – könnte man meinen. Aber mit dem Deal bleibt er sich treu im durchkommerzialisierten Fußballgeschäft.
J ürgen Klopp hat es selbst gesagt. „Ich bin der Normale.“ Das waren seine Worte, als er 2015 beim FC Liverpool als Trainer vorgestellt worden ist. Jetzt sollte es die Fußballwelt endlich verstanden haben. Er ist wirklich nichts Besonderes. Er ist ein stinknormaler Marktteilnehmer im großen Fußballbusiness. Jetzt wird er, der Borussia Dortmund 2011 und 2012 zum Titel in der Bundesliga geführt und damit eine ganze Region zu Freudentränen gerührt hat, „Head of Global Soccer“ bei Red Bull.
Head of Global Soccer, ein Titel so verkommen wie der moderne Fußball, der von arabischen Öllmilliarden, von Investorendollars aus den USA und eben aus dem Marketing-Etat eines Getränkeherstellers in immer absurdere Höhen gepusht wird.
Wer zahlt, gewinnt Titel – oder die Unterschrift eines der besten Trainer der Welt. Teil des Deals sind dann solche blutleeren Statements: „Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen.“ Die Masche von Red Bull ist es zu behaupten, dem Fußball durch das Engagement des Konzerns zu dienen. Und so betreibt er Profiklubs am Firmensitz in Österreich, in den USA und mit RB Leipzig in Deutschland einen Bundesligisten, der zum Stammgast in der Champions League gepäppelt wurde.
Wenn Leipzig zum Heimspiel lädt, wedeln Zuschauer mit Fahnen, auf denen wie auf dem Firmenlogo zwei Bullen zu sehen sind. Und wenn der Klub den Sieg im DFB-Pokal feiert, wird statt des traditionellen Biers schon mal eine Dose Koffeinlimo aus dem Cup geschlürft. Das ist so folgerichtig wie der Besuch von Pep Guardiola nach dem Champions-League-Sieg von Manchester City in Abu Dhabi. Er hat den Geldgebern des Klubs den Henkelpott ins Emirat gebracht. „Football’s Coming Home“, witzelte das Netz. Es hatte recht.
Der brave Klopp und seine „Jungs“
Nun wird also Jürgen Klopp zum Teil des Red-Bull-Projekts. Ausgerechnet er! In den sozialen Medien herrschte am Mittwochmorgen beinahe so etwas wie Entsetzen über den Deal. Wie keinem anderen war es Klopp in der Vergangenheit gelungen, sich ein bodenständiges Image aufzubauen. Seine hemdsärmelige Art hat dazu geführt, dass man glatt glauben konnte, er habe einst auf den Ascheplätzen Dortmunds wackere Arbeiterkinder aufgesammelt, sie zu einer Mannschaft zusammengeschweißt, die sich dann mit ehrlichem Kampfspiel zu zwei Meistertiteln malocht hat.
Beim FC Liverpool, mit dem er die Champions League und die englische Meisterschaft gewonnen hat, hat er auch von diesem Image gelebt. Dass Borussia Dortmund eine börsennortierte Aktiengesellschaft ist, deren Fußball spielende Angestellte gewiss mehr verdienen als den Mindestlohn, war man bereit zu verdrängen beim Anblick des Trainers mit dem „Pöhler“-Base-Cap auf dem Kopf.
Der brave Jürgen Klopp und seine „Jungs“ (Klopp über seine Spieler) haben den Glauben an den richtigen Fußball im falschen am Leben erhalten. Und dass es nicht der Working-Class-Mythos Anfield Road war, sondern das Geld eines sportversessenen US-Investors, das die Erfolge in Liverpool ermöglicht hat, das hat man nur allzu gerne nicht mitbedacht, wenn Klopp beim Einmarsch ins Stadion das Liverpooler Klubwappen gestreichelt hat.
Jürgen Klopp braucht niemanden, der ihm Flügel verleiht. Er kann jederzeit abheben mit einem Privatjet und zu den Terminen fliegen, die er für die zahlreichen Firmen wahrzunehmen hat, denen er sein ewiges Strahlen zu Werbezwecken vertickt hat. In den Spots für die Deutsche Vermögensberatung oder – ganz frisch für Media Markt – wird er so hemdsärmelig inszeniert, wie ihn die Menschen als Trainer an der Linie in Erinnerung haben. Aber es ist eben nichts als eine Inszenierung. Ob die mit dem Engagement beim Limokonzern Red Bull, dessen Leipziger Franchise bei den deutschen Kurvenfans besonders verhasst ist, noch funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Abseits der Inszenierung ist sich Klopp mit dem Deal treu geblieben als Big Player im durchkommerzialisierten Fußballgeschäft. Ganz normal eben.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






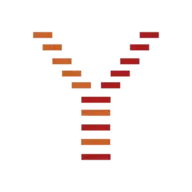






meistkommentiert
Klage von Afghanen
Eilanträge für Einreise nach Deutschland
Verteuerung der Freibäder
Das Gegenteil von Dekadenz und Privileg
So viel Geld entgeht den Staatskassen
Blackrocks lukrative Steuergestaltung
„From the River to the Sea“
Freispruch nach verbotener Palästina-Parole in Berlin
Kriege in der Ukraine und Iran
Westliche Solidarität in der Sackgasse
Wohnraumverteilung in Deutschland
Eine Seniorin, 100 Quadratmeter