Frankreich nach der Wahl: Kein Geld für teure Experimente
Ob links, Mitte oder rechts: Die künftige französische Regierung hat nur wenig Spielraum für Reformen. Frankreich ist hochverschuldet.

Ein paar Zahlen verdeutlichen, wie sehr sich die Lage nach der Covid-Epidemie verschlimmert hat: Die öffentliche Verschuldung betrug am Ende des ersten Quartals 2024 3,1 Billionen Euro, das entspricht 111 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Haushaltsdefizit sollte gemäß Budgetentwurf von 5,5 bis Ende des Jahres auf 5,1 Prozent des BIP gesenkt werden. Doch davon ist Frankreich weit entfernt.
Emmanuel Macrons Regierung mit Premierminister Gabriel Attal von der Partei Ensemble hatte für die kommenden Jahre Einsparungen der öffentlichen Ausgaben um 30 Milliarden Euro versprochen, um bis 2027 das Haushaltsdefizit auf die von der EU geforderte Grenzmarke von 3 Prozent zu senken.
Dieser Plan ist mit Ausrufung der Neuwahlen bereits Makulatur: Ensemble versprach im Wahlkampf, auf eine Reform des Arbeitslosengeldes zu verzichten. Diese hatte schärfere Bedingungen für den Anspruch auf Leistungen bedeutet und – freilich zu Lasten der Arbeitslosen – schon in diesem Jahr zu den Kostensenkungen beigetragen. Die Reform hätte in diesem Monat in Kraft treten sollen. Doch das ist nun passé.
Politische Instabilität verunsichert die Finanzmärkte
Auch links und rechts von Ensemble waren die Wahlversprechen üppiger als die Staatskasse. Der frühere EZB-Präsident Jean-Claude Trichet sagte dazu: „Die Programme der Neuen Volksfront (NFP) und des Rassemblement National (RN) sind für mich beide aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht sehr gefährlich.“ Die Ausgangslage sei keineswegs vergleichbar mit 1981, als der neugewählte sozialistische Präsident François Mitterrand eine Reihe von Sozialreformen (Pensionsalter 60, fünf Wochen Urlaub) beschloss. Damals betrug der BIP-Anteil der Staatsschuld bloß 21 Prozent, nicht 111 Prozent wie heute.
Mit den sozialpolitischen Vorschlägen des NFP würde laut Trichet das französische Defizit in drei Jahren um 100 Milliarden zunehmen. Allein die vom RN angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer für Energie und Nahrungsmittel würde die Staatskasse 20 Milliarden Euro kosten. „Weder der NFP noch das RN scheinen den Ernst der aktuellen Situation zu verstehen“, meint Ex-EZB und Nationalbankchef im Magazin Le Point.
Die Aussicht auf eine politische Instabilität verunsichert bereits die Finanzmärkte. Ohne die Perspektiven allzu schwarz malen zu wollen, könnte Frankreich bei den Investoren und Geldgebern weniger attraktiv werden, in der Folge würden die Zinssätze steigen und damit die Verschuldung teurer werden, was die Einhaltung der Maastricht-Kriterien weiter erschwert.
Für die heutige EZB-Vorsitzende Christine Lagarde könnte sich daher ein Dilemma ergeben, weil Sanktionen die finanzielle Gesundung Frankreichs hinauszögern könnten. Wie sie reagieren würde, falls mit einer neuen Regierung in Paris die Haushaltsdisziplin in Vergessenheit geraten sollte, lässt sie offen: „Die EZB wird tun, was sie tun muss. Unsere Aufgabe ist es, für die Preisstabilität zu sorgen, und diese hängt wiederum von der Stabilität der Finanzen ab.“
Falls indes eine politische Krise in Frankreich die Finanzmärkte in Panik versetzt, wäre rasch die ganze Eurozone betroffen und die EZB zum Eingreifen gezwungen. Diese unerfreuliche Ausgangslage könnte die Wahlsieger dazu veranlassen, allzu kostspielige Versprechen auf später zu verschieben oder aber das Angebot, die Regierungsverantwortung zu übernehmen, dann doch lieber gleich abzulehnen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







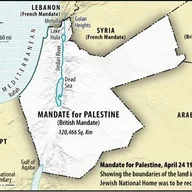

meistkommentiert
Militärhistoriker über Kriegstüchtigkeit
„Wir brauchen als Republik einen demokratischen Krieger“
Linke zu AfD-Verbot
Mutige Minderheitenmeinung
Digitale Urlaubsplanung
Der Buchungswahn zerstört das Reisen
Psychologe über Hamburger Messerangriff
„Der Vorfall war nicht vorhersagbar“
+++ Nachrichten im Nahost-Konflikt +++
„Werden jüdischen israelischen Staat im Westjordanland errichten“
Trumps Kampf gegen die Justiz
Der autoritär-faschistische Staatsumbau