Bürgergeld in Koalitionsverhandlungen: Es geht ums Geld
Das Bürgergeld soll Hartz IV ersetzen. Trotz Streit um das soziale Kernversprechen der neuen Koalition zeichnet sich allmählich ab, was geplant ist.
Wenn man mit Katja Mast, der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion, über das neue Bürgergeld reden will, ruft nach kurzer Bedenkzeit ein sehr freundlicher Pressesprecher zurück. Leider stehe Frau Mast nicht für ein Gespräch zur Verfügung. Man bitte um Verständnis, aber im Moment sei eben Zurückhaltung angebracht.
Die kleine Szene ist durchaus typisch. Am Mittwoch starten offiziell die Verhandlungen über die Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Und es gibt im Moment zwei Arten von Antworten, wenn es um die wichtigen Themen geht. Die einen sind so verschwurbelt, dass man sie sehr genau interpretieren muss. Die anderen sind: vielsagendes Schweigen. Beim Bürgergeld, das Hartz IV ersetzen soll und ein soziales Kernversprechen der neuen Koalition ist, zeichnet sich aber in Umrissen ab, was geplant ist.
Im Moment bekommt ein alleinstehender Erwachsener monatlich 446 Euro Hartz IV. Die Sätze steigen ab Januar 2022 um 3 Euro. Diese Minierhöhung wird von Sozialverbänden scharf kritisiert. Sie sei „zynisch und verfassungswidrig“, sagt Ulrich Schneider, Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. „Um Hartz IV zu überwinden, zählen zwei Dinge: Man muss mit dem Geld über den Monat kommen“, sagt er. Außerdem müssten die Sanktionen komplett gestrichen werden.
Der Paritätische hält mindestens 600 Euro im Monat für angemessen, weil dies das soziokulturelle Existenzminimum abbilde. Wegen der stark steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten müsse die neue Koalition schnell handeln, fordert Schneider.
„Höher, einfacher und unterstützender“
Klar ist: Das Ampelbündnis will die Sätze für das neue Bürgergeld anheben und die Sanktionen für Arbeitslose abschwächen. Dafür macht sich auch die künftige Kanzlerpartei SPD stark, die Hartz IV unter Gerhard Schröder seinerzeit erfand. Die Vorsitzende Saskia Esken sagte am Montag im taz-Interview, das Bürgergeld müsse „auskömmlich“ sein – und neu berechnet werden. Ihr Co-Chef Norbert Walter-Borjans betonte kurz zuvor: „Für das neue Bürgergeld wird die Formel gelten: Höher, einfacher und unterstützender.“
Auch die Grünen wollen Arbeitslosen mehr Geld geben – und Druck aus dem rigiden System nehmen, das auf Zwang setzt. „Wir haben die Situation, dass die Inflation derzeit hoch ist und Energiepreise steigen“, sagt der grüne Sozialpolitiker Sven Lehmann. „Deswegen werden wir dafür Sorge tragen müssen, dass Menschen mit wenig Einkommen besser über den Monat kommen, etwa arme Rentner oder Erwerbslose.“ Das Existenzminimum solle „angehoben werden und auskömmlich sein“.
Wie gesagt, es kommt auf den Wortlaut an. Auskömmlich – das kann alles heißen und nichts. Lehmann formuliert maximal vorsichtig. Eigentlich fände der Sozialpolitiker, der das Thema für die Grünen verhandeln wird, einen satten Aufschlag richtig. Im Wahlkampf forderten die Grünen 50 Euro mehr und den Wegfall der Sanktionen.
Lehmanns Zurückhaltung folgt der Verhandlungslogik. Keiner aus SPD und Grünen will die FDP mit allzu forschen Vorstößen verärgern. Selbst Juso-Chefin Jessica Rosenthal, die leidenschaftlich für die Überwindung von Hartz IV warb, will sich auf taz-Anfrage im Moment lieber nicht äußern.
Aber intern machen die Jusos dem Vernehmen nach Druck. Sie sind ein Machtfaktor in der Ampel, weil sie in der SPD-Fraktion 49 Abgeordnete stellen. Nur die Grüne Jugend sagt offen, was sie wirklich will.
Die Vorsitzende Sarah-Lee Heinrich kritisiert, dass die Regelsätze künstlich kleingerechnet und nicht armutsfest seien. „Das ist nicht weiter hinnehmbar“, betont sie. „Was die Höhe angeht, gibt es ja schon einige Berechnungen, aber unter 600 Euro für Erwachsene wird es sicher nicht liegen.“ Das ist eine optimistische und vermutlich unrealistische Prognose.
Der Knackpunkt sind die Finanzen. Die Regelsätze für das Bürgergeld gehören – anders als Investitionen in Brücken, Schulen oder Windräder – zu den sogenannten konsumtiven Ausgaben, zu jenen Ausgaben also, die Jahr für Jahr anfallen – und jeweils im laufenden Jahr Wirkung entfalten. Eine ernst gemeinte Hartz-IV-Reform würde einen zweistelligen Milliardenbetrag im Jahr kosten.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband schätzte die jährlichen Kosten für einen armutsfesten Hartz-IV-Regelsatz 2020 auf 14,5 Milliarden Euro. Die Grünen kalkulieren für einen 50-Euro-Aufschlag auf die derzeitigen Sätze einen einstelligen Milliardenbetrag. Verschärfend kommt hinzu, dass in der Ampelplanung mehrere sehr teure Projekte gegeneinander stehen.
Eine Kindergrundsicherung, die ihren Namen verdient, kostet ebenfalls gut 10 Milliarden Euro. Die Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels bei den Verteidigungsausgaben schlüge gar mit einem Mehrfachen dieser Summe zu Buche.
Welche Regelsatzhöhe lässt sich noch als Erfolg verkaufen?
Die Ampel-VerhandlerInnen müssen also harte Entscheidungen treffen. Was macht man, was lässt man weg? Ist es richtig, die Kindergrundsicherung zulasten des Bürgergeldes zu priorisieren? Oder umgekehrt? Ab welcher Regelsatzhöhe lässt sich ein Bürgergeld noch als Erfolg verkaufen? Solche Fragen könnten erst nach dem 10. November geklärt werden, wenn die ChefInnen sich über Ergebnisse der Arbeitsgruppen beugen – und Themen gegeneinander tauschen.
Ein höheres Bürgergeld würde aus zwei Gründen gut in die Systematik der Ampel passen. Erstens hat sich die Koalition in spe bereits auf einen Mindestlohn von 12 Euro verständigt. Ein höheres Existenzminimum wäre also möglich, ohne dass das sogenannte Lohnabstandsgebot verletzt würde. Auf jenes hatte Esken in der taz verwiesen. „Wer Vollzeit arbeitet, muss mehr in der Tasche haben als BezieherInnen einer Lohnersatzleistung“, sagte sie. Wenn die Löhne stiegen, könne Letztere entsprechend höher sein.
Zweitens gibt es auch für die skeptische FDP ein gutes Argument, eine Regelsatzerhöhung mitzutragen. Das Existenzminimum, das das neue Bürgergeld markieren würde, darf nicht besteuert werden. Durch einen Aufschlag würde deshalb automatisch der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer angehoben. Dies bedeutet faktisch eine Steuersenkung für alle Einkommensgruppen – und könnte von Christian Lindners Freidemokraten entsprechend beworben werden.
Auch bei den Sanktionen für Arbeitslose wird es Veränderungen geben. Im Sozialstaatskonzept der SPD steht, dass das soziokulturelle Existenzminimum „jederzeit gesichert“ sein müsse. Nimmt man diese Formel ernst, die Esken hervorhebt, müsste mit der Praxis Schluss sein, dass Jobcenter Arbeitslosen die Geldleistungen kürzen, wenn diese nicht alle Vorgaben einhalten.
Sanktionen kleinverhandeln
Im Sondierungspapier des Bündnisses steht, dass an den „Mitwirkungspflichten“ von Arbeitslosen festgehalten werde. Jene sind vielfältig, Arbeitslose müssen fürs Jobcenter erreichbar sein, ihre Vermögensverhältnisse offenlegen, Termine wahrnehmen und so weiter. Und: Was passiert, wenn die Pflichten nicht eingehalten werden, bleibt im Papier offen.
Bei den Grünen heißt es, sie wollten nun im Kampf um Spiegelstriche die Sanktionen Schritt für Schritt kleinverhandeln. In den Jobcentern wolle man zu einer „neuen Kultur der Augenhöhe“, sagt der Sozialpolitiker Sven Lehmann. Vor allem müsse man sich anschauen, wo Bürokratie überhandgenommen habe. „Während Corona haben vor allem Selbstständige kaum Grundsicherung beantragt, obwohl sie es gebraucht hätten.“
Auch das ist ein zarter Wink in Richtung FDP. Deren Parteichef Christian Lindner macht sich bekanntlich an anderer Stelle gerne für die Interessen von Selbstständigen stark.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen










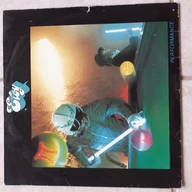
meistkommentiert